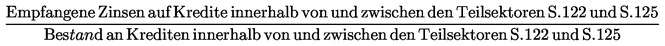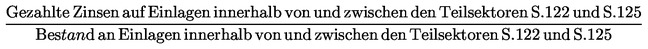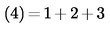ANHANG A
|
KAPITEL 1 |
ALLGEMEINE MERKMALE UND GRUNDPRINZIPIEN |
ÜBERBLICK
Globalisierung
VERWENDUNGSZWECKE DES ESVG 2010
Instrument für Analyse und Politik
Merkmale der ESVG-2010-Konzepte
Sektorengliederung
Satellitenkonten
ESVG 2010 und SNA 2008
ESVG 2010 und ESVG 95
GRUNDSÄTZE DES ESVG 2010 ALS SYSTEM
Einheiten und ihre Zusammenfassungen
Institutionelle Einheiten und Sektoren
Örtliche FE
Gebietsansässige und gebietsfremde Einheiten sowie Volkswirtschaft und übrige Welt
Strom- und Bestandsgrößen
Stromgrößen
Transaktionsarten
Merkmale der Transaktionen
Interaktionen und Transaktionen innerhalb von Einheiten
Monetäre und nichtmonetäre Transaktionen
Transaktionen mit und ohne Gegenleistung
Abgewandelte Transaktionen
Umleitung
Aufteilung
Betonung des Haupttransaktionspartners
Grenzfälle
Sonstige Vermögensänderungen
Sonstige reale Vermögensänderungen
Umbewertungsgewinne/-verluste
Bestandsgrößen
Das Kontensystem und die Aggregate
Buchungsregeln
Bezeichnung der beiden Kontenseiten
Doppelbuchung/Vierfachbuchung
Bewertung
Besondere Regeln für die Bewertung von Gütern
Bewertung zu konstanten Preisen
Buchungszeitpunkt
Konsolidierung und Saldierung
Konsolidierung
Saldierung
Konten, Kontensalden und Aggregate
Die Kontenabfolge
Das Güterkonto
Die Konten der übrigen Welt
Kontensalden
Volkswirtschaftliche Aggregate
Das BIP: ein zentrales volkswirtschaftliches Aggregat
Das Input-Output-System
Aufkommens- und Verwendungstabellen
Symmetrische Input-Output-Tabellen
|
KAPITEL 2 |
EINHEITEN UND IHRE ZUSAMMENFASSUNGEN |
ABGRENZUNG DER VOLKSWIRTSCHAFT
DIE INSTITUTIONELLEN EINHEITEN
Hauptverwaltungen und Holdinggesellschaften
Unternehmensgruppen
Zweckgesellschaften
Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen
Künstliche Tochterunternehmen
Zweckgesellschaften des Staates
DIE INSTITUTIONELLEN SEKTOREN
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)
Teilsektor öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11001)
Teilsektor inländische private nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11002)
Teilsektor ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11003)
Finanzielle Kapitalgesellschaften (S.12)
Finanzielle Mittler
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten
Finanzielle Kapitalgesellschaften, die nicht finanzielle Mittler sind oder Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten ausüben
Institutionelle Einheiten des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
Die neun Teilsektoren des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
Zusammenfassung von Teilsektoren des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
Untergliederung der Teilsektoren der finanziellen Kapitalgesellschaften in öffentlich, inländisch privat und ausländisch kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften
Zentralbank (S.121)
Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122)
Geldmarktfonds (S.123)
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124)
Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) (S.125)
Finanzielle Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben (FMKG)
Wertpapierhändler, finanzielle Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren, und spezielle finanzielle Kapitalgesellschaften
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126)
Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.127)
Versicherungsgesellschaften (S.128)
Pensionseinrichtungen (S.129)
Staat (S.13)
Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung) (S.1311)
Länder (ohne Sozialversicherung) (S.1312)
Gemeinden (ohne Sozialversicherung) (S.1313)
Sozialversicherung (S.1314)
Private Haushalte (S.14)
Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142)
Arbeitnehmerhaushalte (S.143)
Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern (S.1441)
Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern (S.1442)
Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte (S.1443)
Private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.15)
Übrige Welt (S.2)
Sektorale Zuordnung der produzierenden Einheiten nach der Rechtsform
ÖRTLICHE FACHLICHE EINHEITEN UND WIRTSCHAFTSBEREICHE
Örtliche fachliche Einheit
Wirtschaftsbereiche
Klassifikation der Wirtschaftsbereiche
HOMOGENE PRODUKTIONSEINHEITEN UND HOMOGENE PRODUKTIONSBEREICHE
Homogene Produktionseinheit
Homogener Produktionsbereich
|
KAPITEL 3 |
GÜTERTRANSAKTIONEN UND TRANSAKTIONEN MIT NICHTPRODUZIERTEN VERMÖGENSGÜTERN |
GÜTERTRANSAKTIONEN IM ALLGEMEINEN
PRODUKTION UND PRODUKTIONSWERT
Haupt-, Neben- und Hilfstätigkeiten
Produktionswert (P.1)
Institutionelle Einheiten: Unterscheidung in Markt, für die Eigenverwendung und Nichtmarkt
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Produktion
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (Teil A)
Hergestellte Waren (Teil C); Gebäude und Bauarbeiten (Teil F)
Handelsleistungen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen (Teil G)
Verkehrs- und Lagereileistungen (Teil H)
Beherbergung und Gastronomiedienstleistungen (Teil I)
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen: Produktion der Zentralbank (Teil K)
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Teil K): Finanzdienstleistungen allgemein
Finanzdienstleistungen, die für direkte Entgelte erbracht werden
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung von Zinsen
Finanzdienstleistungen bestehend aus dem Erwerb und der Veräußerung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf den Finanzmärkten
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen und Alterssicherungssystemen; ihre Tätigkeit wird durch Versicherungsbeiträge und Sparerträge finanziert
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens (Teil L)
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (Teil M); Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen Teil N)
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung (Teil O)
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen (Teil P); Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens (Teil Q)
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen (Teil R); Sonstige Dienstleistungen (Teil S)
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen (Teil T)
VORLEISTUNGEN (P.2)
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Vorleistungen
KONSUM (P.3, P.4)
Konsumausgaben (P.3)
Konsum nach dem Verbrauchskonzept (P.4)
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Konsumausgaben
Buchungszeitpunkt und Bewertung des Konsums nach dem Verbrauchskonzept
BRUTTOINVESTITIONEN (P.5)
Bruttoanlageinvestitionen (P.51g)
Buchungszeitpunkt und Bewertung von Bruttoanlageinvestitionen
Abschreibungen (P.51C)
Vorratsveränderungen (P.52)
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Vorratsveränderungen
Nettozugang an Wertsachen (P.53)
EXPORTE UND IMPORTE (P.6 UND P.7)
Warenexporte und Warenimporte (P.61 und P.71)
Dienstleistungsexporte und Dienstleistungsimporte (P.62 und P.72)
TRANSAKTIONEN MIT VORHANDENEN GÜTERN
NETTOZUGANG AN NICHTPRODUZIERTEN VERMÖGENSGÜTERN (NP)
|
KAPITEL 4 |
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN |
ARBEITNEHMERENTGELT (D.1)
Bruttolöhne und -gehälter (D.11)
Bruttolöhne und -gehälter in Form von Geldleistungen
Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen
Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.12)
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.121)
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.122)
PRODUKTIONS- UND IMPORTABGABEN (D.2)
Gütersteuern (D.21)
Mehrwertsteuer (MwSt.) (D.211)
Importabgaben (D.212)
Sonstige Gütersteuern (D.214)
Sonstige Produktionsabgaben (D.29)
Produktions- und Importabgaben an die Organe der Europäischen Union
Produktions- und Importabgaben: Buchungszeitpunkt und zu buchende Beträge
SUBVENTIONEN (D.3)
Gütersubventionen (D.31)
Importsubventionen (D.311)
Sonstige Gütersubventionen (D.319)
Sonstige Subventionen (D.39)
VERMÖGENSEINKOMMEN (D.4)
Zinsen (D.41)
Zinsen auf Einlagen und Kredite
Zinsen auf Schuldverschreibungen
Zinsen auf kurzfristige Schuldverschreibungen
Zinsen auf langfristige Schuldverschreibungen
Zinsswaps und Forward Rate Agreements
Zinsen auf Finanzierungsleasing
Sonstige Zinsen
Buchungszeitpunkt
Ausschüttungen und Entnahmen (D.42)
Ausschüttungen (D.421)
Gewinnentnahmen (D.422)
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen (D.43)
Sonstige Kapitalerträge (D.44)
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen (D.441)
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen (D.442)
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen (D.443)
Pachteinkommen (D.45)
Pachten für Land und Gewässer
Pachten für den Abbau von Bodenschätzen
EINKOMMEN- UND VERMÖGENSTEUERN (D.5)
Einkommensteuer (D.51)
Sonstige direkte Steuern und Abgaben (D.59)
SOZIALBEITRÄGE UND SOZIALLEISTUNGEN (D.6)
Nettosozialbeiträge (D.61)
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611)
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.612)
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte (D.613)
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (D.614)
Monetäre Sozialleistungen (D.62)
Geldleistungen der Sozialversicherung (D.621)
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung (D.622)
Sonstige soziale Geldleistungen (D.623)
Soziale Sachleistungen (D.63)
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (D.631)
Soziale Sachleistungen — vom Staat und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck gekaufte Marktproduktion (D.632)
SONSTIGE LAUFENDE TRANSFERS (D.7)
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen (D.71)
Nichtlebensversicherungsleistungen (D.72)
Laufende Transfers innerhalb des Staates (D.73)
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit (D.74)
Übrige laufende Transfers (D.75)
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (D.751)
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten (D.752)
Übrige laufende Transfers, a.n.g. (D.759)
Geldstrafen und gebührenpflichtige Verwarnungen
Lotterien und Spiele
Entschädigungszahlungen
MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel (D.76)
ZUNAHME BETRIEBLICHER VERSORGUNGSANSPRÜCHE (D.8)
VERMÖGENSTRANSFERS (D.9)
Vermögenswirksame Steuern (D.91)
Investitionszuschüsse (D.92)
Sonstige Vermögenstransfers (D.99)
MITARBEITERAKTIENOPTIONEN
|
KAPITEL 5 |
FINANZIELLE TRANSAKTIONEN |
ÜBERBLICK ÜBER FINANZIELLE TRANSAKTIONEN
Finanzielle Vermögenswerte, finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten
Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten
Kategorien von Forderungen und Verbindlichkeiten
Vermögensbilanzen, Finanzierungskonto und sonstige Ströme
Bewertung
Netto- und Bruttoverbuchung
Konsolidierung
Saldierung
Regeln für die Verbuchung finanzieller Transaktionen
Eine finanzielle Transaktion mit einem laufenden oder Vermögenstransfer als Gegenbuchung
Finanztransaktionen, denen Vermögenseinkommen gegenübersteht
Buchungszeitpunkt
Ein Finanzierungskonto „von wem zu wem“
GLIEDERUNGEN DER FINANZIELLEN TRANSAKTIONEN NACH EINZELNEN KATEGORIEN
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)
Währungsgold (F.11)
SZR (F.12)
Bargeld und Einlagen (F.2)
Bargeld (F.21)
Einlagen ((F.22) und (F.29))
Sichteinlagen (F.22)
Sonstige Einlagen (F.29)
Schuldverschreibungen (F.3)
Wesentliche Merkmale von Schuldverschreibungen
Klassifizierung nach ursprünglicher Fälligkeit und Währung
Klassifizierung nach Art des Zinssatzes
Festverzinsliche Schuldverschreibungen
Schuldverschreibungen mit veränderlichem Zinssatz
Schuldverschreibungen mit gemischtem Zinssatz
Privatplatzierungen
Verbriefung
Pfandbriefe
Kredite (F.4)
Wesentliche Merkmale von Krediten
Klassifizierung von Krediten nach ursprünglicher Fälligkeit, Währung und Zweck des Kredites
Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten und Transaktionen mit Einlagen
Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten und Transaktionen mit Schuldverschreibungen
Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten, Handelskrediten und Handelswechseln
Lombardkredite und Wertpapierpensionsgeschäfte
Finanzierungsleasing
Andere Arten von Krediten
Forderungen, die nicht zur Kategorie Kredite gehören
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (F.5)
Anteilsrechte (F.51)
Hinterlegungsscheine
Börsennotierte Aktien (F.511)
Nicht börsennotierte Aktien (F.512)
Börsengang, Börsennotiz, Börsenabgang und Aktienrückkauf
Forderungen, die keine Anteilspapiere sind
Sonstige Anteilsrechte (F.519)
Bewertung von Kapitaltransaktionen
Anteile an Investmentfonds (F.52)
Anteile an Geldmarktfonds (F.521)
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)
Bewertung von Transaktionen mit Anteilen an Investmentfonds
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (F.6)
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen (F.61)
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen (F.62)
Ansprüche aus Altersvorsorgeeinrichtung en (F.63)
Bedingte Alterssicherungsansprüche
Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen (F.64)
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen (F.65)
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien (F.66)
Standardisierte Garantien und einmalige Bürgschaften
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (F.7)
Finanzderivate (F.71)
Optionen
Terminkontrakte
Optionen versus Terminkontrakte
Swaps
Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward rate agreements — FRA)
Kreditderivate
Kreditausfallswaps
Finanzinstrumente, die keine Finanzderivate sind
Mitarbeiteraktienoptionen (F.72)
Bewertung der Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (F.8)
Handelskredite und Anzahlungen (F.81)
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten, ohne Handelskredite und Anzahlungen (F.89)
|
ANHANG 5.1 — |
KLASSIFIKATION DER FINANZIELLEN TRANSAKTIONEN |
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach Kategorie
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer Handelbarkeit
Strukturierte Wertpapiere
Klassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Einkommens
Klassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Zinssatzes
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer Laufzeit
Kurze und lange Laufzeit
Ursprüngliche Laufzeit und Restlaufzeit
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer Währung
Geldmengenaggregate
|
KAPITEL 6 |
SONSTIGE STRÖME |
EINFÜHRUNG
SONSTIGE ÄNDERUNGEN DER AKTIVA UND PASSIVA
Sonstige reale Vermögensänderungen (K.1 bis K.6)
Zubuchungen von Vermögensgütern (K.1)
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter (K.2)
Katastrophenschäden (K.3)
Enteignungsgewinne/-verluste (K.4)
Sonstige Volumenänderungen (K.5)
Änderungen der Zuordnung (K.6)
Änderung der Sektorzuordnung und der institutionellen Einheiten (K.61)
Änderungen der Vermögensart (K.62)
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.7)
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.71)
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.72)
Umbewertungsgewinne/-verluste nach Art der Forderungen und Verbindlichkeiten
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) (AF.1)
Bargeld und Einlagen (AF.2)
Schuldverschreibungen (AF.3)
Kredite (AF.4)
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5)
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6)
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8)
Aktiva in Fremdwährung
|
KAPITEL 7 |
VERMÖGENSBILANZEN |
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVA
Definition eines Aktivums
ABGRENZUNG AUS DEN AKTIVA UND PASSIVA
GRUPPEN VON AKTIVA UND PASSIVA
Produzierte Vermögensgüter (AN.1)
Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2)
Forderungen und Verbindlichkeiten (AF)
BEWERTUNG DER AKTIVA UND PASSIVA
Allgemeine Bewertungsgrundsätze
VERMÖGENSGÜTER (AN)
Produzierte Vermögensgüter (AN.1)
Anlagegüter (AN.11)
Geistiges Eigentum (AN.117)
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter (AN.116)
Vorräte (AN.12)
Wertsachen (AN.13)
Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2)
Natürliche Ressourcen (AN.21)
Grund und Boden (AN.211)
Bodenschätze (AN.212)
Sonstiges Naturvermögen (AN.213, AN.214 und AN.215)
Nutzungsrechte (AN.22)
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte (AN.23)
FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN (AF)
Währungsgold und SZR (AF.1)
Bargeld und Einlagen (AF.2)
Schuldverschreibungen (AF.3)
Kredite (AF.4)
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5)
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6)
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7)
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8)
FINANZIELLE VERMÖGENSBILANZEN
NACHRICHTLICHER AUSWEIS
Langlebige Konsumgüter (AN.m)
Ausländische Direktinvestitionen (AF.m1)
Notleidende Kredite (AF.m2)
Erfassung notleidender Kredite
|
ANHANG 7.1 — |
BESCHREIBUNG DER AKTIVA UND PASSIVA |
|
ANHANG 7.2 — |
ÜBERBLICK ÜBER DIE BUCHUNGEN VON DER VERMÖGENSERÖFFNUNGSBILANZ BIS ZUR VERMÖGENSSCHLUSSBILANZ |
|
KAPITEL 8 |
DIE KONTENABFOLGE |
EINLEITUNG
Die Kontenabfolge
DIE KONTENABFOLGE
Transaktionskonten
Produktionskonto (I)
Verteilungs- und Verwendungskonten (II)
Konten der primären Einkommensverteilung (II.1)
Einkommensentstehungskonto (II.1.1)
Primäres Einkommensverteilungskonto (II.1.2)
Unternehmensgewinnkonto (II.1.2.1)
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen (II.1.2.2)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (II.2)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3)
Einkommensverwendungskonto (II.4)
Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) (II.4.1)
Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) (II.4.2)
Vermögensänderungskonten (III)
Vermögensbildungskonto (III.1)
Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (III.1.1)
Sachvermögensbildungskonto (III.1.2)
Finanzierungskonto (III.2)
Konto sonstiger Vermögensänderungen (III.3)
Konto sonstiger realer Vermögensänderungen (III.3.1)
Umbewertungskonto (III.3.2)
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.1)
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.2)
Vermögensbilanzen (IV)
Bilanz am Jahresanfang (IV.1)
Änderung der Bilanz (IV.2)
Bilanz am Jahresende (IV.3)
AUSSENKONTO (V)
Leistungsbilanzen
Außenkonto der Waren und Dienstleistungen (V.I)
Außenkonto der Primäreinkommen und Transfers (V.II)
Außenkonten der Vermögensänderungen (V.III)
Außenkonto der Vermögensbildung (V.III.1)
Außenkonto der Finanzierungsströme (V.III.2)
Außenkonto sonstiger Vermögensänderungen (V.III.3)
Außenkonto für Vermögen und Verbindlichkeiten (V.IV)
GÜTERKONTO (0)
ZUSAMMENGEFASSTE KONTEN
AGGREGATE
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP)
Betriebsüberschuss der Volkswirtschaft
Selbständigeneinkommen der Volkswirtschaft
Unternehmensgewinn der Volkswirtschaft
Nationaleinkommen zu Marktpreisen
Verfügbares Einkommen insgesamt
Sparen
Saldo der laufenden Außentransaktionen
Finanzierungssaldo der gesamten Volkswirtschaft
Reinvermögen der gesamten Volkswirtschaft
Ausgaben und Einnahmen des Staates
|
KAPITEL 9 |
AUFKOMMENS- UND VERWENDUNGSTABELLEN UND INPUT-OUTPUT-SYSTEM |
EINLEITUNG
BESCHREIBUNG
STATISTISCHES INSTRUMENT
INSTRUMENT FÜR DIE ANALYSE
DETAILLIERTERE AUFKOMMENS- UND VERWENDUNGSTABELLEN
Klassifikationen
Bewertungsgrundsätze
Handels- und Transportspannen
Produktionssteuern und Importabgaben abzüglich Subventionen
Sonstige Grundkonzepte
Nachrichtliche Angaben
DATENQUELLEN UND ABSTIMMUNG
INSTRUMENT FÜR DIE ANALYSE UND ERWEITERUNGEN
|
KAPITEL 10 |
PREIS- UND VOLUMENMESSUNG |
ANWENDUNGSBEREICH VON PREIS- UND VOLUMENINDIZES IN DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN
Integriertes System der Preis- und Volumenindizes
Andere Preis- und Volumenindizes
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER PREIS- UND VOLUMENMESSUNG
Definition von Preisen und Volumen marktbestimmter Güter
Qualität, Preis und homogene Güter
Preise und Volumen
Neue Güter
Grundsätze für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
Grundsätze für die Wertschöpfung und das Bruttoinlandsprodukt
SPEZIFISCHE PROBLEME BEI DER ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE
Gütersteuern und Gütersubventionen
Sonstige Produktionsabgaben und sonstige Subventionen
Abschreibungen
Arbeitnehmerentgelt
Anlagevermögen und Vorräte
REALEINKOMMMEN DER VOLKSWIRTSCHAFT
RÄUMLICHER PREIS- UND VOLUMENVERGLEICH
|
KAPITEL 11 |
BEVÖLKERUNG UND ARBEITSEINSATZ |
BEVÖLKERUNG
ERWERBSPERSONEN
ERWERBSTÄTIGE
Arbeitnehmer
Selbständige
Erwerbstätige und Wohnsitz
ARBEITSLOSE
BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE
Beschäftigungsverhältnisse und Gebietsansässigkeit
NICHT BEOBACHTETE WIRTSCHAFT
ARBEITSVOLUMEN
Angabe des Arbeitsvolumens
VOLLZEITÄQUIVALENTE
ARBEITSEINSATZ DER ARBEITNEHMER ZU KONSTANTEN LOHNSÄTZEN
MESSGRÖSSEN DER PRODUKTIVITÄT
|
KAPITEL 12 |
VIERTELJÄHRLICHE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN |
EINLEITUNG
CHARAKTERISTISCHE BESONDERHEITEN VIERTELJÄHRLICHER VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN
Buchungszeitpunkt
Unfertige Erzeugnisse
Tätigkeiten, die sich auf bestimmte Zeiträume innerhalb eines Jahres konzentrieren
Zahlungen von geringer Häufigkeit
Schnellschätzungen
Bilanzierung und Benchmarking bei vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
Abstimmung
Konsistenz zwischen vierteljährlichen und jährlichen Gesamtrechnungen — Benchmarking
Verkettete Preis- und Volumenindizes
Saison- und Kalenderbereinigungen
Abfolge der Erstellung saisonbereinigter verketteter Volumenmessungen
|
KAPITEL 13 |
REGIONALE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN |
EINFÜHRUNG
DAS GEBIET EINER REGION
EINHEITEN UND REGIONALE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN
Institutionelle Einheiten
Örtliche fachliche Einheiten und regionale Produktionstätigkeiten nach Wirtschaftsbereichen
REGIONALISIERUNGSVERFAHREN
AGGREGATE FÜR PRODUKTIONSTÄTIGKEITEN
Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt nach Regionen
Aufgliederung der FISIM nach verwendenden Wirtschaftsbereichen
Erwerbstätigkeit
Arbeitnehmerentgelt
Übergang von der regionalen Bruttowertschöpfung zum regionalen BIP
Volumenwachstumsraten der regionalen Bruttowertschöpfung
REGIONALE EINKOMMENSKONTEN DER PRIVATEN HAUSHALTE
|
KAPITEL 14 |
UNTERSTELLTE BANKGEBÜHREN (FISIM) |
DAS KONZEPT DER FISIM UND DIE AUSWIRKUNGEN IHRER AUFGLIEDERUNG NACH VERWENDERN AUF DIE WICHTIGSTEN AGGREGATE
BERECHNUNG DER FISIM-PRODUKTION DER SEKTOREN S.122 UND S.125
Benötigte statistische Daten
Referenzzinssätze
Interner Referenzzinssatz
Externe Referenzzinssätze
Detaillierte Untergliederung der FISIM nach institutionellen Sektoren
Untergliederung der den privaten Haushalten zugeordneten FISIM in Vorleistungen und Konsum
BERECHNUNG VON FISIM-IMPORTEN
FISIM ZU VORJAHRESPREISEN
BERECHNUNG VON FISIM NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN
PRODUKTIONSWERT DER ZENTRALBANK
|
KAPITEL 15 |
NUTZUNGSRECHTE |
EINLEITUNG
UNTERSCHEIDUNG VON OPERATING-LEASING, RESSOURCEN-LEASING UND FINANZIERUNGSLEASING
Operating-Leasing
Finanzierungsleasing
Ressourcen-Leasing
Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen
Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP)
Dienstleistungslizenzverträge
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern (AN.221)
Exklusivrechte auf künftige Waren und Dienstleistungen (AN.224)
|
KAPITEL 16 |
VERSICHERUNG |
EINLEITUNG
Direktversicherung
Rückversicherung
Die beteiligten Einheiten
PRODUKTION DER DIREKTVERSICHERUNG
Verdiente Prämien
Zusätzliche Prämien
Bereinigte eingetretene Versicherungsfälle und fällige Leistungen
Bereinigte eingetretene Versicherungsfälle in der Nichtlebensversicherung
Fällige Leistungen im Bereich Lebensversicherung
Versicherungstechnische Rückstellungen
Definition der Versicherungsproduktion
Nichtlebensversicherungen
Lebensversicherung
Rückversicherung
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT DER NICHTLEBENSVERSICHERUNG
Aufteilung der Versicherungsproduktion auf die Verwender
Versicherungsdienstleistungen für die übrige und aus der übrigen Welt
Die Buchungsposten
TRANSAKTIONEN BEI DER LEBENSVERSICHERUNG
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT DER RÜCKVERSICHERUNG
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT VERSICHERUNGSHILFSTÄTIGKEITEN
ANNUITÄTEN
BUCHUNG VON NICHTLEBENSVERSICHERUNGSLEISTUNGEN
Behandlung von bereinigten Versicherungsfällen
Behandlung von Katastrophenschäden
|
KAPITEL 17 |
SOZIALSCHUTZSYSTEME EINSCHLIESSLICH ALTERSSICHERUNG |
EINFÜHRUNG
Sozialschutzsysteme, Sozialhilfe und Einzelversicherungsverträge
Sozialleistungen
Sozialleistungen des Staates
Sozialleistungen anderer institutioneller Einheiten
Alterssicherungsleistungen und sonstige Leistungen
SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR SOZIALEN SICHERUNG OHNE ALTERSSICHERUNGSLEISTUNGEN
Systeme der Sozialversicherung ohne Alterssicherung
Sonstige betriebliche Sozialschutzsysteme
Buchung von Strom- und Bestandsgrößen nach Art des Sozialschutzsystems (ohne Alterssicherung)
Sozialversicherungssystem
Sonstige betriebliche Sozialschutzsysteme (ohne Alterssicherung)
ALTERSSICHERUNGSLEISTUNGEN
Arten von Altersvorsorgeeinrichtungen
Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung
Sonstige betriebliche Altersvorsorgeeinrichtungen
Systeme mit Beitragszusagen
Systeme mit Leistungszusagen
Fiktive Systeme mit Beitragszusagen und Hybridmodelle
Vergleich der Systeme mit Leistungszusagen und mit Beitragszusagen
Verwalter und Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen und Altersvorsorgeeinrichtung mehrerer Arbeitgeber
Buchung von Strom- und Bestandsgrößen nach Art der Altersvorsorgeeinrichtung im Sozialschutz
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung
Transaktionen für sonstige betriebliche Alterssicherungssysteme
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen mit Beitragszusage
Sonstige Ströme in einer Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusage
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusage
ERGÄNZUNGSTABELLE ZU IM RAHMEN DER SOZIALVERSICHERUNG AUFGELAUFENEN RENTENANSPRÜCHEN IM SOZIALSCHUTZ
Aufbau der Ergänzungstabelle
Die Tabellenspalten
Die Tabellenzeilen
Eröffnungs- und Schlussbilanzen
Veränderung bei Alterssicherungsansprüchen aufgrund von Transaktionen
Veränderungen von Alterssicherungsansprüchen aufgrund sonstiger Ströme
Verwandte Indikatoren
Versicherungsmathematische Annahmen
Erworbene Ansprüche
Abzinsungsfaktor
Zunahme von Löhnen und Gehältern
Demografische Annahmen
|
KAPITEL 18 |
AUSSENKONTO ÜBRIGE WELT |
EINLEITUNG
WIRTSCHAFTSGEBIET
Gebietsansässigkeit
INSTITUTIONELLE EINHEITEN
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN ALS IN DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ VERWENDETER BEGRIFF
FIKTIVE GEBIETSANSÄSSIGE EINHEITEN
GEBIETSÜBERGREIFENDE UNTERNEHMEN
GEOGRAFISCHE AUFSCHLÜSSELUNG
DIE INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ
SALDEN IN DEN KONTEN DER LAUFENDEN TRANSAKTIONEN DES INTERNATIONALEN KONTENSYSTEMS
DIE KONTEN FÜR DEN SEKTOR ÜBRIGE WELT UND IHRE BEZIEHUNG ZU DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ
Außenkonto der Gütertransaktionen
Bewertung
Waren zur Veredlung
Transithandel
Transithandelswaren
Importe und Exporte von FISIM
Außenkonto von Primär- und Sekundäreinkommen
Das Primäreinkommenskonto
Einkommen aus Direktinvestitionen
Das Sekundäreinkommenskonto (laufende Transfers) des BPM6
Außenkonto der Vermögensbildung
Finanzierungskonto und Auslandsvermögensstatus
BILANZEN FÜR DEN SEKTOR ÜBRIGE WELT
|
KAPITEL 19 |
EUROPÄISCHE AGGREGATE |
EINFÜHRUNG
VON DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN DER EINZELSTAATEN ZU DEN EUROPÄISCHEN AGGREGATEN
Umrechnung von Angaben in unterschiedlicher Währung
Europäische Organe
Außenkonto der übrigen Welt
Aufrechnung von Transaktionen
Preis- und Volumenmessungen
Vermögensbilanzen
„Intersektorielle“ Matrixdarstellungen
|
ANHANG 19.1 — |
AGGREGATE EUROPÄISCHER ORGANE |
Aufkommen
Verwendung
Konsolidierung
|
KAPITEL 20 |
DIE KONTEN DES SEKTORS STAAT |
EINFÜHRUNG
ABGRENZUNG DES SEKTORS STAAT
Identifizierung von Einheiten im Sektor Staat
Staatliche Einheiten
Dem Sektor Staat zugeordnete Organisationen ohne Erwerbszweck
Sonstige Einheiten des Sektors Staat
Öffentliche Kontrolle
Markt-/Nichtmarktabgrenzung
Konzept der wirtschaftlich signifikanten Preise
Kriterien des Käufers der Produktion eines öffentlichen Produzenten
Die Produktion wird vorrangig an Kapitalgesellschaften und private Haushalte verkauft
Die Produktion wird ausschließlich an den Staat verkauft
Die Produktion wird an den Staat und andere verkauft
Der Markt-/Nichtmarkttest
Finanzielle Mittlertätigkeit und die Abgrenzung des Staates
Grenzfälle
Öffentlich kontrollierte Hauptverwaltungen
Pensionseinrichtungen
Quasi-Kapitalgesellschaften
Restrukturierungsstellen
Privatisierungsstellen
Auffanggesellschaften
Zweckgesellschaften
Gemeinschaftsunternehmen
Marktordnungsstellen
Supranationale Stellen
Die Teilsektoren des Sektors Staat
Bund (Zentralstaat)
Länder
Gemeinden
Sozialversicherung
DIE DARSTELLUNG DER STAATLICHEN FINANZSTATISTIKEN
Bezugsrahmen
Einnahmen
Steuern und Sozialbeiträge
Verkauf
Sonstige Einnahmen
Ausgaben
Arbeitnehmerentgelt und Vorleistungen
Ausgaben für Sozialleistungen
Zinsen
Sonstige laufende Ausgaben
Investitionsausgaben
Verbindung zu den Konsumausgaben (P.3) des Staates
Konsumausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen (COFOG)
Salden
Der Finanzierungssaldo (B.9)
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (B.101)
Finanzierung
Transaktionen mit Forderungen
Transaktionen mit Verbindlichkeiten
Sonstige wirtschaftliche Stromgrößen
Umbewertungskonto
Konto sonstiger realer Vermögensänderungen
Vermögensbilanzen
Konsolidierung
BUCHUNGSPROBLEME IN BEZUG AUF DEN SEKTOR STAAT
Steueraufkommen
Charakter des Steueraufkommens
Steuergutschriften
Zu buchende Beträge
Uneinbringliche Beträge
Buchungszeitpunkt
Periodengerechte Buchung
Periodengerechte Buchung von Steuern
Zinsen
Anleihen mit Disagio und Null-Kupon-Anleihen
Indexgebundene Wertpapiere
Finanzderivate
Gerichtsentscheidung
Militärausgaben
Beziehungen des Staates zu öffentlichen Kapitalgesellschaften
Kapitalbeteiligung an öffentlichen Kapitalgesellschaften und Verteilung der Einkünfte
Kapitalbeteiligung
Kapitalzuführungen
Subventionen und Kapitalzuführungen
Vorschriften für besondere Umstände
Fiskalische Maßnahmen
Ausschüttungen im Falle öffentlich kontrollierter Kapitalgesellschaften
Ausschüttungen oder Entnahme von Eigenkapital
Steuern oder Entnahme von Eigenkapital
Privatisierung und Verstaatlichung
Privatisierungen
Indirekte Privatisierungen
Verstaatlichung
Transaktionen mit der Zentralbank
Restrukturierungen, Fusionen und Neueinstufungen
Schulden
Schuldenübernahme, Schuldenaufhebung und einseitige Wertberichtigung
Schuldenübernahme und -aufhebung
Schuldenübernahme mit einem Transfer von Vermögensgütern
Einseitige Wertberichtigungen oder Teilwertberichtigungen
Sonstige Umschuldung
Erwerb von Schulden über dem Marktwert
Entschuldungen und Rettungsaktionen (Bailouts)
Schuldengarantien
Derivatähnliche Garantien
Standardgarantien
Einmalige Garantien
Verbriefung
Definition
Kriterien für die Anerkennung als Verkauf
Buchung von Strömen
Sonstige Punkte
Verpflichtungen der Alterssicherung
Pauschalzahlungen
Öffentlich-private Partnerschaften
Der Umfang von öffentlich-privaten Partnerschaften
Wirtschaftliches Eigentum und Zuordnung des Anlagegutes
Buchungsprobleme
Transaktionen mit internationalen und supranationalen Organisationen
Entwicklungshilfe
DER ÖFFENTLICHE SEKTOR
Kontrolle durch den öffentlichen Sektor
Zentralbanken
Öffentliche Quasi-Kapitalgesellschaften
Zweckgesellschaften und gebietsfremde Einheiten
Gemeinschaftsunternehmen
|
KAPITEL 21 |
VERBINDUNGEN ZWISCHEN DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG UND DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN UND DER MESSUNG UNTERNEHMERISCHEN HANDELNS |
EINIGE SPEZIFISCHE REGELN UND METHODEN DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG
Buchungszeitpunkt
Doppelte und vierfache Buchführung
Bewertung
Gewinn- und Verlustrechnung und Vermögensbilanz
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN UND BETRIEBLICHE BUCHFÜHRUNG: PRAKTISCHE FRAGEN
DER ÜBERGANG VON DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG ZU VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN AM BEISPIEL NICHTFINANZIELLER UNTERNEHMEN
Konzeptionelle Anpassungen
Anpassungen zur Ermöglichung der Konsistenz mit der Buchführung anderer Sektoren
Beispiele für Anpassungen zur Gewährleistung der Vollständigkeit
SPEZIFISCHE FRAGEN
Umbewertungsgewinne/-verluste
Globalisierung
Fusionen und Übernahmen
|
KAPITEL 22 |
SATELLITENKONTEN |
EINLEITUNG
Funktionale Untergliederungen
HAUPTMERKMALE VON SATELLITENKONTEN
Funktionsspezifische Satellitenkonten
Spezielle Sektorkonten
Berücksichtigung nichtmonetärer Angaben
Detailgenauigkeit und ergänzende Konzepte
Andere grundlegende Konzepte
Nutzung von Modellen und Versuchsergebnissen
Gestaltung und Erstellung von Satellitenkonten
NEUN SPEZIFISCHE SATELLITENKONTEN
Landwirtschaftskonten
Umweltkonten
Gesundheitskonten
Konten Haushaltsproduktion
Arbeitskräftekonten und SAM
Produktivitäts- und Wachstumskonten
Forschungs- und Entwicklungskonten
Sozialschutzkonten
Tourismus-Satellitenkonten
|
KAPITEL 23 |
KLASSIFIKATIONEN |
EINLEITUNG
SEKTOREN (S)
TRANSAKTIONEN UND SONSTIGE STRÖME
Gütertransaktionen (P)
Transaktionen mit nichtproduzierten nichtfinanziellen Vermögensgütern (Codes NP)
Verteilungstransaktionen (D)
Laufende Geld- oder Sachtransfers (D.5-D.8)
Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten (F)
Sonstige Vermögensänderungen (Codes K)
KONTENSALDEN UND REINVERMÖGEN (B)
KLASSIFIKATION DER ANGABEN IN DER VERMÖGENSBILANZ (L)
KLASSIFIKATION DER AKTIVA UND PASSIVA (A)
Nichtfinanzielle Vermögensgüter (AN)
Forderungen (AF)
KLASSIFIKATION ZUSÄTZLICHER POSITIONEN
Notleidende Kredite
Kapitalnutzungskosten
Alterssicherungsbilanz
Langlebige Konsumgüter
Ausländische Direktinvestitionen
Eventualpositionen
Bargeld und Einlagen
Klassifikation von Schuldverschreibungen nach ihrer Fälligkeit
Börsennotierte und nicht börsennotierte Schuldverschreibungen
Langfristige Kredite mit einer Fälligkeit unter einem Jahr und hypothekarisch gesicherte langfristige Kredite
Börsennotierte und nicht börsennotierte Anteile an Investmentfonds
Zins- und Rückzahlungsrückstände
Private Überweisungen und gesamte Überweisungen
ZUSAMMENFASSUNG UND CODIERUNG DER WIRTSCHAFTSBEREICHE (A) UND GÜTERGRUPPEN (P)
KLASSIFIKATION DER AUFGABENBEREICHE DES STAATES (COFOG)
KLASSIFIKATION DER VERWENDUNGSZWECKE DES INDIVIDUALKONSUMS (COICOP)
KLASSIFIKATION DER AUFGABENBEREICHE DER PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK (COPNI)
KLASSIFIKATION DER AUSGABENARTEN NACH ZWECKEN (COPP)
|
KAPITEL 24 |
DIE KONTEN |
|
Tabelle 24.1 |
Konto 0: Güterkonto |
|
Tabelle 24.2 |
Vollständige Kontenabfolge für die Volkswirtschaft |
|
Tabelle 24.3 |
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
|
Tabelle 24.4 |
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften |
|
Tabelle 24.5 |
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor Staat |
|
Tabelle 24.6 |
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor private Haushalte |
|
Tabelle 24.7 |
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck |
KAPITEL 1
ALLGEMEINE MERKMALE UND GRUNDPRINZIPIEN
ÜBERBLICK
|
1.01 |
Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (im Folgenden als „ESVG 2010“ bzw. „ESVG“ bezeichnet) ist ein international vereinheitlichtes Rechnungssystem, das systematisch und detailliert eine Volkswirtschaft (Region, Land, Ländergruppe) mit ihren wesentlichen Merkmalen und den Beziehungen zu anderen Volkswirtschaften beschreibt. |
|
1.02 |
Der Vorläufer des ESVG 2010, das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (das ESVG 95), wurde 1996 veröffentlicht (1). Die ersten dreizehn Kapitel der in diesem Anhang enthaltenen Methodologie der ESVG 2010 weisen dieselbe Struktur wie das ESVG 95 auf, anschließend folgen jedoch elf neue Kapitel, in denen auf Aspekte des Systems eingegangen wird, die Entwicklungen bei der Messung moderner Volkswirtschaften bzw. bei der Verwendung des ESVG 95 in der Europäischen Union (EU) betreffen. |
|
1.03 |
Das vorliegende Handbuch ist wie folgt gegliedert: Kapitel 1 vermittelt einen Überblick über die Konzepte und Grundsätze des ESVG und beschreibt die grundlegenden statistischen Einheiten und ihre Zusammenfassungen. Das Kapitel enthält eine zusammenfassende Darstellung der Kontenabfolge und eine knappe Beschreibung der zentralen volkswirtschaftlichen Aggregate sowie der Funktion der Aufkommens- und Verwendungstabellen und des Input-Output-Systems. In Kapitel 2 werden die bei der Messung der Volkswirtschaft verwendeten institutionellen Einheiten dargestellt und es wird beschrieben, wie diese Einheiten zwecks Analyse zu Sektoren und anderen Gruppen zusammengefasst werden. Gegenstand von Kapitel 3 sind alle Transaktionen im Hinblick auf Güter (Waren und Dienstleistungen) und nichtproduzierte Vermögensgüter im Rahmen des Systems. Kapitel 4 geht auf sämtliche wirtschaftliche Transaktionen ein, bei denen es zu einer Verteilung und Umverteilung von Einkommen und Vermögen in der Volkswirtschaft kommt. Kapitel 5 betrifft die finanziellen Transaktionen in der Volkswirtschaft. In Kapitel 6 werden die Wertänderungen der Aktiva dargestellt, die sich aufgrund von nichtwirtschaftlichen Ereignissen oder Preisveränderungen ergeben können. Kapitel 7 bezieht sich auf Vermögensbilanzen und die Klassifizierung von Aktiva und Passiva. Kapitel 8 enthält eine Darstellung der Kontenabfolge und der Salden der einzelnen Konten. Kapitel 9 geht auf die Aufkommens- und Verwendungstabellen ein sowie auf deren Funktion bei der gesamtwirtschaftlichen Abstimmung der Rechenergebnisse nach dem Entstehungs-, dem Verwendungs- und dem Verteilungsansatz. Ferner gibt dieses Kapitel Aufschluss über die Input-Output-Tabellen, die von den Aufkommens- und Verwendungstabellen abgeleitet werden können. Kapitel 10 beleuchtet die konzeptionelle Grundlage der Preis- und Volumenmessungen im Zusammenhang mit den in den Konten verzeichneten nominalen Werten. In Kapitel 11 werden die Messgrößen für die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt beschrieben, die mit den Messgrößen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen bei der Wirtschaftsanalyse verwendet werden können. Kapitel 12 bietet einen Überblick über die vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und ihre schwerpunktmäßigen Unterschiede gegenüber den jährlichen Gesamtrechnungen. |
|
1.04 |
Kapitel 13 beschreibt den Zweck, die Konzepte und Aspekte der Erstellung eines Gesamtrechnungssystems für die regionale Ebene. Kapitel 14, das die Messung von Finanzdienstleistungen betrifft, die von Finanzmittlern erbracht und durch Nettozinseinnahmen finanziert werden, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung der Mitgliedstaaten, die ein robustes und zwischen den Mitgliedstaaten harmonisiertes Messkonzept anstrebten. Kapitel 15 über Nutzungsrechte ist erforderlich, um einen Bereich von zunehmender Bedeutung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu beschreiben. In den Kapiteln 16 und 17 über Versicherungen, Sozialversicherung und private Alterssicherung wird dargestellt, wie diese Aspekte in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen behandelt werden, da Fragen der Umverteilung mit der Alterung der Bevölkerung zunehmend an Interesse gewinnen. Kapitel 18 betrifft die Konten der übrigen Welt, die das Gegenstück der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu dem Kontensystem der Zahlungsbilanz sind. Kapitel 19 über Europäische Gesamtrechnungen, das ebenfalls neu ist, geht auf Aspekte der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ein, bei denen sich durch europäische institutionelle und handelspolitische Regelungen Probleme ergeben, die ein harmonisiertes Konzept erforderlich machen. In Kapitel 20 werden die Konten für den Sektor Staat dargestellt — ein Bereich von besonderem Interesse, da Fragen der haushaltspolitischen Besonnenheit der Mitgliedstaaten weiterhin von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaftspolitik in der EU sind. In Kapitel 21 werden die Verbindungen zwischen der betrieblichen Buchführung und den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beschrieben, ein Bereich von wachsender Bedeutung, da in allen Ländern ein zunehmender Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf multinationale Kapitalgesellschaften entfällt. In Kapitel 22 wird die Beziehung zwischen den Satellitenkonten und den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beschrieben. Die Kapitel 23 und 24 dienen Bezugszwecken; in Kapitel 23 werden die im ESVG 2010 verwendeten Klassifikationen für Sektoren, Tätigkeiten und Güter dargelegt, und in Kapitel 24 wird die vollständige Kontenabfolge für jeden Sektor dargestellt. |
|
1.05 |
Die Struktur des ESVG 2010 stimmt mit den weltweit geltenden Regeln für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, dem System of National Accounts 2008 (SNA 2008), überein, abgesehen von bestimmten Unterschieden in der Darstellung sowie einem höheren Grad an Genauigkeit einiger ESVG-2010-Konzepte, die für bestimmte EU-Zwecke genutzt werden. Diese Regeln wurden unter der gemeinsamen Verantwortung der Vereinten Nationen (VN), des Internationalen Währungsfonds (IWF), des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Weltbank geschaffen. Das ESVG 2010 ist schwerpunktmäßig auf die Gegebenheiten und den Datenbedarf in der EU ausgerichtet. Wie das SNA 2008 ist das ESVG 2010 auf die Konzepte und Klassifikationen vieler anderer Wirtschafts- und Sozialstatistiken (wie der Statistiken über die Erwerbstätigkeit, die Produktion und den Außenhandel) abgestimmt. Das ESVG 2010 dient daher als zentraler Bezugsrahmen für die Wirtschafts- und Sozialstatistik der EU und ihrer Mitgliedstaaten. |
|
1.06 |
Das ESVG enthält zwei Hauptdarstellungsformen:
|
|
1.07 |
Die Sektorkonten liefern für die einzelnen institutionellen Sektoren eine systematische Beschreibung der verschiedenen Phasen des Wirtschaftskreislaufs, d. h. der Produktion, der Einkommensentstehung, -verteilung, -umverteilung und -verwendung sowie der Änderungen von finanziellem und nichtfinanziellem Vermögen. Zu den Sektorkonten gehören auch Vermögensbilanzen, die die Vermögensbestände, die Verbindlichkeiten und das Reinvermögen am Anfang und am Ende des Rechnungszeitraums zeigen. |
|
1.08 |
Das Input-Output-System liefert durch die Aufkommens- und Verwendungstabellen eine tiefer gegliederte Beschreibung des Produktionsprozesses (Kostenstruktur, entstandenes Einkommen und Beschäftigung) und der Waren- und Dienstleistungsströme (Produktionswert, Import, Export, Konsum, Vorleistungen und Investitionen nach Gütergruppen). Dabei kommen zwei wichtige im Gesamtrechnungssystem geltende Identitätsbeziehungen zum Ausdruck: Die Summe der in einem Wirtschaftsbereich entstandenen Einkommen ist gleich der in diesem Wirtschaftsbereich erwirtschafteten Wertschöpfung, und für alle Güter oder Gütergruppen ist das Angebot gleich der Nachfrage. |
|
1.09 |
Das ESVG 2010 umfasst ferner Konzepte für die Darstellung der Bevölkerung und der Erwerbstätigkeit. Diese Konzepte sind sowohl für die Sektorkonten, die Konten nach Wirtschaftsbereichen als auch für das Aufkommens-und-Verwendungssystem von Bedeutung. |
|
1.10 |
Das ESVG 2010 gilt auch für vierteljährliche und kürzere oder längere Zeiträume betreffende Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Es gilt auch für regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. |
|
1.11 |
Das ESVG 2010 existiert neben dem SNA 2008 aufgrund der Verwendungszwecke der Kennzahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in der EU. Die Mitgliedstaaten sind für die Aufstellung und Darstellung ihrer eigenen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zur Beschreibung der wirtschaftlichen Lage ihrer Länder verantwortlich. Die Mitgliedstaaten erstellen zudem einen Kontensatz, welcher der Kommission (Eurostat) als Teil eines regelmäßigen Datenlieferprogramms für zentrale Verwendungszwecke im Rahmen der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik der Union übermittelt wird. Zu diesen Verwendungszwecken gehören die Festlegung der finanziellen Beiträge der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt durch die „vierte Einnahmequelle“, Beihilfen für EU-Regionen durch das Strukturfondsprogramm und die Überwachung der Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit und des Stabilität- und Wachstumspakts. |
|
1.12 |
Damit die Verteilung der Abgaben und Leistungen auf Aggregaten beruht, die auf völlig übereinstimmende Weise erstellt und dargestellt werden, müssen die für diese Zwecke herangezogenen Wirtschaftsstatistiken daher nach denselben Konzepten und Regeln erstellt werden. Das ESVG 2010 ist eine Verordnung zur Festlegung der Regeln, Vereinbarungen, Definitionen und Klassifikationen, die bei der Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in den Mitgliedstaaten anzuwenden sind, aus denen die zu übermittelnden Ergebnisse gemäß Lieferprogramm, die in Anhang B dieser Verordnung dargelegt werden, hervorgehen. |
|
1.13 |
In Anbetracht der sehr großen Finanzbeträge, um die es bei dem Beitrags- und Leistungssystem in der EU geht, kommt es darauf an, dass das Messsystem in jedem Mitgliedstaat einheitlich angewendet wird. Unter diesen Umständen ist es von Bedeutung, einen vorsichtigen Ansatz bei der Schätzung von Positionen, die nicht direkt am Markt beobachtet werden können, einzunehmen und die Verwendung von modellbasierten Schätzverfahren von Aggregaten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu vermeiden. |
|
1.14 |
Die Konzepte des ESVG 2010 sind in einigen Fällen spezifischer und genauer als die des SNA 2008, um die größtmögliche Konsistenz zwischen den Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten sicherzustellen. Dieser vorrangige Bedarf an robusten, konsistenten Schätzungen hat zur Ermittlung eines Kernsatzes Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen in der EU geführt. In den Fällen, in denen das Maß an Kohärenz der Messung zwischen den Mitgliedstaaten unzureichend ist, sind derartige Schätzungen im Allgemeinen in „Nicht-Kernsystemen“ enthalten, die zusätzliche Tabellen und Satellitenkonten umfassen. |
|
1.15 |
Ein Beispiel, bei dem im ESVG 2010 eine gewisse Vorsicht für angebracht gehalten wurde, betrifft die Verbindlichkeiten von Alterssicherungssystemen. Es gibt zwar gute Gründe, diese zur Unterstützung der Wirtschaftsanalysen zu messen; die wesentliche Anforderung in der EU, Gesamtrechnungen zu erstellen, die zeitlich und räumlich kohärent sind, erfordert jedoch eine gewisse Zurückhaltung. |
Globalisierung
|
1.16 |
Der zunehmend globale Charakter der Wirtschaftstätigkeit hat zu einer Ausweitung des internationalen Handels in all seinen Formen geführt und die Herausforderungen für die Länder vergrößert, ihre heimische Wirtschaft im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu erfassen. Die Globalisierung ist der dynamische und multidimensionale Prozess, bei dem nationale Ressourcen international mobiler werden, während die Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften zunimmt. Das Merkmal der Globalisierung, das potenziell die meisten Messprobleme für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit sich bringt, ist der zunehmende Anteil internationaler Transaktionen durch multinationale Unternehmen, bei denen die grenzüberschreitenden Transaktionen zwischen Mutterunternehmen, Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen erfolgen. Es gibt jedoch noch weitere Herausforderungen und eine umfassendere Liste von datenbezogenen Aspekte sieht wie folgt aus:
|
|
1.17 |
All diese immer üblicher werdenden Aspekte der Globalisierung lassen die Erfassung und genaue Messung von grenzüberschreitenden Strömen zu einer wachsenden Herausforderung für die nationalen Statistiker werden. Auch mit einem umfassenden und robusten Erfassungs- und Messsystem für die Positionen im Sektor der übrigen Welt (und somit auch in den in der Zahlungsbilanz enthaltenen internationalen Konten) wird durch die Globalisierung die Erforderlichkeit zusätzlicher Anstrengungen zur Wahrung der Qualität der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für alle Volkswirtschaften und Zusammenschlüsse von Volkswirtschaften steigen. |
VERWENDUNGSZWECKE DES ESVG 2010
Instrument für Analyse und Politik
|
1.18 |
Die nach dem ESVG berechneten Ergebnisse dienen verschiedenen Analysen und Bewertungen wie
|
|
1.19 |
Für die EU und ihre Mitgliedstaaten spielen die nach den ESVG-Konzepten berechneten Daten bei der Festlegung und Überwachung der Wirtschafts- und Sozialpolitik eine wichtige Rolle. Die folgenden Beispiele machen die Verwendungszwecke des ESVG deutlich:
|
Merkmale der ESVG-2010-Konzepte
|
1.20 |
Um die Datenanforderungen und die Möglichkeiten der Datenbereitstellung in Einklang zu bringen, weisen die im ESVG 2010 verwendeten Konzepte mehrere wichtige Merkmale auf. Aufgrund dieser Merkmale sind die Konten
|
|
1.21 |
Die Konzepte des ESVG 2010 sind international vergleichbar:
|
|
1.22 |
Die ESVG-2010-Konzepte sind auf die Konzepte anderer Wirtschafts- und Sozialstatistiken abgestimmt, da das ESVG 2010 Konzepte und Klassifikationen (z. B. die Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 (2)) verwendet, die für andere Wirtschafts- und Sozialstatistiken, wie die Statistiken über die Produktion, den Außenhandel und die Erwerbstätigkeit der Mitgliedstaaten, gelten; konzeptionelle Unterschiede wurden auf ein Minimum begrenzt. Ferner sind die ESVG-2010-Konzepte und -Klassifikationen auf die der Vereinten Nationen abgestimmt. Durch diese Harmonisierung mit Wirtschafts- und Sozialstatistiken werden die Verknüpfung und der Vergleich der Ergebnisse aus den verschiedenen Quellen erleichtert, so dass die Qualität der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sichergestellt werden kann. Außerdem können die Angaben aus diesen speziellen Statistiken besser mit den allgemeinen Statistiken über die Volkswirtschaft verglichen werden. |
|
1.23 |
Die gemeinsamen Konzepte, die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und den anderen Wirtschafts- und Sozialstatistiken durchgängig herangezogen werden, ermöglichen die Ableitung konsistenter Kennzahlen, wie
Die interne Konsistenz der Konzepte erlaubt die Bildung von Saldogrößen, wie dem Sparen als Differenz zwischen dem verfügbaren Einkommen und dem Konsum. |
|
1.24 |
Die Konzepte des ESVG 2010 werden unter Berücksichtigung der Datenerfassung und der Messung angewandt. Der operationelle Charakter wird bei den Orientierungshilfen zur Erstellung der Konten auf verschiedene Weise deutlich:
|
|
1.25 |
Jedoch ist es unter Umständen nicht einfach, die für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungsstatistiken benötigten Daten direkt zu erheben, da die ihnen zugrundeliegenden Konzepte von den Konzepten administrativer Datenquellen abweichen. Beispiele für administrative Daten sind Angaben aus der betrieblichen Buchführung oder über bestimmte Steuern (Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, Importabgaben usw.), Sozialversicherungsdaten und Angaben von Aufsichtsorganen des Banken- und Versicherungswesens. Diese administrativen Daten werden zur Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen herangezogen. Zu diesem Zweck werden solche Daten im Allgemeinen adaptiert, damit sie den Konzepten des ESVG entsprechen. Die ESVG-Konzepte unterscheiden sich in der Regel von den entsprechenden administrativen Konzepten, denn die administrativen Konzepte
|
|
1.26 |
Dennoch werden administrative Datenquellen den Anforderungen sowohl der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als auch anderer Statistiken durchaus gerecht, denn
|
|
1.27 |
Die wichtigsten Konzepte des ESVG haben sich bewährt und bleiben längere Zeit gültig, denn
Diese konzeptionelle Kontinuität verringert die Erforderlichkeit, Zeitreihen neu zu berechnen. Ferner sind die Konzepte so gegenüber nationalem und internationalem politischen Druck weniger anfällig. Daher dienen die Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Wirtschaftspolitik und -analyse als objektive Grundlage. |
|
1.28 |
Die ESVG-2010-Konzepte dienen primär der Beschreibung des Wirtschaftskreislaufs in monetären tatsächlich beobachtbaren Kategorien. Strom- und Bestandsgrößen, die nicht in monetären Kategorien erfassbar sind oder zu denen es keinen eindeutigen monetären Gegenposten gibt, werden daher im ESVG nicht erfasst. Dieser Grundsatz wurde nicht durchgehend befolgt, da auch dem Erfordernis der Konsistenz und dem Nutzerbedarf Rechnung zu tragen ist. Die Konsistenz verlangt z. B., dass die vom Staat erbrachten kollektiven Dienstleistungen als Produktionswert erfasst werden, zumal die Zahlung von Arbeitnehmerentgelten und der Kauf von Waren und Dienstleistungen des Staates unschwer in monetären Kategorien erfasst werden können. Ferner steigt für Zwecke der Wirtschaftspolitik und -analyse die Verwendbarkeit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Ganzes, wenn die vom Staat erbrachten kollektiven Dienstleistungen in ihrer Beziehung zur übrigen Volkswirtschaft dargestellt werden. |
|
1.29 |
Zur Veranschaulichung des Konzeptrahmens des ESVG seien einige bedeutsame Grenzfälle aufgeführt. Im Rahmen des Produktionskonzepts des ESVG (siehe Nummern 3.07 bis 3.09) wird Folgendes ausgewiesen:
|
|
1.30 |
Folgendes fällt nicht unter das Produktionskonzept und wird nicht im ESVG ausgewiesen:
|
|
1.31 |
Im ESVG wird jedweder Produktionswert erfasst, der das Ergebnis einer unter das Produktionskonzept des ESVG fallenden Produktionstätigkeit ist. Für Hilfstätigkeiten wird jedoch kein Produktionswert ausgewiesen. Alle für eine Hilfstätigkeit erforderlichen Inputs werden als Inputs der Tätigkeit behandelt, der die Hilfstätigkeit dient. Falls ein Betrieb, der nur Hilfstätigkeiten durchführt, insofern statistisch beobachtbar ist, als eine gesonderte Betriebsführung für seine Produktion tatsächlich zur Verfügung steht, oder falls er sich geografisch an einem anderen Standort befindet als die Betriebe, für die er tätig ist, muss er in den nationalen und regionalen Gesamtrechnungen als eine gesonderte Einheit erfasst und dem Wirtschaftsbereich zugeordnet werden, dem seine Haupttätigkeit entspricht. Sofern keine geeigneten Basisdaten zur Verfügung stehen, kann der Produktionswert der Hilfstätigkeit durch Summierung der Kosten geschätzt werden. |
|
1.32 |
Falls eine Tätigkeit der Produktion zugerechnet und ihr Produktionswert erfasst wird, so werden das entstandene Einkommen, die Beschäftigung, der Konsum der produzierten Güter usw. ebenfalls erfasst. Da z. B. die Produktion von Dienstleistungen aus eigengenutzten Wohnungen als Produktion gebucht wird, werden das hierdurch für die betreffenden Wohnungseigentümer entstehende Einkommen und die entsprechenden Konsumausgaben ebenfalls gebucht. Da die Nutzung eigener Wohnungen definitionsgemäß ohne Arbeitseinsatz geschieht, wird keine Erwerbstätigkeit erfasst. Damit wird die Übereinstimmung mit dem System der Arbeitsstatistik gewahrt, bei der keine Erwerbstätigkeit für Wohneigentum erfasst wird. Das Umgekehrte gilt, wenn eine Tätigkeit nicht als Produktion erfasst wird. Durch häusliche Dienste, die im selben Haushalt erbracht und verbraucht werden, entstehen weder Einkommen noch Konsum, und es liegt in diesem Fall auch keine Erwerbstätigkeit vor. |
|
1.33 |
Im ESVG werden ferner Vereinbarungen getroffen, wie
|
Sektorengliederung
|
1.34 |
Sektorkonten werden durch Zuordnung von Einheiten zu Sektoren erstellt, was die Darstellung von Transaktionen und Kontensalden der Gesamtrechnungen nach Sektor ermöglicht. Durch die Darstellung nach Sektor werden viele zentrale Größen für wirtschafts- und finanzpolitische Zwecke deutlich. Die wichtigsten Sektoren sind private Haushalte, Staat, Kapitalgesellschaften (finanzielle und nichtfinanzielle), private Organisationen ohne Erwerbszweck und übrige Welt. Die Unterscheidung zwischen marktbestimmten und nichtmarktbestimmten Tätigkeiten ist wichtig. Eine Einheit unter der Kontrolle des Staates, die als marktbestimmte Kapitalgesellschaft eingestuft wird, wird dem Sektor Kapitalgesellschaften zugeordnet und nicht dem Sektor Staat zugeordnet. Somit werden das Defizit und die Schulden der Kapitalgesellschaft nicht dem Defizit und Schuldenstand des Staates zugerechnet. |
|
1.35 |
Es ist wichtig, klare und robuste Kriterien für die Zuordnung von Einheiten zu Sektoren festzulegen. Zum öffentlichen Sektor gehören alle in der Volkswirtschaft ansässigen institutionellen Einheiten, die vom Staat kontrolliert werden. Zum privaten Sektor gehören alle übrigen gebietsansässigen Einheiten. In Tabelle 1.1 werden die Kriterien für die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Sektor dargestellt sowie im öffentlichen Sektor für die Unterscheidung zwischen dem Sektor Staat und dem Sektor öffentliche Kapitalgesellschaften und im privaten Sektor zwischen dem Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck und dem Sektor private Kapitalgesellschaften. Tabelle 1.1
|
|
1.36 |
Kontrolle wird definiert als die Fähigkeit, die allgemeine Politik oder das allgemeine Programm einer institutionellen Einheit zu bestimmen. Die Nummern 2.35 bis 2.39 enthalten weitere Einzelheiten zur Definition der Kontrolle. |
|
1.37 |
Für die Unterscheidung zwischen Markt und Nichtmarkt und die Zuordnung von Einheiten des öffentlichen Sektors zum Sektor Staat oder zum Sektor Kapitalgesellschaften ist folgende Regel maßgeblich: Eine Tätigkeit gilt als marktbestimmte Tätigkeit, wenn die entsprechenden Waren und Dienstleistungen unter den folgenden Bedingungen gehandelt werden, d. h. sofern
|
|
1.38 |
Der Detaillierungsgrad der ESVG-Konzepte ermöglicht Flexibilität: Bestimmte Konzepte werden im ESVG nicht ausdrücklich erwähnt, können jedoch leicht abgeleitet werden. So können durch Neugruppierungen der im ESVG definierten Teilsektoren neue Sektoren geschaffen werden. |
|
1.39 |
Flexibilität liegt auch durch die mögliche Einbringung zusätzlicher Kriterien vor, sofern sie der Logik des Gesamtsystems nicht widersprechen. Durch ein solches Kriterium können z. B. Konten für Teilsektoren erstellt werden, wie bei Produzenten die Beschäftigtenzahl und bei privaten Haushalten die Einkommenshöhe. Die Erwerbstätigen könnten nach dem Bildungsniveau, Alter und Geschlecht untergliedert werden. |
Satellitenkonten
|
1.40 |
Auf einigen Gebieten sollten zur Deckung des Datenbedarfs separate Satellitensysteme erstellt werden. Beispiele hierfür sind:
|
|
1.41 |
Dieser Datenbedarf wird durch Satellitensysteme gedeckt, die
|
|
1.42 |
Eine Sozialrechnungsmatrix (Social Accounting Matrix, SAM) verdeutlicht die Verbindung zwischen den Aufkommens- und Verwendungstabellen und den Sektorkonten. Eine Sozialrechnungsmatrix liefert durch eine Aufgliederung des Arbeitnehmerentgelts nach Gruppen von Beschäftigten zusätzliche Informationen über Umfang und Zusammensetzung der Beschäftigung. Die erwähnte Aufgliederung betrifft sowohl den aus den Verwendungstabellen ableitbaren Arbeitseinsatz nach Wirtschaftsbereichen als auch das Arbeitsangebot nach Haushaltsgruppen innerhalb des Sektors private Haushalte. Auf diese Weise werden das Angebot an und der Einsatz von verschiedenen Kategorien von Arbeitskräften systematisch dargestellt. |
|
1.43 |
Bei Satellitensystemen werden alle grundlegenden Konzepte und Klassifikationen des zentralen Gesamtrechnungssystems des ESVG 2010 beibehalten. Die Konzepte werden nur dann geändert, wenn dies der Zweck des Satellitensystems ist. Das Satellitensystem zeigt aber auch, wie die wichtigsten Gesamtgrößen des Satellitensystems mit denen des zentralen Systems zusammenhängen. Auf diese Weise bleibt das zentrale System weiterhin der Bezugsrahmen, während gleichzeitig einem spezielleren Datenbedarf Rechnung getragen wird. |
|
1.44 |
Im Allgemeinen werden Angaben für Strom- und Bestandsgrößen, die nur schwierig in monetären Kategorien erfassbar sind (oder zu denen es nicht eindeutig einen monetären Gegenposten gibt), im zentralen System nicht berücksichtigt. Ihrem Wesen nach lassen sich derartige Größen meist besser in nichtmonetären Kategorien statistisch erfassen, wie folgende Beispiele zeigen:
|
|
1.45 |
Über Satellitensysteme kann eine Verbindung zwischen derartigen Statistiken in nichtmonetären Größen und dem zentralen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen hergestellt werden, wenn bei den nichtmonetären Statistiken die Klassifikationen des zentralen Systems (etwa die Klassifikation der Haushaltsgruppen oder der Wirtschaftsbereiche) verwendet werden. Auf diese Weise wird ein konsistentes erweitertes System entwickelt, das dann die Datengrundlage für die Untersuchung und Bewertung von Interdependenzen zwischen den Variablen des zentralen Systems und denen der Satellitensysteme liefern kann. |
|
1.46 |
Veränderungen der wirtschaftlichen Wohlfahrt werden durch das zentrale System und seine wichtigsten Gesamtgrößen nicht beschrieben. Zu diesem Zweck können erweiterte Konten erstellt werden, in denen zum Beispiel auch die unterstellten monetären Werte folgender Sachverhalte erfasst werden:
|
|
1.47 |
Ferner können in diesen erweiterten Konten die defensiven Ausgaben (regrettable necessities) für Verteidigung u. ä. den Vorleistungen, also den nicht wohlfahrtserhöhenden Ausgaben zugerechnet werden. Ebenso können die durch Naturkatastrophen verursachten Schäden als Vorleistungsverbrauch, der das Wohlfahrtsniveau mindert, ausgewiesen werden. Auf diese Weise könnte versucht werden, einen sehr groben und noch unvollkommenen Indikator der Wohlfahrtsveränderungen zu erstellen. Die wirtschaftliche Wohlfahrt hat jedoch viele Dimensionen, von denen die meisten nicht am besten in monetären Kategorien dargestellt werden sollten. Für die Zwecke der Wohlfahrtsmessung ist es daher besser, wenn für jede dieser Dimensionen eigene Indikatoren und Maßeinheiten verwendet werden. Geeignete Indikatoren wären z. B. Säuglingssterblichkeit, Lebenserwartung, Analphabetenquote oder Nationaleinkommen je Einwohner. Sie könnten in ein Satellitensystem aufgenommen werden. |
|
1.48 |
Im Interesse eines konsistenten, international kompatiblen Systems wurden in das ESVG keine administrativen Konzepte aufgenommen. Für verschiedene nationale Verwendungszwecke können Daten, die auf administrativen Konzepten basieren, jedoch sehr nützlich sein. Zur Schätzung des Steueraufkommens sind z. B. Angaben über das steuerpflichtige Einkommen erforderlich. Diese Angaben können aus den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit Hilfe bestimmter Modifikationen abgeleitet werden. |
|
1.49 |
Bei den Konzepten der nationalen Wirtschaftspolitik könnte ähnlich verfahren werden, wie in folgenden Fällen:
Satellitensysteme oder Zusatztabellen können diesem Datenbedarf gerecht werden. |
ESVG 2010 und SNA 2008
|
1.50 |
Das ESVG 2010 beruht auf den Konzepten des SNA 2008, in dem für sämtliche Länder der Welt Leitlinien für die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen festgelegt sind. Dennoch bestehen zwischen dem ESVG 2010 und dem SNA 2008 gewisse Unterschiede:
|
ESVG 2010 und ESVG 95
|
1.51 |
Das ESVG 2010 unterscheidet sich vom ESVG 95 sowohl hinsichtlich der dargestellten Sachverhalte als auch bezüglich einzelner Konzepte. Dies ergibt sich überwiegend aus den Unterschieden zwischen dem SNA 1993 und dem SNA 2008. Die Hauptunterschiede sind:
|
|
1.52 |
Die Unterschiede im ESVG 2010 im Vergleich zum ESVG 95 beschränken sich nicht auf konzeptionelle Änderungen. Es gibt große Unterschiede hinsichtlich der dargestellten Sachverhalte, wobei neue Kapitel über Satellitenkonten, die Konten des Staates und die Konten der übrigen Welt aufgenommen wurden. Zudem wurden die Kapitel über die vierteljährlichen Gesamtrechnungen und die regionalen Gesamtrechnungen erheblich erweitert. |
GRUNDSÄTZE DES ESVG 2010 ALS SYSTEM
|
1.53 |
Die wichtigsten Grundzüge des Systems betreffen:
|
Einheiten und ihre Zusammenfassungen
|
1.54 |
Im ESVG 2010 werden zwei Arten statistischer Einheiten und entsprechend zwei Untergliederungsarten verwendet, die sich deutlich voneinander unterscheiden und unterschiedlichen Analysezielen dienen. |
|
1.55 |
Der erste Zweck der Darstellung der Einkommen und ihrer Verwendung, der finanziellen Ströme und der Vermögensbilanzen wird erfüllt, indem institutionelle Einheiten anhand ihrer grundlegenden Funktionen, Verhaltensmerkmale und Ziele zu Sektoren zusammengefasst werden. |
|
1.56 |
Der zweite Zweck der Darstellung der Produktionsvorgänge und des Input-Output-Systems wird erfüllt, indem örtliche fachliche Einheiten (örtliche FE) anhand ihrer Haupttätigkeit zu Wirtschaftsbereichen zusammengefasst werden. Diese Einheiten werden durch ihren Gütereinsatz, den Produktionsprozess und die Art der produzierten Güter bestimmt. |
Institutionelle Einheiten und Sektoren
|
1.57 |
Institutionelle Einheiten sind wirtschaftliche Einheiten, die Eigentümer von Waren und Vermögenswerten sein können und eigenständig Verbindlichkeiten eingehen, wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und Transaktionen mit anderen Einheiten vornehmen können. Im ESVG 2010 sind die institutionellen Einheiten zu den fünf inländischen institutionellen Sektoren zusammengefasst:
Die fünf Sektoren bilden zusammen die inländische Volkswirtschaft. Jeder Sektor ist in Teilsektoren untergliedert. Das ESVG 2010 ermöglicht es, dass für jeden Sektor (und Teilsektor) sowie für die Volkswirtschaft ein vollständiger Satz von Transaktionskonten und Vermögensbilanzen erstellt wird. Gebietsfremde Einheiten können mit diesen fünf inländischen Sektoren in Beziehung treten, wobei diese Interaktionen zwischen den fünf inländischen Sektoren und einem sechsten institutionellen Sektor ausgewiesen werden: dem Sektor übrige Welt. |
Örtliche FE
|
1.58 |
Üben institutionellen Einheiten mehrere Tätigkeiten aus, so werden diese Einheiten nach der Art der Tätigkeit aufgeteilt. Örtliche FE machen diese Darstellung möglich. Eine örtliche FE umfasst als Produzent sämtliche Teile einer institutionellen Einheit, die an einem Standort oder an mehreren nahe beieinander liegenden Standorten zu einer Produktionstätigkeit entsprechend der vierstelligen Ebene (Klasse) der Klassifikation der Wirtschaftsbereiche NACE Rev. 2 beitragen. |
|
1.59 |
Für jede Nebentätigkeit werden örtliche FE erfasst. Wenn jedoch die Rechnungslegungsunterlagen, die für die gesonderte Beschreibung jeder dieser Nebentätigkeiten erforderlich wären, nicht vorliegen, werden im Rahmen einer örtlichen FE mehrere Nebentätigkeiten verknüpft. Die Gesamtheit der örtlichen FE, die dieselben oder vergleichbare Produktionstätigkeiten ausüben, bildet einen Wirtschaftsbereich. Eine institutionelle Einheit umfasst eine oder mehrere örtliche FE. Eine örtliche FE gehört jeweils zu nur einer institutionellen Einheit. |
|
1.60 |
Für Untersuchungen der Produktionsprozesse wird eine analytische Produktionseinheit eingeführt. Diese Einheit kann nur beobachtet werden, wenn es sich um eine örtliche FE handelt, die eine Güterart produziert und keine Nebentätigkeiten durchführt. Diese Einheit wird als homogene Produktionseinheit bezeichnet. Die homogenen Produktionseinheiten werden zu homogenen Produktionsbereichen zusammengefasst. |
Gebietsansässige und gebietsfremde Einheiten sowie Volkswirtschaft und übrige Welt
|
1.61 |
Die Volkswirtschaft besteht aus gebietsansässigen Einheiten. Eine Einheit ist eine gebietsansässige Einheit eines Landes, wenn ein Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Hauptinteresses im Wirtschaftsgebiet des betreffenden Landes liegt, d. h., wenn sie während eines längeren Zeitraums (ein Jahr oder länger) wirtschaftliche Tätigkeiten in diesem Gebiet ausübt. Die unter Nummer 1.57 genannten institutionellen Sektoren sind Gruppen von gebietsansässigen institutionellen Einheiten. |
|
1.62 |
Gebietsansässige Einheiten führen Transaktionen mit gebietsfremden Einheiten durch (d. h. mit Einheiten, die gebietsansässige Einheiten anderer Volkswirtschaften sind). Diese Transaktionen werden als Transaktionen der Volkswirtschaft mit der übrigen Welt bezeichnet und im Konto der übrigen Welt nachgewiesen. Die übrige Welt spielt daher eine ähnliche Rolle wie die institutionellen Sektoren. Allerdings werden gebietsfremde Einheiten nur dann einbezogen, wenn sie Transaktionen mit gebietsansässigen institutionellen Einheiten vornehmen. |
|
1.63 |
Als fiktive gebietsansässige Einheiten, die im ESVG 2010 wie institutionelle Einheiten behandelt werden, gelten:
|
Strom- und Bestandsgrößen
|
1.64 |
Es werden sowohl Stromgrößen wie auch Bestandsgrößen erfasst. Während Stromgrößen Vorgänge und Auswirkungen von Ereignissen betreffen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinden, geben Bestandsgrößen die Situation zu einem Zeitpunkt wieder. |
Stromgrößen
|
1.65 |
Stromgrößen beschreiben das Entstehen, die Umwandlung, den Austausch, die Übertragung oder den Verzehr wirtschaftlicher Werte. Sie ändern die Aktiva oder Passiva einer institutionellen Einheit. Es werden zwei Arten wirtschaftlicher Stromgrößen unterschieden, nämlich Transaktionen und sonstige Vermögensänderungen. Transaktionen werden außer im Konto für die sonstigen realen Vermögensänderungen und im Umbewertungskonto in allen Konten und Tabellen nachgewiesen, die Stromgrößen enthalten. Sonstige Veränderungen der Aktiva und Passiva werden lediglich im Konto für die sonstigen realen Vermögensänderungen und im Umbewertungskonto dargestellt. Einzeltransaktionen und sonstige Stromgrößen werden nach ihrer Art zu einer relativ geringen Zahl von Gruppen zusammengefasst. |
Transaktionsarten
|
1.66 |
Eine Transaktion ist eine wirtschaftliche Stromgröße, bei der es sich entweder um eine einvernehmlich erfolgende Interaktion zwischen institutionellen Einheiten oder um einen Vorgang innerhalb einer institutionellen Einheit handelt, der sinnvollerweise als Transaktion behandelt wird, da die Einheit in zwei verschiedenen Eigenschaften agiert. Es lassen sich vier Hauptgruppen von Transaktionen unterscheiden:
|
Merkmale der Transaktionen
Interaktionen und Transaktionen innerhalb von Einheiten
|
1.67 |
Die meisten Transaktionen sind Interaktionen zwischen zwei oder mehr institutionellen Einheiten. Im ESVG 2010 werden jedoch auch bestimmte Vorgänge innerhalb von institutionellen Einheiten den Transaktionen zugeordnet. Der Ausweis dieser Transaktionen innerhalb von Einheiten dient einer aussagekräftigeren Beschreibung der Produktion, der letzten Verwendung und der Kosten. |
|
1.68 |
Abschreibungen werden im ESVG 2010 den Kosten zugerechnet und sind eine Transaktion innerhalb von Einheiten. Die meisten anderen Transaktionen innerhalb von Einheiten betreffen Gütertransaktionen, die insbesondere dann auszuweisen sind, wenn institutionelle Einheiten als Produzenten und Endverbraucher von ihnen produzierte Güter konsumieren. Dies gilt oft für private Haushalte und den Staat. |
|
1.69 |
Der Output, der in die letzte Verwendung derselben institutionellen Einheit eingeht, wird vollständig im Produktionswert erfasst. Dagegen wird der Output, der als Vorleistung derselben institutionellen Einheit verbraucht wird, nur dann einbezogen, wenn die Produktion und der Vorleistungsverbrauch in unterschiedlichen örtlichen FE der institutionellen Einheit stattfinden. Der Output, der in derselben örtlichen FE produziert und als Vorleistung verbraucht wird, wird nicht erfasst. |
Monetäre und nichtmonetäre Transaktionen
|
1.70 |
Transaktionen sind monetäre Transaktionen, wenn die beteiligten Einheiten Zahlungen vornehmen oder erhalten, Verbindlichkeiten eingehen oder Vermögenswerte erhalten, die auf Währungseinheiten lauten. Transaktionen, bei denen kein Tausch von Bargeld oder auf Währungseinheiten lautender Forderungen oder Verbindlichkeiten stattfindet, sind nichtmonetäre Transaktionen. Bei den Transaktionen innerhalb von Einheiten handelt es sich um nichtmonetäre Transaktionen. Nichtmonetäre Transaktionen zwischen institutionellen Einheiten kommen bei Gütertransaktionen (Gütertausch), Verteilungstransaktionen (Sachbezüge, Sachleistungen usw.) und sonstigen Transaktionen (Tausch von nichtproduziertem Sachvermögen) vor. Im ESVG 2010 werden sämtliche Transaktionen in Geldeinheiten ausgewiesen. Die Werte nichtmonetärer Transaktionen müssen daher indirekt erfasst oder in anderer Weise geschätzt werden. |
Transaktionen mit und ohne Gegenleistung
|
1.71 |
Bei Transaktionen, an denen mehr als eine Einheit beteiligt ist, unterscheidet man zwei Arten: entgeltliche (jemand bekommt etwas für eine Gegenleistung) und unentgeltliche (jemand bekommt etwas ohne Gegenleistung). Bei entgeltlichen Transaktionen handelt es sich um Tauschgeschäfte zwischen institutionellen Einheiten, d. h., Waren, Dienstleistungen oder Vermögenswerte werden für eine Gegenleistung, etwa Geld, bereitgestellt. Bei unentgeltlichen Transaktionen werden Sach- oder Geldleistungen von einer institutionellen Einheit für eine andere ohne Gegenleistung erbracht. Entgeltliche Transaktionen kommen bei allen vier Arten von Transaktionen vor, während es sich bei unentgeltlichen Transaktionen überwiegend um Verteilungstransaktionen handelt, wie beispielsweise Steuern, Leistungen der Sozialhilfe oder Schenkungen. Diese unentgeltlichen Transaktionen werden als Transfers bezeichnet. |
Abgewandelte Transaktionen
|
1.72 |
Die Transaktionen werden so gebucht, wie sie von den beteiligten institutionellen Einheiten wahrgenommen werden. Einige Transaktionen werden jedoch so abgewandelt, dass die ihnen zugrunde liegenden wirtschaftlichen Beziehungen deutlicher erkennbar sind. Die Abwandlung von Transaktionen kann auf drei Arten erfolgen: durch Umleitung (rerouting), Aufteilung oder Betonung des Haupttransaktionspartners. |
Umleitung
|
1.73 |
Eine Transaktion, die tatsächlich zwischen den Einheiten A und C stattfindet, ist u. U. so in den Konten zu buchen, als ob eine dritte Einheit B zwischengeschaltet wäre. Die einzelne Transaktion zwischen A und C wird somit zweifach gebucht, nämlich als Transaktion zwischen A und B und als Transaktion zwischen B und C. Die Transaktion wird hier also umgeleitet. |
|
1.74 |
Ein Beispiel für eine Umleitung ist die Art und Weise der Buchung der Arbeitgeber-Sozialbeiträge, die direkt an Systeme der sozialen Sicherung abgeführt werden, in den VGR-Konten. Im ESVG werden diese Zahlungen in der Form von zwei Transaktionen gebucht, nämlich erstens zahlen die Arbeitgeber die Arbeitgeberbeiträge an ihre Arbeitnehmer und zweitens führen die Arbeitnehmer dieselben Beiträge an die Systeme der sozialen Sicherung ab. Wie stets bei umgeleiteten Transaktionen soll die zugrunde liegende wirtschaftliche Realität verdeutlicht werden. In diesem Fall soll gezeigt werden, dass die Arbeitgeberbeiträge zugunsten der Arbeitnehmer gezahlt werden. |
|
1.75 |
Eine andere Art der Umleitung liegt vor, wenn Transaktionen zwischen zwei oder mehr institutionellen Einheiten gebucht werden, obwohl aus Sicht der Transaktionspartner überhaupt keine Transaktion stattfindet. Ein Beispiel hierfür ist die Behandlung des bei bestimmten Versicherungen anfallenden Vermögenseinkommens, das von Versicherungsgesellschaften einbehalten wird. Im ESVG wird es so ausgewiesen, als ob es von den Versicherungsgesellschaften an die Versicherungsnehmer gezahlt würde und als ob diese dann den gleichen Betrag in Form von zusätzlichen Prämien an die Versicherungsgesellschaften zurückzahlen würden. |
Aufteilung
|
1.76 |
Wird eine Transaktion, die von den Transaktionspartnern als eine einzige Transaktion wahrgenommen wird, als zwei oder mehr Transaktionen gebucht, die unterschiedlichen Kategorien zuzuordnen sind, spricht man von einer aufgeteilten Transaktion. Aufteilung bedeutet nicht, dass zusätzliche Einheiten als Transaktionspartner eingeführt werden. |
|
1.77 |
Die Buchung von Prämien der Nichtlebensversicherung ist ein typisches Beispiel für die Aufteilung einer Transaktion. Obwohl die Versicherungsnehmer und die Versicherer derartige Prämienzahlungen als eine einzige Transaktion wahrnehmen, werden sie im ESVG 2010 in zwei völlig verschiedene Transaktionen aufgeteilt, nämlich erstens in die Gegenleistung für empfangene Versicherungsdienstleistungen und zweitens in die Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen. Ein weiteres Beispiel für die Aufteilung einer Transaktion ist die Buchung des Verkaufs eines Produkts als den Verkauf eines Produkts und als den Verkauf einer Handelsspanne. |
Betonung des Haupttransaktionspartners
|
1.78 |
Wird eine Transaktion im Namen einer anderen Einheit (des Haupttransaktionspartners) vorgenommen und von dieser finanziert, wird sie ausschließlich in den Konten des Haupttransaktionspartners gebucht. Grundsätzlich sollte nicht über dieses Prinzip hinausgegangen werden und z. B. versucht werden, unter Verwendung von Annahmen Steuern oder Subventionen den letztendlichen Zahlern oder Empfängern zuzuordnen. Ein Beispiel ist die Erhebung von Steuern durch eine staatliche Einheit im Namen einer anderen. Eine Steuer wird der staatlichen Einheit zugeordnet, die die Amtsgewalt ausübt, die Steuer zu erheben (entweder als Auftraggeber oder durch delegierte Befugnis durch den Auftraggeber), und Entscheidungsfreiheit hat, den Steuersatz zu setzen und zu variieren. |
Grenzfälle
|
1.79 |
Eine Interaktion zwischen institutionellen Einheiten ist definitionsgemäß nur dann eine Transaktion, wenn sie einvernehmlich stattfindet, d. h., wenn sie mit Wissen und Zustimmung der beteiligten institutionellen Einheiten erfolgt. Die Zahlung von Steuern, Geldstrafen und gebührenpflichtigen Verwarnungen erfolgt einvernehmlich, da der Zahlende ein den Gesetzen des Landes unterliegender Bürger ist. Bei der entschädigungslosen Enteignung handelt es sich allerdings, auch wenn sie gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht um eine Transaktion. Illegale wirtschaftliche Vorgänge gelten als Transaktionen, wenn alle beteiligten Einheiten einvernehmlich an ihnen teilnehmen. Beim illegalen Kauf, Verkauf oder Tausch von Drogen oder Diebesgut handelt es sich daher um Transaktionen, bei Diebstahl dagegen nicht. |
Sonstige Vermögensänderungen
|
1.80 |
Sonstige Vermögensänderungen gehen nicht auf Transaktionen zurück. Sie umfassen
|
Sonstige reale Vermögensänderungen
|
1.81 |
Sonstige reale Vermögensänderungen umfassen drei Hauptkategorien:
|
|
1.82 |
In die Kategorie unter Nummer 1.81 Buchstabe a fallen die Erschließungen und der Abbau von Bodenschätzen oder das natürliche Wachstum von nichtkultivierten biologischen Ressourcen, also von freien Tier- und Pflanzenbeständen. Beispiele für die Kategorie unter Nummer 1.81 Buchstabe b sind Verluste von Aktiva aufgrund von Naturkatastrophen, Krieg oder schweren Verbrechen sowie einseitige Schuldenaufhebung oder entschädigungslose Enteignung von Aktiva. Ein Beispiel für die Kategorie unter Nummer 1.81 Buchstabe c ist die Änderung der Sektorzuordnung institutioneller Einheiten. |
Umbewertungsgewinne/-verluste
|
1.83 |
Umbewertungsgewinne/-verluste entstehen durch Veränderungen der Preise der Aktiva bzw. Passiva. Sie können sämtliche Arten von Sachvermögen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen. Die Vermögenseigentümer, Gläubiger und Schuldner erzielen die Umbewertungsgewinne/-verluste innerhalb einer Periode, ohne die Aktiva oder Passiva in irgendeiner Weise verändert zu haben. |
|
1.84 |
Umbewertungsgewinne/-verluste, die sich aus der Veränderung der Marktpreise der Aktiva und Passiva ergeben, werden als nominelle Umbewertungsgewinne/-verluste bezeichnet. Diese können aufgeteilt werden in neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste, die die Wertänderung durch die allgemeine Preisänderung messen, und in reale Umbewertungsgewinne/-verluste, die sich aus der Veränderung der Preise der Aktiva und Passiva ergeben, die über die allgemeine Preisänderung hinausgeht. |
Bestandsgrößen
|
1.85 |
Bestandsgrößen beziehen sich auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Bestände an Aktiva und Passiva. Sie werden am Anfang und am Ende jedes Rechnungszeitraums in den als Vermögensbilanzen bezeichneten Konten ausgewiesen. |
|
1.86 |
Darüber hinaus werden Bestandsgrößen über die Bevölkerung und Erwerbstätigen erfasst. Sie werden allerdings als Durchschnittswerte des Rechnungszeitraums ausgewiesen. Zu den Bestandsgrößen zählen alle unter die Konzepte des ESVG fallenden Aktiva bzw. Passiva, also Forderungen und Verbindlichkeiten sowie produzierte und nichtproduzierte Vermögensgüter. Allerdings werden nur die Aktiva berücksichtigt, die wirtschaftlich verwendet werden und an denen Eigentumsrechte bestehen können. |
|
1.87 |
Aktiva, wie Humanvermögen und diejenigen natürlichen Ressourcen, an denen keine Eigentumsrechte bestehen, werden daher nicht einbezogen. Innerhalb der Produktionsgrenzen des ESVG 2010 werden sämtliche Strom- und Bestandsgrößen erfasst. Daraus ergibt sich, dass sämtliche Veränderungen von Bestandsgrößen vollständig durch die gebuchten Stromgrößen erklärt werden können. |
Das Kontensystem und die Aggregate
Buchungsregeln
|
1.88 |
In einem Konto werden die Veränderungen des Wertes erfasst, die sich für eine Einheit oder einen Sektor je nach der Art der im Konto ausgewiesenen Wirtschaftsströme ergeben. Ein Konto ist eine Tabelle mit zwei Spalten. In den Konten für die laufenden Transaktionen werden die Produktion, die Entstehung, Verteilung und Umverteilung von Einkommen sowie die Verwendung des Einkommens dargestellt. Bei den Vermögensänderungskonten handelt es sich um das Vermögensbildungskonto, das Finanzierungskonto und das Konto sonstiger realer Vermögensänderungen. |
Bezeichnung der beiden Kontenseiten
|
1.89 |
Im ESVG 2010 wird das „Aufkommen“ auf der rechten Seite der Konten für die laufenden Transaktionen erfasst. Hier werden die Transaktionen gebucht, die für eine Einheit oder einen Sektor zu einer Wertzunahme führen. Auf der linken Kontenseite wird die „Verwendung“ ausgewiesen, d. h. Transaktionen, die einen Werteabfluss bewirken. Die rechte Seite der Vermögensänderungskonten weist die „Veränderung der Passiva“ aus, die linke Seite die „Veränderung der Aktiva“. In den Vermögensbilanzen werden auf der rechten Seite die Verbindlichkeiten und das Reinvermögen (Letzteres bildet die Differenz zwischen den Aktiva und den Verbindlichkeiten) ausgewiesen und auf der linken Seite die Aktiva. Ein Vergleich zweier aufeinanderfolgender Vermögensbilanzen zeigt die Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens sowie der Aktiva innerhalb einer Periode. |
|
1.90 |
Im ESVG wird zwischen rechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum unterschieden. Als Kriterium für die Erfassung der Übertragung von Gütern von einer Einheit an eine andere wird der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums von einer Einheit an die andere herangezogen. Der rechtliche Eigentümer ist die Einheit, die nach dem Gesetz Anspruch auf die Nutzung hat. Der rechtliche Eigentümer kann jedoch mit einer anderen Einheit vertraglich vereinbaren, dass die zuletzt genannte Einheit gegen eine vereinbarte Zahlung die Risiken trägt und ihr die Vorteile zustehen, die sich aus der Nutzung der Güter bei der Produktion ergeben. Bei der Vereinbarung handelt es sich um ein Finanzierungsleasing, wobei durch die Zahlung nur zum Ausdruck kommt, dass der Leasinggeber dem Leasingnehmer den Vermögenswert zur Verfügung stellt. Ist eine Bank beispielsweise rechtliche Eigentümerin eines Flugzeugs, geht mit einer Fluggesellschaft aber eine Finanzierungsleasingvereinbarung zum Betrieb des Flugzeugs ein, dann gilt die Fluggesellschaft als Eigentümerin des Flugzeugs, was die Transaktionen in den Konten betrifft. Gleichzeitig mit der Ausweisung eines Kaufs des Flugzeugs durch die Fluggesellschaft wird ein Kredit von der Bank an die Fluggesellschaft unterstellt, in dem die in Zukunft fälligen Beträge für die Nutzung des Flugzeugs zum Ausdruck kommen. |
Doppelbuchung/Vierfachbuchung
|
1.91 |
Bezogen auf einzelne Einheiten oder Sektoren basieren die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf dem Prinzip der doppelten Buchführung, d. h., jede Transaktion wird zweimal gebucht, einmal auf der Aufkommensseite (oder unter „Veränderung der Passiva“) und einmal auf der Verwendungsseite (oder unter „Veränderung der Aktiva“). Da die Summe der auf der Aufkommensseite oder der Seite „Veränderung der Passiva“ verbuchten Transaktionen gleich der Summe der auf der Verwendungsseite oder der Seite „Veränderung der Aktiva“ ausgewiesenen Transaktionen sein muss, kann die Konsistenz der Konten untereinander überprüft werden. |
|
1.92 |
Betrachtet man die Gesamtheit der Einheiten und Sektoren, so gilt für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen das Prinzip der vierfachen Buchung, da an den meisten Transaktionen zwei institutionelle Einheiten beteiligt sind und jede dieser Transaktionen bei den beteiligten Transaktionspartnern zweimal gebucht wird. So wird z. B. eine vom Staat an einen privaten Haushalt gezahlte soziale Geldleistung in den Konten des Staates auf der Verwendungsseite unter den Transfers und als Minderung der Aktiva unter Bargeld und Einlagen gebucht, während sie in den Konten des Sektors Private Haushalte auf der Aufkommensseite unter den Transfers und als Zunahme von Aktiva unter Bargeld und Einlagen ausgewiesen wird. |
|
1.93 |
Für Transaktionen, die innerhalb einer Einheit stattfinden (etwa der Verbrauch von selbstproduzierten Waren und Dienstleistungen) sind lediglich zwei Buchungen vorzunehmen, deren Werte geschätzt werden müssen. |
Bewertung
|
1.94 |
Abgesehen von einigen Angaben über die Bevölkerung und Erwerbstätigkeit werden im ESVG 2010 alle Strom- und Bestandsgrößen in monetären Maßeinheiten ausgewiesen. Die Angaben zu den Strom- und Bestandsgrößen basieren auf ihrem Tauschwert, d. h. dem Wert, zu dem sie effektiv gegen Bargeld eingetauscht werden bzw. eingetauscht werden könnten. Im ESVG erfolgt die Bewertung daher anhand von Marktpreisen. |
|
1.95 |
Im Fall von monetären Transaktionen und von monetären Forderungen und Verbindlichkeiten liegen die benötigten Werte unmittelbar vor. In den meisten anderen Fällen sollten zur Bewertung die Marktpreise vergleichbarer Waren, Dienstleistungen oder Vermögenswerte herangezogen werden. Dies gilt beispielsweise für den Tauschhandel und für Dienstleistungen aus eigengenutzten Wohnungen. Liegen keine Marktpreise vergleichbarer Güter vor, wie etwa bei nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des Staates, so werden zur Bewertung die Produktionskosten summiert. Kann kein Marktpreis herangezogen werden und liegen keine Angaben über die Kosten vor, können die Strom- und Bestandsgrößen anhand des Gegenwertes der erwarteten künftigen Erträge bewertet werden. Dieses Verfahren ist jedoch nur als letzte Möglichkeit anzuwenden. |
|
1.96 |
Bestandsgrößen werden zu den am Bilanzstichtag geltenden jeweiligen Preisen bewertet und nicht zu den Preisen, die zum Zeitpunkt der Produktion oder des Erwerbs der Waren bzw. Vermögenswerte galten, aus denen sich die Bestände zusammensetzen. Bestandsgrößen sind mit den jeweiligen Wiederbeschaffungspreisen oder den Produktionskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen zu bewerten. |
Besondere Regeln für die Bewertung von Gütern
|
1.97 |
Wegen der Transportkosten, Handelsspannen und Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen stellt sich der Wert eines bestimmten Gutes für den Produzenten und den Endverwender häufig unterschiedlich dar. Damit die Sichtweise der Transaktionspartner weitgehend gewahrt bleibt, wird im ESVG 2010 die Verwendung von Gütern grundsätzlich zu Käuferpreisen (Anschaffungspreisen) bewertet, die Transportkosten, Handelsspannen und Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen einschließen, während die Produktion von Gütern zu Herstellungspreisen ausgewiesen wird, in die die genannten Elemente nicht eingehen. |
|
1.98 |
Importe und Exporte von Waren werden mit ihren Grenzübergangswerten dargestellt, und zwar mit den fob-Werten, also den Werten an der Ausfuhrgrenze. Dabei gehen von gebietsfremden Einheiten erbrachte Versicherungs- und Transportleistungen zwischen der Export- und der inländischen Importgrenze nicht in den Wert der Waren ein, sondern in die Dienstleistungsimporte. In tiefer Untergliederung nach Gütergruppen, die auf den Angaben der Außenhandelsstatistik beruht, muss der Import dagegen mit den Werten an der Importgrenze, also zu cif-Werten, dargestellt werden. Sie schließen alle Versicherungs- und Transportdienstleistungen bis zur Importgrenze ein. Soweit diese Versicherungs- und Transportleistungen auf Einfuhren von Inländern erbracht werden, wird eine fob/cif-Korrektur eingeführt. |
Bewertung zu konstanten Preisen
|
1.99 |
Bewertung zu konstanten Preisen heißt, dass die Stromgrößen einer Periode zu Preisen einer früheren Periode bzw. die Bestandsgrößen eines Zeitpunkts zu Preisen eines früheren Zeitpunkts bewertet werden. Auf diese Weise sollen die im Zeitablauf aufgetretenen Veränderungen der Werte der Strom- und Bestandsgrößen in Preis- und in Volumenänderungen aufgegliedert werden. Strom- und Bestandsgrößen in konstanten Preisen werden preisbereinigt dargestellt. |
|
1.100 |
Viele Strom- und Bestandsgrößen, wie z. B. das Einkommen, haben keine eigentliche Preis- und Mengendimension. Die Kaufkraft dieser Variablen lässt sich jedoch ermitteln, indem die jeweiligen Werte mit einem allgemeinen Preisindex, wie beispielsweise dem Preisindex der letzten inländischen Verwendung ohne die Vorratsveränderung, deflationiert werden. Deflationierte Strom- und Bestandsgrößen werden auch als Realwerte bezeichnet. Ein Beispiel hierfür ist das reale verfügbare Einkommen. |
Buchungszeitpunkt
|
1.101 |
Stromgrößen werden nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung (accrual basis) gebucht, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem ein wirtschaftlicher Wert geschaffen, umgewandelt oder aufgelöst wird bzw. zu dem Forderungen oder Verbindlichkeiten entstehen, umgewandelt oder aufgehoben werden. |
|
1.102 |
Das Produktionsergebnis wird nicht gebucht, wenn der Käufer es bezahlt, sondern wenn es produziert wird. Der Verkauf eines Vermögensgegenstandes wird zu dem Zeitpunkt ausgewiesen, zu dem das Eigentum wechselt, und nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem die entsprechende Zahlung erfolgt. Zinsen werden in der Periode gebucht, in der sie auflaufen, unabhängig davon, ob sie in dieser Periode gezahlt werden. Der Grundsatz der periodengerechten Buchung gilt für alle Stromgrößen, d. h. für monetäre ebenso wie für nichtmonetäre Transaktionen, für Transaktionen innerhalb derselben Einheit ebenso wie für Transaktionen zwischen Einheiten. |
|
1.103 |
Es kann erforderlich sein, diesen Ansatz für Steuern und andere Transaktionen des Staates zu lockern, die in der öffentlichen Rechnungslegung meist zum Zeitpunkt der Zahlung gebucht werden. Es ist unter Umständen schwierig, exakt vom Zahlungs- auf den Entstehungszeitpunkt überzugehen, weshalb ein Näherungsverfahren angewandt werden kann. |
|
1.104 |
Als Ausnahme von den allgemeinen Regeln zur Buchung von an den Staat zu zahlenden Steuern und Sozialbeiträgen können diese entweder ohne die Beträge gebucht werden, deren Einziehung unwahrscheinlich ist, oder einschließlich dieser Beträge; im letztgenannten Fall werden diese Beträge in demselben Rechnungszeitraum durch die Buchung eines Vermögenstransfers des Staates an die betreffenden Sektoren neutralisiert. |
|
1.105 |
Transaktionen werden von allen an ihnen beteiligten institutionellen Einheiten und in allen Konten zum gleichen Zeitpunkt gebucht. Nicht für alle institutionellen Einheiten gelten dieselben Buchungsregeln, und selbst wenn dies der Fall ist, kann es in den tatsächlichen Meldungen zu Unterschieden kommen, etwa wegen verspäteter Mitteilungen. Transaktionen werden daher von den beteiligten Transaktionspartnern u. U. zu unterschiedlichen Zeitpunkten gebucht. Derartige Diskrepanzen werden durch Korrekturen beseitigt. |
Konsolidierung und Saldierung
Konsolidierung
|
1.106 |
Konsolidierung bedeutet, dass Transaktionen zwischen Einheiten, die derselben Gruppe von Einheiten angehören, sowohl auf der Aufkommens- als auch auf der Verwendungsseite ebenso wie wechselseitige Forderungen und Verbindlichkeiten eliminiert werden. Dies geschieht im Allgemeinen, wenn die Konten von Teilsektoren des Sektors Staat verknüpft werden. |
|
1.107 |
Generell dürfen Ströme und Bestände zwischen den Einheiten eines Sektors oder Teilsektors nicht konsolidiert werden. |
|
1.108 |
Für ergänzende Darstellungen und Analysen können jedoch auch konsolidierte Konten aufgestellt werden. Solche Transaktionen zwischen den (Teil)Sektoren und anderen Sektoren sowie die dazugehörige finanzielle Position gegenüber anderen Sektoren sind u. U. von größerem Interesse als unkonsolidierte Daten. |
|
1.109 |
Ferner geben die Konten und Tabellen, aus denen die Gläubiger-Schuldner-Beziehungen ersichtlich sind, einen detaillierten Einblick in die Finanzierung der Volkswirtschaft und ermöglichen es, das Zustandekommen von Finanzierungssalden bei den Kreditgebern und den Kreditnehmern nachzuvollziehen. |
Saldierung
|
1.110 |
Bei einzelnen Einheiten oder Sektoren können gleiche Transaktionen als Einnahmen und als Ausgaben vorkommen (beispielsweise werden Zinsen gezahlt und empfangen) oder es kann die gleiche Art von Forderungen und Verbindlichkeiten vorhanden sein. Das ESVG verfolgt, abgesehen von den ausdrücklich vorgesehenen Saldierungen, den Ansatz des unsaldierten Bruttoausweises. |
|
1.111 |
Bei bestimmten Transaktionsarten sind Saldierungen der Normalfall. Ein typisches Beispiel sind die Vorratsveränderungen, deren Wirkung auf die Gesamtinvestitionen wichtiger ist als die Beobachtung der täglichen Zu- und Abgänge. Ebenso wird, abgesehen von wenigen Ausnahmen, im Finanzierungskonto und in den Konten für die sonstigen Vermögensänderungen die Nettozunahme der Aktiva und Passiva ausgewiesen, wodurch die sich am Ende der Periode letztlich ergebenden Auswirkungen der entsprechenden Ströme erkennbar werden. |
Konten, Kontensalden und Aggregate
|
1.112 |
Für die Einheiten oder Gruppen von Einheiten werden die Transaktionen, die einen bestimmten Aspekt des Wirtschaftsgeschehens (z. B. die Produktion) betreffen, in verschiedenen Konten gebucht. Im Produktionskonto gleichen sich die auf der Aufkommensseite und der Verwendungsseite ausgewiesenen Transaktionen nicht ohne Saldo aus. Ein Saldo (das Reinvermögen) ist auch zum Ausgleich des Gesamtbetrags der Aktiva und der Passiva einer institutionellen Einheit oder eines institutionellen Sektors erforderlich. Die Kontensalden als solche sind aussagekräftige Maßgrößen der wirtschaftlichen Ergebnisse. Wenn sie für die Gesamtwirtschaft berechnet werden, sind sie Aggregate von großer Bedeutung. |
Die Kontenabfolge
|
1.113 |
Der Kern des ESVG 2010 ist eine Folge von miteinander verbundenen Konten. Das vollständige Kontensystem für die institutionellen Einheiten und Sektoren besteht aus Konten für die laufenden Transaktionen, Vermögensänderungskonten und Vermögensbilanzen. |
|
1.114 |
In den Konten für die laufenden Transaktionen werden die Produktion, die Entstehung, Verteilung und Umverteilung von Einkommen sowie die Verwendung des Einkommens für den Konsum und das Sparen dargestellt. In den Vermögensänderungskonten werden die Veränderungen der Aktiva, der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens (der Differenz zwischen den Aktiva und den Verbindlichkeiten einer institutionellen Einheit oder einer Gruppe von Einheiten) nachgewiesen. In den Vermögensbilanzen werden die Bestände an Aktiva, Verbindlichkeiten und das Reinvermögen dargestellt. |
|
1.115 |
Das Kontensystem für örtliche FE umfasst nur die ersten beiden Konten, nämlich das Produktionskonto und das Einkommensentstehungskonto, mit dem Betriebsüberschuss als Saldo. |
Das Güterkonto
|
1.116 |
Das Güterkonto zeigt für die Gesamtwirtschaft oder für Gütergruppen das Aufkommen (Produktion und Import) und die Verwendung von Waren und Dienstleistungen (Vorleistungen, Konsum, Vorratsveränderungen, Bruttoanlageinvestitionen, Nettozugang an Wertgegenständen sowie Exporte). Dieses Konto ist kein Konto im Sinne der übrigen Konten in der Abfolge und führt zu keinem Saldo, der auf das nächste Konto in der Abfolge übertragen wird. Es ist vielmehr die Darstellung einer Identitätsbeziehung in Tabellenform, die zeigt, dass das Aufkommen gleich der Verwendung für alle Güter und Gütergruppen in der Volkswirtschaft ist. |
Die Konten der übrigen Welt
|
1.117 |
In den Konten der übrigen Welt werden Transaktionen zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden institutionellen Einheiten und die entsprechenden Bestände an Aktiva und Passiva dargestellt. Da die übrige Welt innerhalb des Kontensystems eine ähnliche Rolle spielt wie ein institutioneller Sektor, werden die Konten der übrigen Welt aus der Sicht der übrigen Welt erstellt. Was in den Konten der übrigen Welt auf der Aufkommensseite gebucht wird, erscheint auf der Verwendungsseite der Konten der Volkswirtschaft und umgekehrt. Ein positiver Saldo bedeutet für die übrige Welt einen Überschuss und für die Volkswirtschaft ein Defizit. Im Fall eines negativen Saldos ist es umgekehrt. Die Konten der übrigen Welt unterscheiden sich von den anderen Sektorkonten insofern, als sie nicht alle buchungsmäßigen Transaktionen in der übrigen Welt ausweisen, sondern nur solche, von denen eine Gegenbuchung in der heimischen Wirtschaft gemessen wird. |
Kontensalden
|
1.118 |
Einen Saldo erhält man, indem man den Gesamtwert der Positionen auf der einen Kontenseite vom Gesamtwert der Positionen auf der anderen Kontenseite abzieht. Salden sind sehr aussagekräftig und stellen einige der wichtigsten Positionen des ESVG dar, wie etwa die Wertschöpfung, den Betriebsüberschuss, das verfügbare Einkommen, das Sparen oder den Finanzierungssaldo. In der folgenden Abbildung wird die Kontenabfolge als Flussdiagramm dargestellt; jeder Kontensaldo erscheint fett gedruckt. Eine Abbildung der Kontenabfolge
|
|
1.119 |
Das erste Konto in der Abfolge ist das Produktionskonto, in dem der Produktionswert und die Vorleistungen des Produktionsprozesses erfasst werden, wodurch sich die Wertschöpfung als Kontensaldo ergibt. |
|
1.120 |
Die Wertschöpfung wird in das nächste Konto übertragen, das Einkommensentstehungskonto. Hier werden das Arbeitnehmerentgelt im Produktionsprozess und die aufgrund der Produktion an den Staat zu zahlenden Steuern erfasst, so dass der Betriebsüberschuss (bzw. das Selbständigeneinkommen des Sektors private Haushalte) als Kontensaldo für jeden Sektor abgeleitet werden kann. Dieser Schritt ist erforderlich, damit der Betrag der Wertschöpfung, der im Produktionssektor als Betriebsüberschuss oder Selbständigeneinkommen anfällt, gemessen werden kann. |
|
1.121 |
Anschließend wird die nach Arbeitnehmerentgelt, Steuern und Betriebsüberschuss/Selbständigeneinkommen untergliederte Wertschöpfung in dieser Untergliederung in das primäre Einkommensverteilungskonto übertragen. Die Untergliederung ermöglicht die Zuordnung jedes Faktoreinkommens zum Empfängersektor im Gegensatz zum Produktionssektor. Beispielsweise wird das gesamte Arbeitnehmerentgelt zwischen dem Sektor private Haushalte und dem Sektor übrige Welt aufgeteilt, während der Betriebüberschuss im Sektor Kapitalgesellschaften verbleibt, in dem er erzeugt wurde. In diesem Konto werden ferner die Vermögenseinkommensströme in den und aus dem Sektor erfasst, so dass der Kontensaldo das in den Sektor strömende Primäreinkommen ist. |
|
1.122 |
Im nächsten Konto, dem Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept), wird die Verteilung dieser Einkommen durch Transfers erfasst. Die Hauptinstrumente der Verteilung sind die Besteuerung des Sektors private Haushalte und Sozialleistungen für diesen Sektor. Der Saldo dieses Kontos ist das verfügbare Einkommen (Ausgabenkonzept). |
|
1.123 |
Die Hauptabfolge der Kernkonten führt weiter zum Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept); dieses Konto ist für den Sektor private Haushalte von Bedeutung, da in ihm die Konsumausgaben der privaten Haushalte erfasst werden. Der Saldo des Einkommensverwendungskontos (Ausgabenkonzept) ist das Sparen der privaten Haushalte. |
|
1.124 |
Gleichzeitig wird ein paralleles Konto geschaffen, das Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept). Dieses Konto dient dem besonderen Zweck, soziale Sachleistungen als unterstellte Transfers vom Sektor Staat an den Sektor private Haushalte auszuweisen, so dass das Einkommen der privaten Haushalte um den Wert der einzelnen staatlichen Leistungen ansteigen kann. Im nächsten Konto, dem Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept), steigt die Verwendung des verfügbaren Einkommens durch die privaten Haushalte um denselben Betrag, als ob der Sektor private Haushalte die einzelnen staatlichen Leistungen kaufen würde. Diese beiden Unterstellungen heben sich gegenseitig auf, so dass der Saldo des Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) das mit dem in der Hauptkontenabfolge identische Sparen ist. |
|
1.125 |
Das Sparen wird in das Vermögensbildungskonto übertragen, wo es zur Finanzierung von Investitionen verwendet wird, was Vermögenstransfers in die und aus den Sektoren ermöglicht. Durch zu wenig oder zu viel ausgegebene Mittel beim Erwerb von realen Vermögensgütern ergibt sich der Finanzierungssaldo. Ein positiver Finanzierungssaldo ist ein Finanzierungsüberschuss und ein negativer Finanzierungssaldo ist ein Finanzierungsdefizit. |
|
1.126 |
Schließlich werden in den Finanzierungskonten die genauen Forderungen und Verbindlichkeiten jedes einzelnen Sektors erfasst, so dass sich ein Finanzierungssaldo ergibt. Dieser sollte genau dem Finanzierungssaldo im Vermögensbildungskonto entsprechen; bei einer etwaigen Differenz muss es sich um eine Diskrepanz bei der Messung zwischen der tatsächlichen und finanziellen Erfassung der Wirtschaftstätigkeit handeln. |
|
1.127 |
In der unteren Zeile der Abbildung handelt es sich bei dem Konto auf der linken Seite um die Vermögenseröffnungsbilanz, in der alle realen und finanziellen Aktiva und Passiva zu Beginn eines bestimmten Zeitraums ausgewiesen werden. Das Vermögen einer Volkswirtschaft wird anhand ihres Reinvermögens (Aktiva abzüglich Passiva) gemessen, das unten in der Bilanz angegeben wird. |
|
1.128 |
Von der Eröffnungsbilanz aus gesehen werden von links nach rechts die verschiedenen Veränderungen der Aktiva und Passiva ausgewiesen, die im Bilanzierungszeitraum eintreten. Im Vermögensbildungskonto und im Finanzierungskonto werden die Veränderungen gebucht, die auf Transaktionen mit realen Vermögenswerten bzw. Forderungen und Verbindlichkeiten zurückzuführen sind. Gäbe es keine anderen Auswirkungen, so könnte man durch Addition der Veränderungen gegenüber der Position zu Beginn des Bilanzierungszeitraums unmittelbar die Position am Ende des Bilanzierungszeitraums berechnen. |
|
1.129 |
Es kann jedoch außerhalb des Wirtschaftskreislaufs der Produktion und des Konsums zu Veränderungen kommen, und diese Veränderungen werden den Wert der Aktiva und Passiva am Ende des Bilanzierungszeitraums beeinflussen. Eine Art von Änderung ist eine reale Vermögensänderung, d. h. reale Änderungen von Anlagen durch Ereignisse, die nicht Teil der Wirtschaft sind. Ein Beispiel wäre ein Katastrophenschaden, z. B. durch ein großes Erdbeben, bei dem eine erhebliche Menge von Vermögensgütern zerstört würden, ohne dass ein wirtschaftlicher Austausch oder Transfer stattfindet. Dieser Schaden muss im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen erfasst werden, denn die Aktiva fallen geringer aus, als bei rein wirtschaftlicher Betrachtung erwartet worden wäre. Eine zweite Möglichkeit, wie Aktiva (und Passiva) ihren Wert ändern können, ohne dass eine wirtschaftliche Transaktion vorliegt, besteht in einer Preisänderung, die zu Umbewertungsgewinnen/-verlusten des Bestandes an Aktiva führt. Diese Änderung wird im Umbewertungskonto verbucht. Die Berücksichtigung dieser beiden zusätzlichen Auswirkungen auf die Werte des Bestands an Aktiva und Passiva ermöglicht es, die Werte der Vermögensschlussbilanz so zu schätzen, dass die Position zu Beginn des Bilanzierungszeitraums um die Änderungen in den Stromgrößenkonten in der unteren Zeile der Abbildung bereinigt wird. |
Volkswirtschaftliche Aggregate
|
1.130 |
Die volkswirtschaftlichen Aggregate zeigen das Ergebnis der Wirtschaftsaktivitäten der Volkswirtschaft, wie etwa Produktion, Wertschöpfung, verfügbares Einkommen, Konsum, Sparen, Investitionen usw. Obwohl die Bildung von Aggregaten nicht das einzige Ziel des ESVG ist, sind sie wichtige Gesamtindikatoren für makroökonomische Analysen sowie für zeit- und wirtschaftsraumbezogene Vergleiche. |
|
1.131 |
Es werden zwei Arten von Aggregaten unterschieden:
|
|
1.132 |
Weiteren wichtigen Verwendungszwecken dienen Pro-Kopf-Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, wie das BIP, das Nationaleinkommen oder der Konsum der privaten Haushalte, die häufig auf die Bevölkerung bezogen werden. Wenn die Konten oder ein Teil der Konten der privaten Haushalte auch für Teilsektoren aufgestellt werden, werden Angaben über die Anzahl der Haushalte und der Personen in den einzelnen Teilsektoren herangezogen. |
Das BIP: ein zentrales volkswirtschaftliches Aggregat
|
1.133 |
Das BIP ist eines der zentralen volkswirtschaftlichen Aggregate im ESVG. Das BIP ist ein Maß für die gesamte Wirtschaftstätigkeit in einem Wirtschaftsgebiet, die dazu führt, dass die Produktion die Endnachfrage der Volkswirtschaft befriedigt. Es gibt drei Möglichkeiten der Messung des BIP zu Marktpreisen:
|
|
1.134 |
Diese drei Ansätze zur Messung des BIP spiegeln auch die verschiedenen Möglichkeiten wider, wie das BIP im Hinblick auf seine Komponenten betrachtet werden kann. Die Wertschöpfung kann nach institutionellen Sektoren untergliedert werden und nach der Art der Tätigkeit oder des Wirtschaftsbereichs, die zum Gesamtwert beitragen, z. B. Landwirtschaft, produzierendes Gewerbe, Baugewerbe, Dienstleistungen usw. Die letzte Verwendung kann nach ihrer Art untergliedert werden: Verwendung der privaten Haushalte, letzte Verwendung der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, letzte Verwendung des Staates, Vorratsveränderung, Anlageinvestitionen und Exporte vermindert um den Wert der Importe. Die Gesamteinkommen können nach Art des Einkommens untergliedert werden, d. h. Arbeitnehmerentgelt und Betriebsüberschuss. |
|
1.135 |
Um die beste Schätzung des BIP zu erzielen, ist es bewährte Praxis, die Elemente dieser drei Rechnungen in eine Gegenüberstellung von Aufkommen und Verwendung einzugeben. Dadurch können Wertschöpfungs- und Einkommensschätzungen nach Wirtschaftsbereich abgeglichen und Angebot und Nachfrage nach Gütern abgestimmt werden. Dieser integrierte Ansatz stellt die Konsistenz zwischen den Komponenten des BIP sicher und gewährleistet eine bessere Schätzung des BIP, als dies anhand nur eines einzelnen Ansatzes der Fall wäre. Durch Abzug der Abschreibungen vom BIP ergibt sich das Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (NIP). |
Das Input-Output-System
|
1.136 |
Das Input-Output-System (I-O-System) verknüpft Komponenten der Bruttowertschöpfung (BWS), die von den Wirtschaftsbereichen eingesetzten und produzierten Güter, das Produktangebot und die Produktnachfrage und die Zusammensetzung des Aufkommens und der Verwendung in den institutionellen Sektoren der Volkswirtschaft. Dieses System untergliedert die Volkswirtschaft zur Darstellung der Transaktionen mit allen Waren und Dienstleistungen zwischen Wirtschaftsbereichen und Endverbrauchern für einen einzigen Zeitraum (z. B. ein Vierteljahr oder ein Jahr). Die Angaben können in zwei Formen dargestellt werden:
|
Aufkommens- und Verwendungstabellen
|
1.137 |
Aufkommens- und Verwendungstabellen bilden die Volkswirtschaft nach Wirtschaftsbereichen (z. B. Kraftfahrzeugindustrie) und Produkten (z. B. Sportprodukte) ab. Die Tabellen geben Aufschluss über die Verbindungen zwischen Komponenten der BWS, den von den Wirtschaftsbereichen eingesetzten und produzierten Gütern, dem Produktangebot und der Produktnachfrage. Aufkommens- und Verwendungstabellen verbinden verschiedene institutionelle Sektoren der Volkswirtschaft (wie öffentliche Kapitalgesellschaften) und geben Aufschluss über Importe und Exporte von Waren und Dienstleistungen, die Ausgaben des Staates, der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und die Investitionen. |
|
1.138 |
Die Erstellung von Aufkommens- und Verwendungstabellen ermöglicht es, die Konsistenz und Kohärenz der Komponenten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen innerhalb eines einzigen detaillierten Systems zu prüfen und durch Einbeziehung der Komponenten der drei Ansätze zur Messung des BIP (d. h. Entstehung, Verwendung und Verteilung) zu einer einzigen Schätzung des BIP zu gelangen. |
|
1.139 |
Wenn sie integriert aufeinander abgestimmt werden, führen die Aufkommens- und Verwendungstabellen ferner zu Kohärenz und Konsistenz durch Verknüpfung der Komponenten der drei nachfolgenden Konten:
|
Symmetrische Input-Output-Tabellen
|
1.140 |
Symmetrische Input-Output-Tabellen werden von den Daten in den Aufkommens- und Verwendungstabellen und zusätzlichen Quellen abgeleitet, um die theoretische Grundlage für anschließende Analysen zu bilden. |
|
1.141 |
Diese Tabellen enthalten symmetrische Tabellen (für jedes einzelne Gut oder für jeden einzelnen Wirtschaftsbereich), die Leontief-Inverse und andere diagnostische Analysen wie Produktionsmultiplikatoren. Sie weisen den Konsum von im Inland produzierten und importierten Waren und Dienstleistungen getrennt aus und schaffen einen theoretischen Rahmen für die weitere strukturelle Analyse der Volkswirtschaft, einschließlich der Zusammensetzung sowie der Auswirkungen von Änderungen der Endnachfrage auf die Volkswirtschaft. |
(1) Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 310, 30.11.1996, S. 1).
(2) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 193, 30.12.2006, S. 1).
(3) Verordnung (EG) Nr. 451/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Schaffung einer neuen statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (CPA) (ABl. L 145, 4.6.2008, S. 65).
KAPITEL 2
EINHEITEN UND IHRE ZUSAMMENFASSUNGEN
|
2.01 |
Die Volkswirtschaft eines Landes ist ein System, in dem Institutionen und Menschen Waren, Dienstleistungen und Zahlungsmittel (z. B. Geld) austauschen und übertragen, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren und zu konsumieren. In der Volkswirtschaft sind die miteinander verkehrenden Einheiten wirtschaftliche Einheiten, die Eigentümer von Vermögenswerten sein, Verbindlichkeiten eingehen, wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und Transaktionen mit anderen Einheiten vornehmen können. Sie werden als institutionelle Einheiten bezeichnet. Die Definition der in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen herangezogenen Einheiten dient mehreren Zwecken. Erstens bilden diese Einheiten die wesentlichen Bestandteile für die Abgrenzung von Volkswirtschaften in geografischer Hinsicht, z. B. Staaten, Regionen und Staatengruppen wie Währungsunionen oder politische Unionen. Zweitens sind sie die wichtigsten Bausteine für die Zusammenfassung zu institutionellen Sektoren. Drittens sind sie entscheidend für die Festlegung, welche Strom- und Bestandsgrößen erfasst werden. Transaktionen zwischen verschiedenen Teilen derselben institutionellen Einheit werden im Prinzip in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht erfasst. |
|
2.02 |
Die statistischen Einheiten werden so definiert und zusammengefasst, dass sie den Anforderungen der wirtschaftlichen Analyse am besten entsprechen, und können daher von Einheiten in den Basisstatistiken abweichen. Die Einheiten in den Basisstatistiken (z. B. Unternehmen, Holdinggesellschaften, fachliche oder örtliche Einheiten, öffentliche Körperschaften, gemeinnützige Institutionen, private Haushalte usw.) entsprechen rechtlichen, verwaltungsmäßigen oder buchhalterischen Kriterien und genügen damit möglicherweise nicht den Anforderungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Definitionen der Darstellungseinheiten im ESVG 2010 sind bei der Weiterentwicklung der Basisstatistiken zu beachten, so dass in diesen Erhebungen nach und nach alle Bestandteile erfasst werden, die zur Berechnung der Angaben für die Darstellungseinheiten des ESVG 2010 benötigt werden. |
|
2.03 |
Das ESVG 2010 verwendet solche Arten von Darstellungseinheiten, die der Untergliederung der Volkswirtschaft nach drei Gesichtspunkten entsprechen:
Um das erste dieser drei Ziele zu erreichen, werden die institutionellen Einheiten definiert. Für die unter Punkt 1 genannten Verhaltensmuster sind Einheiten erforderlich, die die Gesamtheit ihrer institutionellen Wirtschaftstätigkeit widerspiegeln. Für die unter den Punkten 2 und 3 genannten Produktionsprozesse, ökonomisch-technischen Zusammenhänge und regionalen Analysen werden Einheiten wie örtliche FE benötigt. Sie werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschrieben. Bevor die Einheiten des ESVG 2010 definiert werden, ist die Abgrenzung der Volkswirtschaft eines Landes als Ganzes erforderlich. |
ABGRENZUNG DER VOLKSWIRTSCHAFT
|
2.04 |
Die Einheiten, die die Volkswirtschaft eines Landes ausmachen und deren Strom- und Bestandsgrößen das ESVG 2010 erfasst, sind die gebietsansässigen Einheiten. Eine institutionelle Einheiten ist in demjenigen Land gebietsansässig, in dessen Wirtschaftsgebiet sie ihren Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses hat. Diese Einheiten werden unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer Rechtsform und ihrer Anwesenheit im Wirtschaftsgebiet zum Zeitpunkt der Durchführung einer Transaktion als gebietsansässig bezeichnet. |
|
2.05 |
Zum Wirtschaftsgebiet gehören:
Fischereifahrzeuge, sonstige Schiffe, schwimmende Bohrinseln und Luftfahrzeuge werden im ESVG wie bewegliche Ausrüstungen behandelt, die gebietsansässigen Einheiten gehören und/oder von ihnen betrieben werden bzw. die Gebietsfremden gehören, aber von gebietsansässigen Einheiten betrieben werden. Die Transaktionen im Zusammenhang mit dem Eigentum (Bruttoanlageinvestitionen) und dem Betrieb beweglicher Ausrüstungen (Vermietung, Versicherung usw.) werden der Volkswirtschaft des Landes zugerechnet, in dem der Eigentümer bzw. der Betreiber gebietsansässig ist. Im Falle des Finanzierungsleasings wird ein Eigentümerwechsel unterstellt. Das Wirtschaftsgebiet kann ein geografisch größeres oder kleineres Gebiet als das oben definierte sein. Ein Beispiel für ein größeres Gebiet ist eine Währungsunion wie die Europäische Währungsunion; ein Beispiel für ein kleineres Gebiet ist ein Teil eines Landes, z. B. eine Region. |
|
2.06 |
Nicht zum Wirtschaftsgebiet eines Landes zählen exterritoriale Enklaven. Ausgeschlossen sind ebenfalls die Teile des geografischen Gebietes eines Landes, die von den nachstehenden Organisationen genutzt werden:
Die von den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union und von internationalen Organisationen genutzten Gebiete bilden eigenständige Wirtschaftsgebiete. Ein Merkmal solcher Gebiete ist, dass die einzigen Gebietsansässigen die Institutionen sind. |
|
2.07 |
Der Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses liegt innerhalb des Wirtschaftsgebietes eines Landes an dem Ort, an dem eine Einheit entweder auf unbestimmte Zeit oder über einen bestimmten, jedoch längeren Zeitraum hinweg (ein Jahr oder länger) in größerem Umfang wirtschaftliche Tätigkeiten und Transaktionen ausübt. Das Eigentum an Grundstücken und Gebäuden innerhalb des Wirtschaftsgebietes gilt als ausreichender Beleg dafür, dass der Eigentümer einen Schwerpunkt seines wirtschaftlichen Hauptinteresses in diesem Wirtschaftsgebiet besitzt. Unternehmen sind fast immer nur mit einer einzigen Volkswirtschaft verbunden. Steuerliche und andere rechtliche Vorschriften führen in der Regel dazu, dass für Tätigkeiten in den verschiedenen Rechtsordnungen jeweils getrennte rechtliche Einheiten verwendet werden. Darüber hinaus wird für statistische Zwecke in Fällen, in denen eine einzelne rechtliche Einheit umfangreiche Tätigkeiten in zwei oder mehr Gebieten ausübt (z. B. im Falle von gebietsübergreifenden Unternehmen, Filialen und Eigentum an Grundstücken), eine separate institutionelle Einheit gebildet. Aufgrund der Aufspaltung dieser rechtlichen Einheiten ist der Sitz der dann ermittelten Unternehmen eindeutig. Der Begriff Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses heißt nicht, dass Einheiten mit umfangreichen Tätigkeiten in zwei oder mehr Gebieten nicht aufgespalten werden müssten. Wenn ein Unternehmen keine physisch greifbare Präsenz besitzt, richtet sich seine Gebietsansässigkeit nach dem Wirtschaftsgebiet, nach dessen Recht das Unternehmen errichtet oder eingetragen wurde. |
|
2.08 |
Es können verschiedene gebietsansässige Einheiten unterschieden werden:
|
|
2.09 |
Bei Einheiten, die keine privaten Haushalte sind, gilt für den Nachweis ihrer gesamten Transaktionen außer jenen, die sich auf das Eigentum an Grundstücken und Gebäuden beziehen, Folgendes:
Eine gebietsansässige institutionelle Einheit kann eine fiktive gebietsansässige Einheit sein, und zwar im Hinblick auf die von einer gebietsfremden Einheit während eines Jahres oder länger im Land ausgeübten Tätigkeiten. Wird die Tätigkeit weniger als ein Jahr lang ausgeübt, bleibt sie Teil der Aktivitäten der produzierenden institutionellen Einheit, und es wird keine eigenständige institutionelle Einheit ausgewiesen. Wenn eine derartige — während eines Jahres oder länger ausgeübte — Tätigkeit unbedeutend ist und wenn Ausrüstungen im Ausland installiert werden, wird keine eigenständige Einheit ausgewiesen und die Tätigkeit wird als die der produzierenden institutionellen Einheit erfasst. |
|
2.10 |
Private Haushalte, außer in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden, sind gebietsansässige Einheiten des Wirtschaftsgebiets, in dem sie einen Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Hauptinteresses haben. Auslandsaufenthalte von weniger als einem Jahr finden keine Berücksichtigung bei der Feststellung ihrer Gebietsansässigkeit. Dies betrifft insbesondere:
Studenten werden immer als Gebietsansässige behandelt, unabhängig davon, wie lange sie im Ausland studieren. |
|
2.11 |
In ihrer Eigenschaft als Eigentümer von Grundstücken und/oder Gebäuden, die Teil des Wirtschaftsgebietes sind, sind alle Einheiten gebietsansässige Einheiten oder fiktive gebietsansässige Einheiten des Landes, in dem diese Grundstücke und Gebäude liegen. |
DIE INSTITUTIONELLEN EINHEITEN
|
2.12 |
Definition: Eine institutionelle Einheit ist eine wirtschaftliche Einheit, die durch Entscheidungsfreiheit in der Ausübung ihrer Hauptfunktion gekennzeichnet ist. Eine gebietsansässige Einheit gilt als institutionelle Einheit in dem Wirtschaftgebiet, in dem ihr Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses liegt, wenn sie neben der Entscheidungsfreiheit entweder über eine vollständige Rechnungsführung verfügt oder in der Lage ist, eine vollständige Rechnungsführung zu erstellen. Um Entscheidungsfreiheit in der Ausübung ihrer Hauptfunktion zu haben, muss die Einheit
|
|
2.13 |
Für Institutionen, die die genannten Voraussetzungen einer institutionellen Einheit nicht erfüllen, wird Folgendes bestimmt:
|
Hauptverwaltungen und Holdinggesellschaften
|
2.14 |
Hauptverwaltungen und Holdinggesellschaften sind institutionelle Einheiten. Es handelt sich um die folgenden beiden Typen:
|
Unternehmensgruppen
|
2.15 |
Große Unternehmensgruppen entstehen, wenn eine Muttergesellschaft mehrere Tochtergesellschaften kontrolliert, die ihrerseits eigene Tochtergesellschaften kontrollieren können, usw. Jedes Mitglied eines solchen Konzerns wird als getrennte institutionelle Einheit behandelt, wenn es die Definition einer institutionellen Einheit erfüllt. |
|
2.16 |
Ein Vorteil, Unternehmensgruppen nicht jeweils als einzelne institutionelle Einheiten zu betrachten, liegt darin, dass die Konzerne im Zeitverlauf nicht immer stabil bleiben und in der Praxis auch manchmal nicht leicht zu identifizieren sind. Daten über Konzerne zu erhalten, deren Tätigkeiten nicht stark integriert sind, kann schwierig sein. Viele dieser Gruppen sind zu groß und zu heterogen, um als eine einzige Einheit behandelt zu werden, und ihr Umfang und ihre Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit aufgrund von Fusionen und Übernahmen ändern. |
Zweckgesellschaften
|
2.17 |
Eine Zweckgesellschaft („special purpose entity“ (SPE) oder „special purpose vehicle“ (SPV)) ist gewöhnlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine Kommanditgesellschaft, die mit ganz spezifischen, eng umrissenen und zeitlich begrenzten Zielen gegründet wird, um finanzielle Risiken, ein bestimmtes steuerliches oder ein aufsichtsrechtliches Risiko auszugliedern. |
|
2.18 |
Für Zweckgesellschaften gibt es keine allgemeine Definition, folgende Merkmale sind jedoch typisch:
|
|
2.19 |
Unabhängig davon, ob eine Einheit alle oder keines dieser Merkmale aufweist und ob sie als SPE oder ähnlich bezeichnet wird, wird sie genauso wie jede andere institutionelle Einheit behandelt, d. h. sie wird entsprechend ihrer Haupttätigkeit einem Sektor und einem Wirtschaftsbereich zugeordnet, es sei denn, die Zweckgesellschaft verfügt über keine eigenständigen Handlungsbefugnisse. |
|
2.20 |
Somit werden firmeneigene Finanzierungseinrichtungen, künstliche Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften des Staates ohne Handlungsfreiheit dem Sektor der sie kontrollierenden Institution zugeordnet. Eine Ausnahme gilt, wenn sie gebietsfremd sind; in diesem Fall werden sie getrennt von der sie kontrollierenden Institution ausgewiesen. Handelt es sich um Zweckgesellschaften des Staates, schlagen sich die Tätigkeiten der Tochtergesellschaft in den Staatskonten nieder. |
Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen
|
2.21 |
Eine Holdinggesellschaft, die lediglich die Vermögenswerte von Tochterunternehmen hält, ist ein Beispiel für eine firmeneigene Finanzierungseinrichtung. Beispiele für andere Einheiten, die ebenfalls als firmeneigene Finanzierungseinrichtungen behandelt werden, sind Einheiten mit den vorstehend beschriebenen Merkmalen von Zweckgesellschaften, einschließlich Investmentfonds und Altersvorsorgeeinrichtungen sowie Einheiten, die zur Haltung und Verwaltung von Vermögen für Einzelpersonen oder Familien, zur Emission von Schuldtiteln im Namen verbundener Unternehmen (ein solches Unternehmen wird möglicherweise als Conduit bezeichnet) und zur Ausübung sonstiger finanzieller Aufgaben herangezogen werden. |
|
2.22 |
Der Grad der Unabhängigkeit dieser Einheit von der Muttergesellschaft ist daran zu erkennen, in welchem Umfang eine materielle Kontrolle über die Forderungen und Verbindlichkeiten dieser Einheit ausgeübt wird, d. h. die mit den Forderungen und Verbindlichkeiten verbundenen Risiken getragen und die entsprechenden Vorteile genutzt werden. Diese Einheiten werden dem Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften zugeordnet. |
|
2.23 |
Eine Einheit dieser Art, die nicht unabhängig von ihrer Muttergesellschaft handeln kann und Forderungen und Verbindlichkeiten lediglich passiv hält (was gelegentlich als „ferngesteuert“ bezeichnet wird), wird nicht als getrennte institutionelle Einheit behandelt, es sei denn, sie ist in einer anderen Volkswirtschaft als ihre Muttergesellschaft ansässig. Ist die Einheit in derselben Volkswirtschaft wie die Muttergesellschaft ansässig, wird sie als „künstliches Tochterunternehmen“ wie nachstehend beschrieben eingestuft. |
Künstliche Tochterunternehmen
|
2.24 |
Ein vollständig im Besitz einer Muttergesellschaft befindliches Tochterunternehmen kann errichtet werden, um Dienstleistungen an die Muttergesellschaft oder andere Gesellschaften im selben Konzern zu erbringen. Damit wird bezweckt, Steuern zu vermeiden, im Konkursfall die Verbindlichkeiten möglichst gering zu halten oder sonstige technische Vorteile aus dem in einem bestimmten Land geltenden Steuer- oder Gesellschaftsrecht zu ziehen. |
|
2.25 |
Im Allgemeinen genügen Einheiten dieses Typs nicht der Definition einer institutionellen Einheit, denn sie können nicht unabhängig von der Muttergesellschaft handeln und sind möglicherweise nur eingeschränkt in der Lage, in ihren Bilanzen aufgeführte Aktiva zu halten oder damit Transaktionen vorzunehmen. Ihre Produktionsmenge und der Preis, den sie dafür erhalten, werden von der Muttergesellschaft festgelegt, die (gegebenenfalls mit weiteren Gesellschaften desselben Konzerns) ihr einziger Kunde ist. Deshalb werden sie nicht als separate institutionelle Einheiten, sondern als Bestandteil der Muttergesellschaft betrachtet, und ihr Abschluss wird mit dem der Muttergesellschaft konsolidiert, es sei denn, diese Einheiten sind in einer anderen Volkswirtschaft als die Muttergesellschaft ansässig. |
|
2.26 |
Die hier beschriebenen künstlichen Tochterunternehmen sind zu unterscheiden von Einheiten, die lediglich Hilfstätigkeiten ausüben. Der Umfang der Hilfstätigkeiten beschränkt sich auf Dienstleistungen, die praktisch alle Unternehmen in gewissem Maße benötigen, z. B. Reinigung der Räumlichkeiten, Führung der Lohnbuchhaltung oder Bereitstellung der IT-Infrastruktur (siehe Kapitel 1 Nummer 1.31). |
Zweckgesellschaften des Staates
|
2.27 |
Auch der Staat kann besondere Zweckeinheiten errichten, die ähnliche Merkmale und Funktionen wie die firmeneigenen Finanzierungseinrichtungen und künstlichen Tochterunternehmen aufweisen. Diese Einheiten sind nicht zu eigenständigem Handeln ermächtigt, das Spektrum der Transaktionen, die sie vornehmen können, ist begrenzt. Weder übernehmen sie die Risiken der von ihnen gehaltenen Forderungen und Verbindlichkeiten noch kommen ihnen deren Vorteile zugute. Sind diese Einheiten gebietsansässig, werden sie als Bestandteil des Staates und nicht als separate Einheiten behandelt. Sind sie gebietsfremd, werden sie als separate Einheiten betrachtet. Alle Transaktionen, die die Zweckgesellschaft im Ausland vornimmt, spiegeln sich in den entsprechenden Transaktionen mit dem Staat wider. Eine Einheit, die im Ausland einen Kredit aufnimmt, wird demnach so behandelt, als ob sie denselben Betrag an den Staat verleiht, und zwar zu denselben Bedingungen wie im ursprünglichen Darlehen. |
|
2.28 |
Zusammengefasst: Die Abschlüsse der Zweckgesellschaften ohne eigenständige Handlungsbefugnisse werden mit der Muttergesellschaft konsolidiert, es sei denn, sie sind in einer anderen Volkswirtschaft als diese ansässig. Von dieser allgemeinen Regel gibt es eine einzige Ausnahme, wenn nämlich eine gebietsfremde Zweckgesellschaft vom Staat errichtet wird. |
|
2.29 |
Zu den fiktiven gebietsansässigen Einheiten zählen:
Die fiktiven gebietsansässigen Einheiten werden als institutionelle Einheiten behandelt, ungeachtet der Teilbuchführung und der Frage der Entscheidungsfreiheit. |
|
2.30 |
Folgende Einheiten werden als institutionelle Einheiten betrachtet:
|
DIE INSTITUTIONELLEN SEKTOREN
|
2.31 |
Die makroökonomische Analyse betrachtet die Handlungen der einzelnen institutionellen Einheiten nicht getrennt, sondern betrachtet die Tätigkeiten ähnlicher Einheiten als Aggregat. So werden Einheiten zu Gruppen zusammengefasst, die institutionelle Sektoren genannt werden, wobei einige weiter in Teilsektoren untergliedert werden. Tabelle 2.1 — Sektoren und Teilsektoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.32 |
Die Sektoren und Teilsektoren fassen jeweils die institutionellen Einheiten zusammen, die ein gleichartiges wirtschaftliches Verhalten aufweisen. Abbildung 2.1 — Zuordnung der Einheiten zu den Sektoren
|
|
2.33 |
Die institutionellen Einheiten werden den Sektoren nach der Art der Produzenten, die sie sind, und nach ihrer Hauptfunktion zugeordnet, die als ausschlaggebend für ihr wirtschaftliches Verhalten angesehen werden. |
|
2.34 |
Aus Abbildung 2.1 geht hervor, wie die Einheiten den Hauptsektoren zugewiesen werden. Um die Sektorzugehörigkeit einer Einheit zu bestimmen, die gebietsansässig und kein privater Haushalt ist, muss nach diesem Schema festgestellt werden, ob die Einheit vom Staat kontrolliert wird und ob es sich bei ihr um einen Markt- oder einen Nichtmarktproduzenten handelt. |
|
2.35 |
Als Kontrolle über eine finanzielle oder nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft gilt die Möglichkeit, die allgemeine Unternehmenspolitik festzulegen, indem z. B. entsprechende Personen in die Unternehmensleitung berufen werden können. |
|
2.36 |
Eine einzelne institutionelle Einheit — eine andere Kapitalgesellschaft, ein privater Haushalt, eine Organisation ohne Erwerbszweck oder eine staatliche Einheit — kontrolliert eine Kapitalgesellschaft oder Quasi-Kapitalgesellschaft, wenn sie über mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Gesellschaftsanteile verfügt oder auf anderem Wege mehr als die Hälfte der Stimmrechte der Anteilseigner ausüben kann. |
|
2.37 |
Um mehr als die Hälfte der Stimmrechte der Anteilseigner kontrollieren zu können, muss eine institutionelle Einheit nicht selbst Eigentümer der stimmberechtigten Gesellschaftsanteile sein. So könnte eine Kapitalgesellschaft C Tochterunternehmen einer anderen Kapitalgesellschaft B sein, über deren stimmberechtigte Gesellschaftsanteile mehrheitlich die Kapitalgesellschaft A verfügt. Die Kapitalgesellschaft C gilt als Tochterunternehmen der Kapitalgesellschaft B, wenn entweder die Kapitalgesellschaft B mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Anteile an der Kapitalgesellschaft C kontrolliert oder wenn die Kapitalgesellschaft B Anteilseigner von C ist und das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder der Unternehmensleitung von C einzusetzen oder zu entlassen. |
|
2.38 |
Die Kontrolle einer Kapitalgesellschaft durch den Staat erfolgt aufgrund eines besonderen Gesetzes, Erlasses oder einer besonderen Verordnung, die den Staat ermächtigt, die Unternehmenspolitik festzulegen. Als wichtigste Kriterien für die Entscheidung, ob eine Gesellschaft vom Staat kontrolliert wird, sind die nachfolgenden Faktoren zu berücksichtigen:
Die Kontrolle kann bereits durch Erfüllung eines einzigen Kriteriums gegeben sein, in anderen Fällen können jedoch auch mehrere verschiedene Kriterien zusammen darauf hinweisen, dass die Kontrolle gegeben ist. |
|
2.39 |
Bei Organisationen ohne Erwerbszweck, die über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen, sind die nachstehenden fünf Kontrollkriterien zu berücksichtigen:
Wie bei den Gesellschaften kann in einigen Fällen durch Erfüllung eines einzigen Kriteriums eine Kontrolle gegeben sein, in anderen Fällen können jedoch auch erst mehrere verschiedene Kriterien zusammen darauf hinweisen, dass die Kontrolle gegeben ist. |
|
2.40 |
Die Unterscheidung zwischen markt- und nichtmarktbestimmt, und in diesem Zusammenhang bei Einheiten des öffentlichen Sektors die Zuordnung zum Staats- oder zum Unternehmenssektor hängt von den in Nummer 1.37 dargelegten Kriterien ab. |
|
2.41 |
Die Unterteilung der Sektoren in Teilsektoren erfolgt für jeden Sektor nach eigenen Kriterien (beispielsweise lässt sich der Staat in Bund (Zentralstaat), Länder und Gemeinden sowie Sozialversicherung aufgliedern). Damit kann das wirtschaftliche Verhalten der Einheiten im Einzelnen besser beschrieben werden. Die Konten der Sektoren und Teilsektoren erfassen alle Haupt- und Nebentätigkeiten der dort eingeordneten institutionellen Einheiten. Jede institutionelle Einheit gehört nur einem Sektor oder Teilsektor an. |
|
2.42 |
Bei der Sektorzuordnung einer institutionellen Einheit, die hauptsächlich Waren und Dienstleistungen produziert, wird zunächst über den Produzententyp entschieden. |
|
2.43 |
Tabelle 2.2 zeigt die Produzententypen und die Haupttätigkeiten der einzelnen Sektoren: Tabelle 2.2 — Produzententypen und Haupttätigkeiten der einzelnen Sektoren
|
|
2.44 |
Der Sektor übrige Welt (S.2) erfasst Strom- und Bestandstransaktionen zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden Einheiten — die gebietsfremden Einheiten werden dabei nicht nach ihrer Hauptfunktion oder nach Typen untergliedert, sondern nur insoweit nachgewiesen, wie sie Transaktionen mit gebietsansässigen Einheiten durchführen. |
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)
|
2.45 |
Definition: Der Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11) umfasst institutionelle Einheiten, die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und als Marktproduzenten in der Haupttätigkeit Waren und nichtfinanzielle Dienstleistungen produzieren. Zum Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften zählen ebenfalls nichtfinanzielle Quasi-Kapitalgesellschaften (siehe Nummer 2.13 Buchstabe f). |
|
2.46 |
Folgende institutionelle Einheiten werden erfasst:
|
|
2.47 |
„Nichtfinanzielle Quasi-Kapitalgesellschaften“ sind Einheiten, die als Marktproduzenten in der Hauptfunktion Waren und nichtfinanzielle Dienstleistungen produzieren und die Bedingungen für die Einstufung als Quasi-Kapitalgesellschaften (siehe Nummer 2.13 Buchstabe f) erfüllen. Nichtfinanzielle Quasi-Kapitalgesellschaften müssen ausreichend Informationen vorhalten, um eine vollständige Rechnungsführung erstellen zu können, und werden wie Kapitalgesellschaften geführt. Das De-facto-Verhältnis zu ihrem Eigentümer entspricht dem Verhältnis zwischen einer Kapitalgesellschaft zu ihren Anteilseignern. Daher werden nichtfinanzielle Quasi-Kapitalgesellschaften im Eigentum von privaten Haushalten, staatlichen Einheiten oder Organisationen ohne Erwerbszweck wie nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften im Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften und nicht dem Sektor ihres Eigentümers zugeordnet. |
|
2.48 |
Das Vorhandensein einer vollständigen Rechnungsführung einschließlich Vermögensbilanzen ist keine hinreichende Bedingung für die Einstufung von Marktproduzenten als institutionelle Einheiten wie z. B. Quasi-Kapitalgesellschaften. Personengesellschaften und öffentliche Marktproduzenten, mit Ausnahme der unter Nummer 2.46 Buchstaben a, b, c und f genannten, sowie Einzelunternehmen, auch wenn sie über eine vollständige Rechnungsführung verfügen, sind in der Regel keine getrennten institutionellen Einheiten, weil sie keine Entscheidungsfreiheit genießen. Ihre Geschäftsführung bleibt von den privaten Haushalten, Organisationen ohne Erwerbszweck oder öffentlichen Körperschaften, denen sie gehören, abhängig. |
|
2.49 |
Zu den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften gehören auch die fiktiven gebietsansässigen Einheiten, die als Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt werden. |
|
2.50 |
Der Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften wird in drei Teilsektoren untergliedert:
|
|
2.51 |
Definition: Der Teilsektor öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften umfasst alle nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, Quasi-Kapitalgesellschaften und Organisationen ohne Erwerbszweck, die über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen und Marktproduzenten sind, sofern die genannten Einheiten von staatlichen Einheiten kontrolliert werden. |
|
2.52 |
Die Eigentümer öffentlicher Quasi-Kapitalgesellschaften sind staatliche Einheiten. |
Teilsektor inländische private nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11002)
|
2.53 |
Definition: Der Teilsektor inländische private nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften umfasst alle nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, Quasi-Kapitalgesellschaften und Organisationen ohne Erwerbszweck, die über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen und Marktproduzenten sind, sofern die genannten Einheiten nicht vom Staat oder von gebietsfremden institutionellen Einheiten kontrolliert werden. Dieser Teilsektor umfasst Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition sind, aber nicht zum Teilsektor ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11003) gehören. |
Teilsektor ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11003)
|
2.54 |
Definition: Der Teilsektor ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften umfasst alle nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die von gebietsfremden institutionellen Einheiten kontrolliert werden. Zu diesem Teilsektor zählen:
|
Finanzielle Kapitalgesellschaften (S.12)
|
2.55 |
Definition: Der Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften (S.12) umfasst institutionelle Einheiten, die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und als Marktproduzenten in der Haupttätigkeit finanzielle Dienstleistungen produzieren. Derartige institutionelle Einheiten umfassen sämtliche Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die hauptsächlich in folgenden Bereichen tätig sind:
Hierzu zählen auch institutionelle Einheiten, die Finanzdienstleistungen erbringen und bei denen entweder die Forderungen oder die Verbindlichkeiten meist nicht am freien Markt gehandelt werden. |
|
2.56 |
Finanzielle Mittlertätigkeit einer institutionellen Einheit besteht darin, für eigene Rechnung auf dem Markt Forderungen zu erwerben und gleichzeitig Verbindlichkeiten einzugehen. Dabei werden die aufgenommenen Mittel zum Beispiel in Bezug auf die Fälligkeit der Beträge, ihren Umfang und das Risiko u. Ä. umgewandelt und umgeschichtet, so dass den Verbindlichkeiten Forderungen anderer Art gegenüberstehen. Der Teilsektor Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten erbringt keine finanzielle Mittlertätigkeit, seine Dienstleistungen stehen damit jedoch in Zusammenhang. |
Finanzielle Mittler
|
2.57 |
Die finanzielle Mittlertätigkeit sorgt für den Fluss finanzieller Mittel zwischen Dritten, die davon einen Überschuss haben, und solchen, die finanziellen Bedarf haben. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um eine reine Vermittlung für andere institutionelle Einheiten, sondern die Mittler nehmen Mittel für eigene Rechnung auf und tragen das damit verbundene Risiko. |
|
2.58 |
Gegenstand der finanziellen Mittlertätigkeit können alle Verbindlichkeiten sein, jedoch nicht die sonstigen Verbindlichkeiten (AF.8). Andererseits können mit Ausnahme der Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6) — jedoch einschließlich der sonstigen Forderungen — alle Forderungen Gegenstand der finanziellen Mittlertätigkeit sein. Die finanziellen Mittler können ihre Mittel in Vermögensgütern, wie Immobilien, anlegen. Um als Finanzmittler zu gelten, sollte eine Gesellschaft Verbindlichkeiten auf dem Markt eingehen und die Mittel umwandeln. Immobiliengesellschaften sind keine finanziellen Mittler. |
|
2.59 |
Die Funktion von Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen besteht in der Zusammenfassung von Versicherungsrisiken. Die Verbindlichkeiten dieser institutionellen Einheiten sind die Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6). Die entsprechenden Gegenposten bilden Kapitalanlagen der Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen, die als finanzielle Mittler fungieren. |
|
2.60 |
Geldmarktfonds und Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) gehen hauptsächlich Verbindlichkeiten ein, indem sie Anteile (AF.52) ausgeben. Sie wandeln die eingenommenen Mittel um, indem sie finanzielle Aktiva und/oder Immobilien erwerben. Investmentfonds werden als finanzielle Mittler angesehen. Jede Veränderung ihrer Aktiva und Passiva mit Ausnahme der eigenen Anteile schlägt sich im Eigenkapital (siehe 7.07) der Investmentfonds nieder. Da das Eigenkapital der Investmentfonds dem Wert der Fondsanteile entspricht, spiegelt sich jede Veränderung des Wertes der Aktiva und Passiva des Fonds im Marktpreis dieser Anteilscheine wider. Investmentfonds, die in Immobilien investieren, werden als finanzielle Mittler angesehen. |
|
2.61 |
Die finanzielle Mittlertätigkeit beschränkt sich auf den Erwerb von Aktiva und das Eingehen von Verbindlichkeiten gegenüber der Allgemeinheit oder bestimmten, relativ großen Gruppen. Beschränkt sich die Tätigkeit auf wenige Einzelpersonen oder Familien, liegt keine finanzielle Mittlertätigkeit vor. |
|
2.62 |
Ausnahmsweise gibt es auch finanzielle Mittlertätigkeit auf eingeschränkten Märkten. Beispielsweise können kommunale Kreditinstitute von den betreffenden kommunalen Körperschaften abhängen oder Finanzierungsleasinggesellschaften können bezüglich der Aufnahme und Anlagen der finanziellen Mittel von einem Mutterkonzern abhängen. Um als finanzielle Mittler eingestuft zu werden, ist das Kredit- und Spareinlagengeschäft dieser Institute unabhängig von der betreffenden kommunalen Körperschaft bzw. dem Mutterkonzern zu tätigen. |
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten
|
2.63 |
Zu den Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten zählen Hilfstätigkeiten, die zur Durchführung von Transaktionen mit finanziellen Aktiva und Passiva oder zur Umwandlung bzw. Umschichtung von finanziellen Mitteln ausgeübt werden. Unternehmen, die Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten schwerpunktmäßig ausüben, übernehmen selbst keine Risiken durch den Erwerb finanzieller Aktiva oder das Eingehen von Verbindlichkeiten. Sie erleichtern die finanzielle Mittlertätigkeit. Hauptverwaltungen, deren Töchter sämtlich oder in der Mehrzahl finanzielle Kapitalgesellschaften sind, werden den Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten zugeordnet. |
Finanzielle Kapitalgesellschaften, die nicht finanzielle Mittler sind oder Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten ausüben
|
2.64 |
Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne finanzielle Mittler und Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten), sind Finanzdienstleistungen erbringende institutionelle Einheiten, bei denen entweder die Forderungen oder die Verbindlichkeiten meist nicht am freien Markt gehandelt werden. |
Institutionelle Einheiten des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
|
2.65 |
Zum Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften (S.12) gehören folgende institutionelle Einheiten:
|
Die neun Teilsektoren des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
|
2.66 |
Im Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften werden folgende Teilsektoren unterschieden:
|
Zusammenfassung von Teilsektoren des Sektors finanzielle Kapitalgesellschaften
|
2.67 |
Monetäre Finanzinstitute (MFI) in der Definition der EZB sind alle Einheiten der Teilsektoren Zentralbank (S.121), Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122) und Geldmarktfonds (S.123). |
|
2.68 |
Die sonstigen monetären Finanzinstitute bestehen aus denjenigen finanziellen Mittlern, über die die Auswirkung der Geldpolitik der Zentralbank (S.121) auf die übrigen Wirtschaftsteilnehmer weitergegeben wird. Es handelt sich um die Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122) und die Geldmarktfonds (S.123). |
|
2.69 |
Finanzinstitute, die sich mit der Zusammenfassung von Versicherungsrisiken befassen, sind die Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen. Sie bestehen aus den Teilsektoren Versicherungsgesellschaften (S.128) und Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129). |
|
2.70 |
Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) umfassen die Teilsektoren Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124), sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Alterssicherungssysteme) (S.125), Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126) sowie firmeneigene Finanzierungseirichtungen und Kapitalgeber (S.127). |
Untergliederung der Teilsektoren der finanziellen Kapitalgesellschaften in öffentlich, inländisch privat und ausländisch kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften
|
2.71 |
Mit Ausnahme des Teilsektors S.121 werden sämtliche Teilsektoren folgendermaßen tiefer untergliedert:
Dabei gelten die gleichen Kriterien wie für die Untergliederung des Sektors nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (siehe Nummern 2.51 bis 2.54). Tabelle 2.3 — Der Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften und seine Teilsektoren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentralbank (S.121)
|
2.72 |
Definition: Der Teilsektor Zentralbank (S.121) umfasst alle finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, deren Hauptfunktion darin besteht, Zahlungsmittel auszugeben, den inneren und den äußeren Wert der Landeswährung aufrechtzuerhalten und die internationalen Währungsreserven des Landes ganz oder teilweise zu halten. |
|
2.73 |
Im Teilsektor S.121 werden folgende finanzielle Mittler erfasst:
|
|
2.74 |
Nicht im Teilsektor S.121 zu erfassen sind andere Institutionen und Stellen außerhalb der Zentralbank, die für die Regulierung und Beaufsichtigung finanzieller Kapitalgesellschaften oder der Finanzmärkte zuständig sind. Sie werden dem Teilsektor S.126 zugeordnet. |
Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122)
|
2.75 |
Definition: Der Teilsektor Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122) besteht aus allen nicht zu den Teilsektoren Zentralbank und Geldmarktfonds zählenden finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die hauptsächlich finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben und deren Geschäftstätigkeit darin besteht, Einlagen und/oder Einlagensubstitute im engeren Sinne von anderen institutionellen Einheiten, d. h. nicht nur von MFI, aufzunehmen und für eigene Rechnung Kredite zu gewähren und/oder in Wertpapiere zu investieren. |
|
2.76 |
Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) sind nicht mit „Banken“ gleichzusetzen, da sie finanzielle Kapitalgesellschaften umfassen können, die sich nicht als Banken bezeichnen, oder solche, die in einigen Ländern die Bezeichnung „Bank“ nicht führen dürfen, während andere finanzielle Kapitalgesellschaften, die sich selbst als Banken bezeichnen, möglicherweise überhaupt keine Kreditinstitute sind. Im Teilsektor S.122 sind folgende finanzielle Mittler zu erfassen:
|
|
2.77 |
Die folgenden finanziellen Mittler werden dem Teilsektor S.122 zugeordnet, wenn ihre Tätigkeit darin besteht, von der Allgemeinheit rückzahlbare Mittel in Form von Einlagen oder auf andere Weise, z. B. durch die laufende Ausgabe langfristiger Schuldverschreibungen, entgegenzunehmen:
Andernfalls werden finanzielle Mittler im Teilsektor S.124 erfasst. |
|
2.78 |
Nicht zum Teilsektor S.122 gehören:
|
Geldmarktfonds (S.123)
|
2.79 |
Definition: Der Teilsektor Geldmarktfonds (S.123) besteht aus allen finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften (ohne die den Teilsektoren Zentralbank und Kreditinstitute zugeordneten Gesellschaften), die hauptsächlich als finanzielle Mittler tätig sind. Ihre Geschäftstätigkeit besteht darin, Investmentfondsanteile von institutionellen Einheiten als Einlagensubstitute im engeren Sinne auszugeben und für eigene Rechnung vor allem in Geldmarktfondsanteile, kurzfristige Schuldtitel und/oder Einlagen zu investieren. |
|
2.80 |
Im Teilsektor S.123 werden folgende finanzielle Mittler erfasst: Investmentfonds, Investmentgesellschaften (auch sogenannte unit trusts) und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile Einlagensubstitute im engeren Sinne sind. |
|
2.81 |
Nicht zum Teilsektor S.123 gehören:
|
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124)
|
2.82 |
Definition: Der Teilsektor Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124) besteht aus allen Organismen für gemeinsame Anlagen (ohne die im Teilsektor Geldmarktfonds erfassten Organismen), die hauptsächlich als finanzielle Mittler tätig sind. Ihre Geschäftstätigkeit besteht darin, nicht als Einlagensubstitute im engeren Sinne gedachte Investmentfondsanteile auszugeben und für eigene Rechnung vor allem in finanzielle Aktiva (außer kurzfristigen Anlagen) sowie in Vermögensgüter (in der Regel Immobilien) zu investieren. |
|
2.83 |
Zum Teilsektor Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) gehören Investmentfonds, Investmentgesellschaften und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht als Einlagensubstitute im engeren Sinne betrachtet werden. |
|
2.84 |
Im Teilsektor S.124 werden folgende finanzielle Mittler erfasst:
|
|
2.85 |
Nicht zum Teilsektor S.124 gehören:
|
Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) (S.125)
|
2.86 |
Definition: Der Teilsektor sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen) (S.125) umfasst alle finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, deren Hauptfunktion darin besteht, finanzielle Mittlertätigkeiten auszuüben, und die zu diesem Zweck Verbindlichkeiten eingehen, die nicht die Form von Zahlungsmitteln, Einlagen und Investmentfondsanteilen haben oder in Zusammenhang mit Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen anderer institutioneller Einheiten bestehen. |
|
2.87 |
Zum Teilsektor S.125 zählen finanzielle Mittler, die überwiegend im Bereich der langfristigen Finanzierung tätig sind. In den meisten Fällen unterscheidet sich dieser Teilsektor aufgrund der vorwiegend langen Fristigkeit von den Teilsektoren der sonstigen Kreditinstitute (S.122 und S.123). Die Abgrenzung gegenüber den Teilsektoren Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124), Versicherungsgesellschaften (S.128) und Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129) erfolgt durch den Ausschluss von Passiva in Form von Investmentfondsanteilen, die nicht als Einlagensubstitute im engeren Sinne angesehen werden, und von Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen. |
|
2.88 |
Der Teilsektor sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) (S.125) wird weiter in Teilsektoren untergliedert, die aus finanziellen Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben (FMKG), Wertpapierhändlern, finanziellen Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren, sowie speziellen finanziellen Kapitalgesellschaften bestehen. Dies geht aus Tabelle 2.4 hervor. Tabelle 2.4 — Teilsektor sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeseinrichtungen) (S.125) und seine Untergliederungen Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) Finanzielle Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben (FMKG) Wertpapierhändler Finanzielle Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren Spezielle finanzielle Kapitalgesellschaften |
|
2.89 |
Nicht zum Teilsektor S.125 zählen Organisationen ohne Erwerbszweck mit eigener Rechtspersönlichkeit im Dienst von sonstigen Finanzinstituten, die aber selbst keine finanzielle Mittlertätigkeit ausüben. Sie sind dem Teilsektor S.126 zuzurechnen. |
Finanzielle Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben (FMKG)
|
2.90 |
Definition: Finanzielle Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben (FMKG), sind Unternehmen, die mit Verbriefungstransaktionen befasst sind. FMKG, die den Kriterien einer institutionellen Einheit entsprechen, werden dem Sektor S.125 zugerechnet, andernfalls werden sie als Bestandteil ihrer Muttergesellschaft behandelt. |
Wertpapierhändler, finanzielle Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren, und spezielle finanzielle Kapitalgesellschaften
|
2.91 |
Wertpapierhändler für eigene Rechnung sind finanzielle Mittler für eigene Rechnung. |
|
2.92 |
Finanzielle Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren, umfassen z. B. finanzielle Mittler, die sich mit Folgendem befassen:
|
|
2.93 |
Spezielle finanzielle Kapitalgesellschaften sind finanzielle Mittler, z. B.:
|
|
2.94 |
Hauptverwaltungen, die eine Gruppe von Tochterunternehmen beaufsichtigen und verwalten, die vorwiegend finanzielle Mittlertätigkeiten und/oder damit verbundene Tätigkeiten ausüben, werden dem Teilsektor S.126 zugeordnet. |
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126)
|
2.95 |
Definition: Der Teilsektor Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126) besteht aus allen finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die in ihrer Hauptfunktion eng mit den finanziellen Mittlertätigkeiten verbundene Tätigkeiten ausüben, die jedoch selbst keine finanziellen Mittler sind. |
|
2.96 |
Zum Teilsektor S.126 zählen die folgenden finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften:
|
|
2.97 |
Der Teilsektor S.126 umfasst auch Hauptverwaltungen, deren Tochterunternehmen alle oder überwiegend finanzielle Kapitalgesellschaften sind. |
Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.127)
|
2.98 |
Definition: Der Teilsektor firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.127) besteht aus allen finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die weder finanzielle Mittlertätigkeiten noch damit verbundene Tätigkeiten ausüben und bei denen entweder die Forderungen oder die Verbindlichkeiten meist nicht am freien Markt gehandelt werden. |
|
2.99 |
Zum Teilsektor S.127 zählen insbesondere die folgenden finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften:
|
Versicherungsgesellschaften (S.128)
|
2.100 |
Definition: Der Teilsektor Versicherungsgesellschaften (S.128) umfasst alle finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die in ihrer Hauptfunktion als Folge der Zusammenfassung von Versicherungsrisiken finanzielle Mittlertätigkeiten vor allem in der Form von Direkt- oder Rückversicherungen ausüben (siehe Nummer 2.59). |
|
2.101 |
Versicherungsgesellschaften erbringen folgende Dienstleistungen:
|
|
2.102 |
Nichtlebensversicherungsgesellschaften können folgende Versicherungsdienstleistungen anbieten:
Finanz- oder Kreditversicherungsgesellschaften, auch Garantiegesellschaften genannt, stellen Garantien, Bürgschaften oder Kautionsversicherungen zur Absicherung von Verbriefungs- und anderen Kreditprodukten bereit. |
|
2.103 |
Versicherungsgesellschaften sind meist Kapitalgesellschaften oder Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Kapitalgesellschaften sind das Eigentum von Anteilseignern und häufig börsennotiert. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind Eigentum ihrer Versicherungsnehmer und schütten ihre Gewinne an die Versicherungsnehmer „mit Gewinnbeteiligung“ in Form von Dividenden oder Boni aus. „Firmeneigene“ Versicherer sind in der Regel das Eigentum einer nichtfinanziellen Kapitalgesellschaft und versichern meistens die Risiken ihrer Anteilseigner. Kasten 2.1 — Versicherungsarten
|
||||||||||||||||||||||||
|
2.104 |
Nicht zum Teilsektor S.128 gehören:
|
Pensionseinrichtungen (S.129)
|
2.105 |
Definition: Der Teilsektor Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129) umfasst alle finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die in ihrer Hauptfunktion als Folge der Zusammenfassung sozialer Risiken und Bedürfnisse der Versicherten finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben (soziale Sicherung). Altersvorsorgeeinrichtungen stellen als Systeme der sozialen Sicherung Einkommen im Ruhestand und häufig Leistungen bei Tod und Erwerbsunfähigkeit bereit. |
|
2.106 |
Der Teilsektor S.129 besteht nur aus den Systemen der sozialen Alterssicherung, die als institutionelle Einheiten getrennt von den sie schaffenden Einheiten sind. Diese rechtlich selbständigen Systeme besitzen Entscheidungsfreiheit und verfügen über eine vollständige Rechnungsführung. Rechtlich unselbständige Altersvorsorgeeinrichtungen sind keine institutionellen Einheiten und bleiben deshalb Bestandteil der institutionellen Einheit, die sie betreibt. |
|
2.107 |
Beispiele für Teilnehmer an Altersvorsorgeeinrichtungen sind Arbeitnehmer eines einzigen Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, Arbeitnehmer eines Produktionsbereichs oder eines Wirtschaftsbereichs sowie Personen, die der gleichen Berufsgruppe angehören. Bei den vertraglich vereinbarten Leistungen kann es sich um folgende Leistungen handeln:
|
|
2.108 |
In einigen Ländern können alle diese Arten von Risiken sowohl von Lebensversicherungsgesellschaften als auch von Altersvorsorgeeinrichtungen abgesichert werden. In anderen Ländern wiederum ist vorgeschrieben, dass einige dieser Risikokategorien von Lebensversicherungsgesellschaften versichert werden. Im Gegensatz zu Lebensversicherungsgesellschaften sind Altersvorsorgeeinrichtungen von Gesetzes wegen auf spezifische Gruppen von Arbeitnehmern und Selbständigen beschränkt. |
|
2.109 |
Altersvorsorgeeinrichtungen können von Arbeitgebern oder vom Staat organisiert werden. Sie können auch von Versicherungsgesellschaften im Namen von Arbeitnehmern organisiert werden; oder es können separate institutionelle Einheiten errichtet werden, die die Vermögenswerte halten und verwalten, auf die zur Deckung der Ansprüche gegenüber Altersvorsorgeeinrichtungen und zur Verteilung der Zahlungen aus Altersvorsorgeeinrichtungen zurückgegriffen wird. |
|
2.110 |
Nicht zum Teilsektor S.129 gehören:
|
Staat (S.13)
|
2.111 |
Definition: Der Sektor Staat (S.13) umfasst institutionelle Einheiten, die zu den Nichtmarktproduzenten zählen, deren Produktionswert für den Individual- und den Kollektivkonsum bestimmt ist, und die sich mit Zwangsabgaben von Einheiten anderer Sektoren finanzieren, sowie institutionelle Einheiten, die hauptsächlich Einkommen und Vermögen umverteilen. |
|
2.112 |
Zum Sektor S.13 zählen z. B. folgende institutionelle Einheiten:
|
|
2.113 |
Der Sektor Staat gliedert sich in vier Teilsektoren:
|
Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung) (S.1311)
|
2.114 |
Definition: Dieser Teilsektor umfasst alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt, mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung. Zum Teilsektor S.1311 zählen ebenfalls die vom Bund (Zentralstaat) kontrollierten Organisationen ohne Erwerbszweck, deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt. Marktordnungsstellen, die ausschließlich oder hauptsächlich Subventionen gewähren, werden unter S.1311 erfasst. Diejenigen Stellen, deren Tätigkeit ausschließlich oder hauptsächlich im Ankauf, in der Lagerung und im Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Nahrungsmitteln besteht, werden unter S.11 erfasst. |
Länder (ohne Sozialversicherung) (S.1312)
|
2.115 |
Definition: Dieser Teilsektor umfasst diejenigen Arten der öffentlichen Verwaltung, die als separate institutionelle Einheiten auf der Ebene unterhalb des Zentralstaates und oberhalb der lokalen Gebietskörperschaften (Gemeinden) staatliche Funktionen wahrnehmen, mit Ausnahme der Länderverwaltungen der Sozialversicherung. Zum Teilsektor S.1312 zählen die von den Ländern kontrollierten Organisationen ohne Erwerbszweck, deren Zuständigkeit auf das Wirtschaftsgebiet der Länder beschränkt ist. |
Gemeinden (ohne Sozialversicherung) (S.1313)
|
2.116 |
Definition: Dieser Teilsektor umfasst alle öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit auf einen örtlich begrenzten Teil des Wirtschaftsgebiets beschränkt ist, mit Ausnahme lokaler Stellen der Sozialversicherung. Zum Teilsektor S.1313 zählen die von den Gemeinden kontrollierten Organisationen ohne Erwerbszweck, deren Zuständigkeit auf das Wirtschaftsgebiet der lokalen Gebietskörperschaften beschränkt ist. |
Sozialversicherung (S.1314)
|
2.117 |
Definition: Der Teilsektor Sozialversicherung umfasst institutionelle Einheiten des Bundes (Zentralstaates), der Länder und der Gemeinden, deren Haupttätigkeit in der Gewährung von Sozialleistungen besteht und die folgende zwei Kriterien erfüllen:
Normalerweise gibt es zwischen der Höhe der Beiträge und dem Einzelrisiko des Versicherten keinen unmittelbaren Zusammenhang. |
Private Haushalte (S.14)
|
2.118 |
Definition: Der Sektor private Haushalte (S.14) besteht aus den Einzelpersonen und Gruppen von Einzelpersonen in ihrer Funktion als Konsumenten und in ihrer Eigenschaft als Produzenten, die marktbestimmte Waren, nichtfinanzielle und finanzielle Dienstleistungen produzieren (Marktproduzenten), soweit die Produktion von Waren und Dienstleistungen nicht durch separate Einheiten, die als Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt werden, erfolgt. Eingeschlossen sind Personen und Personengruppen, die Waren und nichtfinanzielle Dienstleistungen produzieren, die ausschließlich für die eigene Endverwendung bestimmt sind. Mehrpersonenhaushalte als Konsumenten sind Personengruppen, die in der gleichen Wohnung leben, ihr Einkommen und Vermögen zusammenlegen und bestimmte Waren und Dienstleistungen, insbesondere die Wohnung und das Essen, gemeinsam verbrauchen. Die Hauptmittel der privaten Haushalte sind folgende:
|
|
2.119 |
Im Sektor private Haushalte werden erfasst:
|
|
2.120 |
Im ESVG 2010 kann der Sektor private Haushalte in folgende Teilsektoren untergliedert werden:
|
|
2.121 |
Die Zuordnung der privaten Haushalte zu den Teilsektoren erfolgt anhand der größten Einkommenskategorie (Selbständigeneinkommen, Arbeitnehmerentgelt usw.) des privaten Haushalts insgesamt. Gibt es in einem Haushalt mehrere Empfänger der gleichen Einkommensart, so werden diese Einkommen bei der Anteilsbestimmung zusammengefasst. |
Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142)
|
2.122 |
Definition: Der Teilsektor Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer) umfasst die privaten Haushalte, bei denen das Selbständigeneinkommen (B.3) die größte Einkommensquelle ist, selbst wenn dieses Einkommen weniger als die Hälfte des Haushaltseinkommens ausmacht. Selbständigeneinkommen werden im Rahmen der Produktion von Waren und Dienstleistungen in privaten Haushalten erwirtschaftet, und zwar in Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit oder ohne bezahlte Arbeitnehmer, die innerhalb des Sektors private Haushalte ausgewiesen werden. |
Arbeitnehmerhaushalte (S.143)
|
2.123 |
Definition: Der Teilsektor Arbeitnehmerhaushalte umfasst die privaten Haushalte, bei denen das Arbeitnehmerentgelt (D.1) die größte Einkommensquelle des Haushalts darstellt. |
Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern (S.1441)
|
2.124 |
Definition: Der Teilsektor Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern umfasst die privaten Haushalte, bei denen die Vermögenseinkommen (D.4) die größte Einkommensquelle des Haushalts darstellen. |
Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern (S.1442)
|
2.125 |
Definition: Der Teilsektor Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern umfasst die privaten Haushalte, bei denen Renten und Pensionen die größte Einkommensquelle des Haushalts darstellen. Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern sind private Haushalte, die den größten Teil ihres Einkommens aus Altersruhegeldern oder sonstigen Renten einschließlich Renten- und Pensionszahlungen früherer Arbeitgeber beziehen. |
Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte (S.1443)
|
2.126 |
Definition: Der Teilsektor sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte umfasst die privaten Haushalte, bei denen die Transfereinkommen außer Renten und Pensionen die größte Einkommensquelle des Haushalts darstellen. Nicht zu diesen Transfereinkommen zählen neben den Renten und Pensionen auch Vermögenseinkommen und Einkommen von Personen, die auf Dauer in Anstalten und ähnlichen Einrichtungen leben. |
|
2.127 |
Liegen keine Angaben zu den relativen Beiträgen der Einkommensquellen des privaten Haushalts insgesamt vor, so wird als Kriterium für die Sektorzuordnung das Einkommen der Referenzperson herangezogen. Die Referenzperson eines privaten Haushalts ist die Person mit dem höchsten Einkommen. Ist nicht bekannt, welche Person das höchste Einkommen bezieht, so wird zur sektoralen Zuordnung des privaten Haushalts das Einkommen derjenigen Person herangezogen, die erklärt, dass sie die Referenzperson sei. |
|
2.128 |
Die privaten Haushalte können auch nach anderen Gesichtspunkten untergliedert werden, z. B. nach dem Bereich der unternehmerischen Tätigkeit in landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Haushalte. |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.15)
|
2.129 |
Definition: Der Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.15) umfasst Organisationen ohne Erwerbszweck mit eigener Rechtspersönlichkeit, die als private Nichtmarktproduzenten privaten Haushalten dienen. Ihre Hauptmittel stammen aus freiwilligen Geld- oder Sachbeiträgen, die private Haushalte in ihrer Eigenschaft als Konsumenten leisten, aus Zahlungen des Staates sowie aus Vermögenseinkommen. |
|
2.130 |
Organisationen von geringer Bedeutung sind nicht in den Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck einbezogen. Ihre Transaktionen werden zusammen mit denen der privaten Haushalte (S.14) ausgewiesen, da sie von den Transaktionen der Einheiten des letzteren Sektors nicht zu unterscheiden sind. Vom Staat kontrollierte nichtmarktbestimmte Organisationen ohne Erwerbszweck werden dem Sektor Staat zugeordnet. Zum Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck zählen die folgenden wichtigsten Arten privater Organisationen ohne Erwerbszweck, die nichtmarktbestimmte Waren und Dienstleistungen für private Haushalte bereitstellen, beispielsweise:
Zum Sektor S.15 gehören auch Wohlfahrtsverbände sowie Hilfswerke und Entwicklungshilfeorganisationen im Dienst von gebietsfremden Einheiten, nicht jedoch Organisationen, deren Mitglieder einen festen Anspruch auf bestimmte Waren und Dienstleistungen haben. |
Übrige Welt (S.2)
|
2.131 |
Definition: Der Sektor übrige Welt (S.2) ist eine Zusammenfassung von Einheiten, die nicht durch eine Funktion oder überwiegende Mittel gekennzeichnet sind. Sie fasst die gebietsfremden Einheiten zusammen, soweit sie Transaktionen mit gebietsansässigen institutionellen Einheiten durchführen oder andere Wirtschaftsbeziehungen mit gebietsansässigen Einheiten unterhalten. Die Konten der übrigen Welt sollen einen Gesamtüberblick über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Volkswirtschaft des betreffenden Landes und den Einheiten in der übrigen Welt geben. Die Organe und Einrichtungen der EU und internationale Organisationen werden hier einbezogen. |
|
2.132 |
Die übrige Welt ist kein Sektor, für den das vollständige Kontensystem auszufüllen ist, wenngleich es zweckmäßig ist, die übrige Welt als einen Sektor zu behandeln. Sektoren werden als Teile der Gesamtwirtschaft gebildet, um bezüglich des wirtschaftlichen Verhaltens, der Zielsetzungen und der Funktionen gleichartige Gruppen gebietsansässiger institutioneller Einheiten zu erhalten. Eine derartige Einteilung findet für den Sektor übrige Welt nicht statt; vielmehr werden hier Transaktionen, sonstige Ströme, Finanzierungsvorgänge und Forderungen und Verbindlichkeiten von nichtfinanziellen und finanziellen Kapitalgesellschaften, Organisationen ohne Erwerbszweck, privaten Haushalten und des Staates mit gebietsfremden institutionellen Einheiten gemeinsam erfasst. |
|
2.133 |
Die Konten der übrigen Welt erfassen alle Transaktionen zwischen gebietsansässigen institutionellen Einheiten und gebietsfremden Einheiten; dabei gibt es folgende Ausnahmen:
|
|
2.134 |
Der Sektor übrige Welt (S.2) gliedert sich in
|
Sektorale Zuordnung der produzierenden Einheiten nach der Rechtsform
|
2.135 |
Im Folgenden (siehe Nummern 2.31 bis 2.44) werden die Grundsätze der sektoralen Zurechnung der produzierenden Einheiten zusammengefasst, und zwar ausgehend von den gebräuchlichen Bezeichnungen der Rechtsformen dieser Einheiten. |
|
2.136 |
Private und öffentliche Kapitalgesellschaften als Marktproduzenten werden zugeordnet:
|
|
2.137 |
Genossenschaften und Personengesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit als Marktproduzenten werden zugeordnet:
|
|
2.138 |
Öffentliche Produzenten mit besonderem Statut, das ihnen Rechtspersönlichkeit verleiht, werden als Marktproduzenten zugeordnet:
|
|
2.139 |
Öffentliche Produzenten als Marktproduzenten ohne eigene Rechtspersönlichkeit werden zugeordnet,
|
|
2.140 |
Organisationen ohne Erwerbszweck mit eigener Rechtspersönlichkeit werden zugeordnet:
|
|
2.141 |
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Einzelunternehmen werden als Marktproduzenten zugeordnet,
|
|
2.142 |
Hauptverwaltungen werden zugeordnet:
Holdinggesellschaften, die die Vermögenswerte einer Gruppe von Tochterunternehmen halten, werden stets als finanzielle Kapitalgesellschaften behandelt. Holdinggesellschaften halten die Vermögenswerte eines Unternehmenskonzerns, nehmen im Hinblick auf den Konzern aber keine Führungsaufgaben wahr. |
|
2.143 |
Tabelle 2.5 stellt die einzelnen Fälle schematisch dar. Tabelle 2.5 — Sektorale Zuordnung der produzierenden Einheiten nach der Rechtsform
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖRTLICHE FACHLICHE EINHEITEN UND WIRTSCHAFTSBEREICHE
|
2.144 |
Meist finden in institutionellen Einheiten mehrere Arten von Produktionstätigkeiten (im Folgenden „Tätigkeiten“ genannt) statt. Es kann sich dabei neben der Haupttätigkeit um mehrere Nebentätigkeiten sowie um Hilfstätigkeiten handeln. |
|
2.145 |
Eine Tätigkeit ist der Einsatz von Produktionsmitteln wie Produktionsanlagen, Arbeitskraft, Produktionstechniken und -kenntnissen sowie von Vorprodukten zur Erzeugung neuer Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Art. Somit wird eine Tätigkeit durch die eingesetzten Erzeugnisse, den Produktionsprozess und die produzierten Güter charakterisiert. Die Tätigkeiten können mit Bezug auf eine Ebene der NACE Rev. 2 definiert werden. |
|
2.146 |
Wenn eine Einheit mehrere Tätigkeiten ausübt, werden diese — jedoch ohne die Hilfstätigkeiten (siehe Nummer 3.12) — nach der Wertschöpfung aufgeteilt. Die Tätigkeit mit dem größten Wertschöpfungsanteil ist die Haupttätigkeit, die übrigen sind Nebentätigkeiten. |
|
2.147 |
Um die Produktion und die Verwendung der Waren und Dienstleistungen möglichst gut analysieren zu können, sollten Darstellungseinheiten gewählt werden, die die ökonomisch-technischen Zusammenhänge am besten widerspiegeln. Die institutionellen Einheiten sollten daher in kleinere, mit Hinblick auf die Produktion homogenere Einheiten aufgeteilt werden. Um dieser Anforderung operationell gerecht zu werden, wird das Konzept der örtlichen fachlichen Einheit eingeführt. |
Örtliche fachliche Einheit
|
2.148 |
Definition: Die örtliche fachliche Einheit (örtliche FE) ist der Teil einer fachlichen Einheit (FE), der einer örtlichen Einheit entspricht. Im SNA 2008 und in der ISIC Rev. 4 wird die örtliche FE „Establishment“ genannt. Die FE fasst innerhalb einer institutionellen Einheit sämtliche Teile zusammen, die zur Ausübung einer Produktionstätigkeit auf vierstelliger Ebene (Klasse) der Klassifikation der Wirtschaftszweige (NACE Rev. 2) beitragen. Es handelt sich um eine Einheit, die einer oder mehreren operationellen Unterabteilungen einer institutionellen Einheit entspricht. Die institutionelle Einheit muss über ein Informationssystem verfügen, das es ermöglicht, für jede örtliche FE mindestens den Produktionswert, die Vorleistungen, die Arbeitnehmerentgelte, den Betriebsüberschuss, die Beschäftigten und die Bruttoanlageinvestitionen festzustellen oder zu berechnen. Die örtliche Einheit ist eine institutionelle Einheit, die an einem räumlich festgestellten Ort Waren oder Dienstleistungen produziert, oder ein Teil einer solchen institutionellen Einheit. Eine örtliche FE kann einer produzierenden institutionellen Einheit entsprechen, sie kann jedoch nie zu zwei verschiedenen institutionellen Einheiten gehören. |
|
2.149 |
Wenn eine Waren oder Dienstleistungen produzierende institutionelle Einheit eine Haupttätigkeit und eine oder mehrere Nebentätigkeiten ausübt, wird sie in eine entsprechende Zahl von FE zerlegt, wobei die Nebentätigkeiten in andere Positionen der Systematik eingeordnet werden als die Haupttätigkeit. Hilfstätigkeiten werden nicht von den Haupt- oder Nebentätigkeiten getrennt. Eine FE kann jedoch zusätzlich zu ihrer Haupttätigkeit auch Nebentätigkeiten ausüben, die anhand der Rechnungslegungsunterlagen nicht ausgesondert werden können. In diesem Fall kann eine FE eine oder mehrere Nebentätigkeiten umfassen. |
Wirtschaftsbereiche
|
2.150 |
Definition: Ein Wirtschaftsbereich umfasst eine Gruppe örtlicher FE, die gleiche oder ähnliche Tätigkeiten ausüben. Auf der tiefsten Gliederungsstufe umfasst ein Wirtschaftsbereich alle örtlichen FE, die einer (vierstelligen) Klasse der NACE Rev. 2 angehören und demnach die Tätigkeiten ausüben, die zu der entsprechenden NACE-Position gehören. Wirtschaftsbereiche umfassen sowohl örtliche FE, die marktbestimmte Waren und Dienstleistungen produzieren, als auch örtliche FE, die nichtmarktbestimmte Waren und Dienstleistungen produzieren. Definitionsgemäß umfasst ein Wirtschaftsbereich eine Gruppe örtlicher FE, die die gleiche Art von Produktionstätigkeit ausüben, unabhängig davon, ob die institutionellen Einheiten, denen sie angehören, Marktproduzenten oder Nichtmarktproduzenten sind. |
|
2.151 |
Wirtschaftsbereiche werden eingeteilt in:
|
Klassifikation der Wirtschaftsbereiche
|
2.152 |
Die Zusammenfassung örtlicher FE zu Wirtschaftsbereichen erfolgt nach der Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2). |
HOMOGENE PRODUKTIONSEINHEITEN UND HOMOGENE PRODUKTIONSBEREICHE
|
2.153 |
Zur Analyse des Produktionsprozesses eignet sich am besten die homogene Produktionseinheit. Die homogene Produktionseinheit ist durch eine Tätigkeit gekennzeichnet, die mithilfe der eingesetzten Produktionsfaktoren, des Produktionsprozesses und der produzierten Güter identifiziert werden kann. |
Homogene Produktionseinheit
|
2.154 |
Definition: Eine homogene Produktionseinheit führt eine Tätigkeit aus, die mithilfe der eingesetzten Produktionsfaktoren, des Produktionsprozesses und der produzierten Güter identifiziert werden kann. Die eingesetzten und produzierten Güter werden nach ihrer Beschaffenheit, ihrem Verarbeitungsgrad und der angewandten Produktionstechnik unterschieden. Sie lassen sich anhand einer Güterklassifikation identifizieren (Classification of Products by Activity — CPA). Die CPA ist eine Güterklassifikation, deren Positionen den Wirtschaftszweigen, in denen die Güter produziert werden, d. h. den Positionen der NACE Rev. 2, voll entsprechen. |
Homogener Produktionsbereich
|
2.155 |
Definition: Der homogene Produktionsbereich ist eine Zusammenfassung von homogenen Produktionseinheiten. Die in einem homogenen Produktionsbereich zusammengefassten Tätigkeiten werden durch eine Güterklassifikation bestimmt. Ein homogener Produktionsbereich stellt die in der Klassifikation bezeichneten Waren und Dienstleistungen her, und zwar alle und nur diese. |
|
2.156 |
Homogene Produktionsbereiche dienen der Wirtschaftsanalyse. Die homogenen Produktionseinheiten können im Allgemeinen nicht unmittelbar beobachtet werden. Vielmehr müssen die Angaben aus den statistischen Erhebungen so umgeformt werden, dass man Ergebnisse für homogene Produktionseinheiten erhält. |
KAPITEL 3
GÜTERTRANSAKTIONEN UND TRANSAKTIONEN MIT NICHTPRODUZIERTEN VERMÖGENSGÜTERN
GÜTERTRANSAKTIONEN IM ALLGEMEINEN
|
3.01 |
Definition: Güter sind Waren und Dienstleistungen, die durch den Produktionsbegriff des ESVG bestimmt sind. Zur Definition des Produktionsbegriffs siehe Nummer 3.07. |
|
3.02 |
Das ESVG weist folgende Hauptkategorien von Gütertransaktionen aus:
|
|
3.03 |
Gütertransaktionen werden in folgenden Konten gebucht:
Viele wichtige Kontensalden, wie Wertschöpfung, Bruttoinlandsprodukt, Nationaleinkommen und verfügbares Einkommen, werden über Gütertransaktionen definiert. Die Definition der Gütertransaktionen definiert diese Kontensalden. |
|
3.04 |
In der Aufkommenstabelle (siehe 1.136) werden die Produktionswerte und Importe als Aufkommen gebucht. In der Verwendungstabelle werden Vorleistungen, Bruttoinvestitionen, Konsumausgaben und Exporte als Verwendung ausgewiesen. In der symmetrischen Input-Output-Tabelle werden die Produktionswerte und Importe als Aufkommen gebucht, die anderen Gütertransaktionen beschreiben die Verwendung der Güter. |
|
3.05 |
Das Güteraufkommen wird zu Herstellungspreisen (siehe Nummer 3.44), die Güterverwendung zu Anschaffungspreisen (siehe Nummer 3.06) bewertet. Für einige Aufkommens- und Verwendungsarten, zum Beispiel für die Importe und Exporte von Waren, werden spezifischere Bewertungsprinzipien verwendet. |
|
3.06 |
Definition: Der Anschaffungspreis ist der Preis, den der Käufer für die Güter zum Zeitpunkt des Kaufes bezahlt. Der Anschaffungspreis umfasst Folgendes:
Der Anschaffungspreis umfasst nicht:
Wenn die Zeitpunkte des Kaufes und der Verwendung der Güter auseinanderfallen, werden die zwischen beiden Zeitpunkten eingetretenen Preisänderungen einbezogen, wie dies auch bei der Bewertung der Vorratsveränderung geschieht. Derartige Umbewertungen sind wichtig, wenn sich die Preise innerhalb des Jahres deutlich ändern. |
PRODUKTION UND PRODUKTIONSWERT
|
3.07 |
Definition: Produktion ist generell eine unter Kontrolle, Verantwortung und Management einer institutionellen Einheit ausgeführte Tätigkeit, bei der diese Einheit durch den Einsatz von Arbeitskräften, Kapital sowie Waren und Dienstleistungen andere Waren und Dienstleistungen produziert. Natürliche Prozesse ohne jedes menschliche Zutun, wie das unbeeinflusste Wachsen von Fischbeständen in internationalen Gewässern, werden nicht zur Produktion gerechnet (wohl aber die Fischzucht). |
|
3.08 |
Die Produktion umfasst:
Die unter den Buchstaben a bis e aufgeführten Tätigkeiten sind auch dann einzubeziehen, wenn sie illegal ausgeübt werden oder den Steuer-, Sozialversicherungs-, Statistik- oder anderen Behörden verborgen bleiben. Die Eigenproduktion von Waren durch private Haushalte wird erfasst, wenn diese Art der Produktion signifikant ist, d. h. wenn sie im Verhältnis zu dem Gesamtaufkommen dieser Waren in einem Land als quantitativ bedeutsam angesehen wird. Als Eigenproduktion von Waren durch private Haushalte werden nur die Eigenleistungen im Wohnungsbau sowie die Produktion, Lagerung und Veredelung landwirtschaftlicher Erzeugnisse einbezogen. |
|
3.09 |
Von der Produktion sind die häuslichen und persönlichen Dienste ausgeschlossen, die ein privater Haushalt für sich selbst erbringt. Ausgeschlossen sind beispielsweise:
Die durch bezahlte Hausangestellte erbrachten Dienste sowie die Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohnungsbesitz sind in der Produktion enthalten. |
Haupt-, Neben- und Hilfstätigkeiten
|
3.10 |
Definition: Die Haupttätigkeit einer örtlichen FE ist die Tätigkeit, deren Wertschöpfung die Wertschöpfung jeder anderen innerhalb der gleichen Einheit ausgeübten Tätigkeit übersteigt. Die Bestimmung der Haupttätigkeit erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 zunächst auf der höchsten und danach auf den tieferen Gliederungsebenen. |
|
3.11 |
Definition: Eine Nebentätigkeit ist eine innerhalb einer einzelnen örtlichen FE neben der Haupttätigkeit ausgeübte Tätigkeit. Das Produktionsergebnis aus der Nebentätigkeit ist ein Nebenprodukt. |
|
3.12 |
Definition: Eine Hilfstätigkeit ist eine Tätigkeit, deren Produktionsergebnis zur Verwendung innerhalb eines Unternehmens bestimmt ist. Die Hilfstätigkeit ist eine unterstützende Tätigkeit, die innerhalb einer produzierenden Einheit verrichtet wird, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Haupt- oder Nebentätigkeiten der örtlichen FE ausgeübt werden können. Alle für eine Hilfstätigkeit erforderlichen Inputs — wie Material, Arbeitskräfte, Abschreibungen usw. — werden als Inputs der Haupt- oder Nebentätigkeiten behandelt, denen die Hilfstätigkeit dient. Zu den Hilfstätigkeiten gehören beispielsweise:
Produzierende Einheiten haben die Wahl, Hilfstätigkeiten entweder selbst auszuüben und diese Dienstleistungen von spezialisierten Dienstleistern auf dem Markt zu erwerben. Die Herstellung selbsterstellter Anlagen gilt nicht als Hilfstätigkeit. |
|
3.13 |
Hilfstätigkeiten bilden keine separaten Einheiten; sie werden in die Haupt- oder Nebentätigkeiten einbezogen, denen sie dienen. Infolgedessen müssen Hilfstätigkeiten der örtlichen FE zugeordnet werden, der sie dienen. Hilfstätigkeiten können an anderen Standorten ausgeübt werden, die in einer anderen Region liegen als die FE, der sie dienen. Die strikte Anwendung der in Absatz 1 angeführten Regel für die geografische Zuordnung der Hilfstätigkeiten würde dazu führen, dass die Aggregate in Regionen, in denen es zu einer Konzentration von Hilfstätigkeiten kommt, unterschätzt würden. Hilfstätigkeiten sind daher gemäß dem Residenzprinzip derjenigen Region zuzuordnen, in der sie ausgeübt werden, sie werden jedoch dem gleichen Wirtschaftsbereich zugeordnet wie die örtlichen FE, denen sie dienen. |
Produktionswert (P.1)
|
3.14 |
Definition: Der Produktionswert ist der Wert aller Güter, die im Rechnungszeitraum produziert werden. Hierzu gehören beispielsweise:
|
|
3.15 |
Wenn eine institutionelle Einheit mehrere örtliche FE umfasst, so ist der Produktionswert der institutionellen Einheit gleich der Summe der Produktionswerte der zur ihr gehörenden örtlichen FE einschließlich der Güterlieferungen zwischen den örtlichen FE der institutionellen Einheit. |
|
3.16 |
Das ESVG 2010 unterscheidet nach der Marktbestimmung drei Produktionsarten:
Diese Unterscheidung wird auch für örtliche FE und institutionelle Einheiten verwendet:
Die Unterscheidung nach Markt, für die Eigenverwendung und Nichtmarkt ist aus folgenden Gründen besonders wichtig:
Die Unterscheidung legt die Grundsätze für die Bewertung der Produktion fest. Marktproduktion und Produktion für die Eigenverwendung werden zu Herstellungspreisen bewertet. Die gesamte Produktion der Nichtmarktproduzenten wird als Summe der Produktionskosten bewertet. Die Produktion einer institutionellen Einheit wird ermittelt als Summe der Produktionswerte ihrer örtlichen FE und hängt somit ebenfalls von der Unterscheidung zwischen „Markt“, „für die Eigenverwendung“ und „Nichtmarkt“ ab. Darüber hinaus wird die Unterscheidung auch zur Zuordnung der institutionellen Einheiten zu den Sektoren verwendet. Nichtmarktproduzenten werden dem Sektor Staat oder dem Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck zugeordnet. Die Unterscheidung wird nach dem Top-down-Verfahren vorgenommen, d. h. sie erfolgt von oben nach unten zunächst für die institutionellen Einheiten, dann für die örtlichen FE und schließlich für ihren Produktionswert. Auf der Güterebene wird anhand der Merkmale der institutionellen Einheiten und örtlichen FE, die diese Produktionswerte erzeugten, zwischen Marktproduktion, Produktion für die Eigenverwendung und Nichtmarktproduktion unterschieden. |
|
3.17 |
Definition: Marktproduktion ist die Herstellung von Gütern, die auf dem Markt verkauft werden oder verkauft werden sollen. |
|
3.18 |
Zur Marktproduktion zählen:
|
|
3.19 |
Definition: Preise sind wirtschaftlich signifikant, wenn sie die von den Produzenten angebotenen und von den Käufern nachgefragten Warenmengen wesentlich beeinflussen. Diese Preise ergeben sich, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:
Wirtschaftlich nicht signifikante Preise dürften verlangt werden, um gewisse Einnahmen zu erzielen oder einen sehr großen Nachfrageüberschuss, wie er bei einem völlig kostenlosen Angebot von Dienstleistungen auftreten könnte, zu vermeiden. Der wirtschaftlich signifikante Preis eines Gutes wird in Abhängigkeit von der institutionellen Einheit bzw. der örtlichen FE definiert, die das Gut produziert hat. Beispielsweise gilt, dass die von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sektor privater Haushalte für Dritte produzierten Güter stets zu wirtschaftlich signifikanten Preisen verkauft werden und folglich immer Marktproduktion sind. Für den Produktionswert anderer institutioneller Einheiten wird die Möglichkeit einer Marktproduktion zu wirtschaftlich signifikanten Preisen anhand eines quantitativen Kriteriums (des 50 %-Kriteriums) geprüft, bei dem das Verhältnis von Verkäufen zu Produktionskosten verwendet wird. Als Marktproduzent sollte die Einheit über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg mindestens 50 % ihrer Kosten durch ihre Verkäufe decken. |
|
3.20 |
Definition: Produktion für die Eigenverwendung umfasst die selbstproduzierten Waren und Dienstleistungen, die von einer institutionellen Einheit für ihren eigenen Konsum oder für ihre eigenen Investitionen verwendet werden. |
|
3.21 |
Nur Produzenten im Sektor private Haushalte können Güter für den eigenen Konsum produzieren. Beispiele für Güter für den eigenen Konsum sind:
|
|
3.22 |
Für eigene Investitionen verwendete Güter können in jedem Sektor produziert werden. Dies sind zum Beispiel:
|
|
3.23 |
Definition: Nichtmarktproduktion ist die Herstellung von Gütern, die anderen Einheiten unentgeltlich oder zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen zur Verfügung gestellt werden. Die Nichtmarktproduktion (P.13) besteht aus zwei Positionen: „Zahlungen für die Nichtmarktproduktion“ (P.131), die verschiedene Gebühren und Entgelte umfasst, und „Nichtmarktproduktion, sonstige“ (P.132), die die unentgeltlich zur Verfügung gestellte Produktion umfasst. Die Nichtmarktproduktion kann folgende Gründe haben:
|
|
3.24 |
Definition: Marktproduzenten sind örtliche FE oder institutionelle Einheiten, deren Produktion zum größten Teil aus Marktproduktion besteht. Wenn eine örtliche FE oder institutionelle Einheit ein Marktproduzent ist, muss ihre Haupttätigkeit per definitionem Marktproduktion sein, da das Konzept der Marktproduktion festgelegt wird, nachdem die Unterscheidung in Markt, für die Eigenverwendung und Nichtmarktproduktion auf den Produktionswert der örtlichen FE und der institutionellen Einheit angewendet wird, die die Güter hergestellt haben. |
|
3.25 |
Definition: Produzenten für die Eigenverwendung sind örtliche FE oder institutionelle Einheiten, deren Produktionswert zum größten Teil für die eigene letzte Verwendung innerhalb derselben institutionellen Einheit bestimmt ist. |
|
3.26 |
Definition: Nichtmarktproduzenten sind örtliche FE oder institutionelle Einheiten, deren Produktionswert zum größten Teil unentgeltlich oder zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen Dritten zur Verfügung gestellt wird. |
Institutionelle Einheiten: Unterscheidung in Markt, für die Eigenverwendung und Nichtmarkt
|
3.27 |
Für die institutionellen Einheiten als Produzenten gibt Tabelle 3.1 einen Überblick über die Unterscheidung nach Marktproduzenten, Produzenten für die Eigenverwendung und Nichtmarktproduzenten. Die Klassifizierung nach Sektoren wird ebenfalls gezeigt. Tabelle 3.1 — Institutionelle Einheiten nach Marktproduzenten, Produzenten für die Eigenverwendung und Nichtmarktproduzenten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.28 |
Tabelle 3.1 zeigt, dass zur Beantwortung der Frage, ob eine institutionelle Einheit als Marktproduzent, als Produzent für die Eigenverwendung oder als Nichtmarktproduzent zu klassifizieren ist, nacheinander mehrere Unterscheidungen vorgenommen werden. Die erste Unterscheidung ist die zwischen privaten und öffentlichen Produzenten. Ein öffentlicher Produzent ist ein Produzent, der vom Staat kontrolliert wird, wobei die Kontrolle der Definition unter Nummer 2.38 entspricht. |
|
3.29 |
Wie aus Tabelle 3.1 hervorgeht, gibt es private Produzenten in allen Sektoren mit Ausnahme des Sektors Staat. Öffentliche Produzenten hingegen kommen nur im Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, im Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften und im Sektor Staat vor. |
|
3.30 |
Eine besondere Kategorie von privaten Produzenten stellen die privaten Haushalte gehörenden Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar. Sie sind Marktproduzenten oder Produzenten für die Eigenverwendung. Bei letzteren handelt es sich um Eigentümer eigengenutzter Wohnungen und um Warenproduzenten für die Eigenverwendung. Alle privaten Haushalten gehörenden Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit werden zum Sektor der privaten Haushalte gerechnet, ausgenommen die privaten Haushalten gehörenden Quasi-Kapitalgesellschaften. Sie sind Marktproduzenten und werden in die Sektoren nichtfinanzielle und finanzielle Kapitalgesellschaften eingeordnet. |
|
3.31 |
Bei den verbleibenden privaten Produzenten wird zwischen privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstigen privaten Produzenten unterschieden. Definition: Eine private Organisation ohne Erwerbszweck wird definiert als eine in der Produktion von Waren und Dienstleistungen tätige rechtliche oder soziale Einheit, deren Rechtsstellung es ihr verbietet, den sie gründenden, kontrollierenden oder finanzierenden Einheiten als Einkommens-, Gewinn- oder sonstige Verdienstquelle zu dienen. Wenn ihre Produktionstätigkeit Überschüsse erwirtschaftet, können diese nicht von anderen institutionellen Einheiten entnommen werden. Die private Organisation ohne Erwerbszweck wird in die Sektoren nichtfinanzielle und finanzielle Kapitalgesellschaften eingeordnet, wenn sie ein Marktproduzent ist. Die private Organisation ohne Erwerbszweck wird in den Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck eingeordnet, wenn sie ein Nichtmarktproduzent ist, außer, wenn sie vom Staat kontrolliert wird. Wenn eine private Organisation ohne Erwerbszweck vom Staat kontrolliert wird, wird sie in den Sektor Staat einbezogen. Alle sonstigen privaten Produzenten, die keine Organisationen ohne Erwerbszweck sind, sind Marktproduzenten. Sie werden in die Sektoren nichtfinanzielle und finanzielle Kapitalgesellschaften einbezogen. |
|
3.32 |
Bei der Unterscheidung zwischen Marktproduktion und Nichtmarktproduktion und zwischen Markt- und Nichtmarkproduzenten sind verschiedene Kriterien anzuwenden. Die betreffenden Markt-Nichtmarkt-Kriterien (siehe Nummer 3.19 zur Definition wirtschaftlich signifikanter Preise) sollen das Vorhandensein von Marktgegebenheiten und von ausreichendem Marktverhalten des Produzenten bewerten. Gemäß dem quantitativen Markt-Nichtmarkt-Kriterium sollten Güter, die zu wirtschaftlich signifikanten Preisen verkauft werden, mindestens die Mehrheit der Produktionskosten durch Umsätze decken. |
|
3.33 |
Bei der Anwendung dieses quantitativen Markt-Nichtmarkt-Kriteriums werden Umsatz und Produktionskosten wie folgt definiert:
Bei der Anwendung des quantitativen Markt-Nichtmarkt-Kriteriums zur Unterscheidung von „marktbestimmt“ und „nichtmarktbestimmt“ werden mehrere Jahre berücksichtigt. Geringfügige Umsatzschwankungen von einem Jahr zum andern erfordern keine Neueinstufung der institutionellen Einheiten (und ihrer örtlichen FE sowie ihrer Produktion). |
|
3.34 |
Der Umsatz kann aus verschiedenen Elementen bestehen. Bei den medizinischen Versorgungsleistungen eines Krankenhauses kann er etwa enthalten:
Empfangene sonstige Subventionen und Geschenke (zum Beispiel von Wohlfahrtseinrichtungen) rechnen nicht zum Umsatz. Analog können beispielsweise verkaufte Verkehrsleistungen eines Produzenten enthalten sein in den Vorleistungen anderer Produzenten, in den von Arbeitgebern bereitgestellten Sacheinkommen, den vom Staat gewährten sozialen Sachleistungen sowie in den Käufen privater Haushalte ohne Erstattung. |
|
3.35 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck im Dienst von Kapitalgesellschaften sind ein Sonderfall. Sie werden gewöhnlich durch Mitgliedsbeiträge oder sonstige Zahlungen der betroffenen Gruppe von Kapitalgesellschaften finanziert. Diese Mitgliedsbeiträge werden jedoch nicht als Transfers behandelt, sondern als Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen, d. h. als Umsatz. Diese Organisationen ohne Erwerbszweck sind somit stets Marktproduzenten und werden in den Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften oder in den Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften eingeordnet. |
|
3.36 |
Bei der Anwendung des Kriteriums zum Vergleich des Umsatzes und der Produktionskosten von privaten oder öffentlichen Organisationen ohne Erwerbszweck kann die Einbeziehung aller an das Produktionsvolumen gebundenen Zahlungen in den Umsatz in einigen Sonderfällen irreführend sein. Dies kann zum Beispiel für die Finanzierung privater und öffentlicher Schulen der Fall sein. Die Zahlungen des Staates können an die Schülerzahl gebunden sein, aber Gegenstand von Verhandlungen mit dem Staat sein. In diesen Fällen werden sie nicht als Umsatz behandelt, wenngleich sie möglicherweise in deutlichem Zusammenhang mit dem Produktionsvolumen (wie etwa der Schülerzahl) stehen. Daraus ergibt sich, dass eine hauptsächlich durch derartige Zahlungen finanzierte Schule ein Nichtmarktproduzent ist. |
|
3.37 |
Öffentliche Produzenten können Marktproduzenten oder Nichtmarktproduzenten sein. Marktproduzenten werden in die Sektoren nichtfinanzielle und finanzielle Kapitalgesellschaften eingeordnet. Ist die institutionelle Einheit ein Nichtmarktproduzent, so wird sie in den Sektor Staat einbezogen. |
|
3.38 |
Bei örtlichen FE als Marktproduzenten und als Produzenten für die Eigenverwendung gibt es keine Nichtmarktproduktion. Ihre Produktion kann damit nur als Marktproduktion oder als Produktion für die Eigenverwendung erfasst und entsprechend bewertet werden (siehe Nummern 3.42 bis 3.53). |
|
3.39 |
Örtliche FE, die Nichtmarktproduzenten sind, können als Nebenproduktion auch Marktproduktion und Produktion für die Eigenverwendung haben. Die Produktion für die Eigenverwendung besteht aus selbsterstellten Investitionen. Ob Marktproduktion vorliegt, sollte im Prinzip unter Anwendung der qualitativen und quantitativen Markt-Nichtmarkt-Kriterien auf die einzelnen Güter festgestellt werden. Eine sekundäre Marktproduktion eines Nichtmarktproduzenten könnte zum Beispiel vorkommen, wenn staatliche Krankenhäuser für einen Teil ihrer Dienstleistungen wirtschaftlich signifikante Preise in Rechnung stellen. |
|
3.40 |
Weitere Beispiele sind der Verkauf von Reproduktionen durch staatliche Museen und der Verkauf von Wettervorhersagen durch meteorologische Institute. |
|
3.41 |
Nichtmarktproduzenten können auch Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Nichtmarktproduktion zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen haben, zum Beispiel Einnahmen des Museums aus dem Verkauf von Eintrittskarten. Letztere betreffen die Nichtmarktproduktion. Wenn jedoch die Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten von Einnahmen (Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Postern und Postkarten) schwierig ist, können sie beide entweder als Einnahmen aus Marktproduktion oder Einnahmen aus Nichtmarktproduktion behandelt werden. Die Entscheidung für die eine oder die andere Erfassungsalternative sollte man von der relativen Bedeutung abhängig machen, die man den beiden Einnahmearten zumisst (Verkauf von Eintrittskarten im Verhältnis zum Verkauf von Postern und Postkarten). |
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Produktion
|
3.42 |
Die Produktion ist dann zu buchen und zu bewerten, wenn sie im Produktionsprozess entsteht. |
|
3.43 |
Die gesamte Produktion wird zu Herstellungspreisen bewertet, wobei jedoch besondere Vereinbarungen gelten für:
|
|
3.44 |
Definition: Der Herstellungspreis ist der Betrag, den der Produzent je Einheit der von ihm produzierten Waren und Dienstleistungen vom Käufer erhält ohne die auf die produzierten oder verkauften Güter zu zahlenden Steuern (Gütersteuern), zuzüglich aller empfangenen Subventionen (Gütersubventionen), die auf die produzierten oder verkauften Güter gewährt werden. Vom Produzenten getrennt in Rechnung gestellte Transportkosten rechnen nicht dazu. Erwartete und unerwartete Umbewertungsgewinne oder -verluste auf finanzielle und nichtfinanzielle Aktiva gehören ebenfalls nicht dazu. |
|
3.45 |
Die Produktion für die Eigenverwendung (P.12) ist zu den Herstellungspreisen vergleichbarer, auf dem Markt verkaufter Güter zu bewerten. Daher entsteht im Zusammenhang mit dieser Produktion ein Nettobetriebsüberschuss oder ein Selbständigeneinkommen. Ein Beispiel dafür sind Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohnungsbesitz, die einen Nettobetriebsüberschuss erzeugen. Falls Herstellungspreise vergleichbarer Güter nicht verfügbar sind, ist die Produktion für die Eigenverwendung anhand der Produktionskosten zuzüglich eines Aufschlags (außer für Nichtmarktproduzenten) für den Nettobetriebsüberschuss oder das Selbständigeneinkommen zu bewerten. |
|
3.46 |
Zugänge an unfertigen Erzeugnissen werden zum gegenwärtigen Herstellungspreis des Fertigerzeugnisses bewertet. |
|
3.47 |
Um den Wert der als unfertige Erzeugnisse behandelten Produktion im Voraus zu schätzen, werden die tatsächlich angefallenen Kosten zuzüglich eines Gewinnaufschlags (außer für Nichtmarktproduzenten) für den geschätzten Betriebsüberschuss oder Selbständigeneinkommen zur Bewertung verwendet. Diese vorläufigen Schätzungen werden später korrigiert, wenn der Preis der Fertigerzeugnisse für den Arbeitszeitraum bekannt ist. Der Wert aller Fertigerzeugnisse umschließt:
|
|
3.48 |
Der Wert angefangener Bauten sollte anhand der aufgelaufenen Kosten bestimmt werden, und zwar einschließlich eines Gewinnzuschlags für Bruttobetriebsüberschuss oder Selbständigeneinkommen. Dieser Gewinnzuschlag ergibt sich in Anlehnung an die Preise vergleichbarer Bauten. Auch Abschlagszahlungen des Käufers entsprechend dem Baufortschritt können Anhaltspunkte zur Bewertung geben, jedoch ohne Vorauszahlungen und Zahlungsrückstände. Werden angefangene selbsterrichtete Bauten während eines Rechnungszeitraums nicht fertiggestellt, so wird der Produktionswert anhand folgender Methode geschätzt. Das Verhältnis von aufgelaufenen Kosten während des laufenden Zeitraums zu Gesamtkosten des fertigen Bauwerks wird berechnet. Dieses Verhältnis wird auf den geschätzten Produktionswert zum gegenwärtigen Herstellungspreis angewandt. Wenn der Herstellungspreis nicht geschätzt werden kann, sind die gesamten Produktionskosten zuzüglich eines Aufschlags (außer für Nichtmarktproduzenten) für den Nettobetriebsüberschuss oder das Selbständigeneinkommen heranzuziehen. Werden die Arbeitsleistungen am Bauwerk unentgeltlich erbracht, wie etwa bei gemeinschaftlich von privaten Haushalten errichteten Bauten, so wird eine Schätzung des Wertes der Arbeitsleistungen anhand von Stundenlöhnen für ähnliche Arbeitsleistungen in den geschätzten Herstellungspreis einbezogen. |
|
3.49 |
Der Produktionswert eines Nichtmarktproduzenten (einer örtlichen FE) wird anhand der gesamten Produktionskosten bestimmt, d. h. anhand der Summe aus:
Zinszahlungen (ausgenommen unterstellte Bankdienstleistungen (FISIM)) gehen nicht in die Kosten der Nichtmarktproduktion ein. Die Kosten der Nichtmarktproduktion umschließen auch keinen unterstellten Netto-Kapitalertrag und keinen unterstellten Mietwert für die bei der Nichtmarktproduktion genutzten eigenen Nichtwohngebäude. |
|
3.50 |
Der Produktionswert einer institutionellen Einheit ist die Summe der Produktionswerte ihrer örtlichen FE. Dies gilt auch für institutionelle Einheiten, die Nichtmarktproduzenten sind. |
|
3.51 |
Wenn bei Nichtmarktproduzenten keine sekundäre Marktproduktion vorhanden ist, wird die Nichtmarktproduktion zu Produktionskosten bewertet. Ist bei Nichtmarktproduzenten sekundäre Marktproduktion vorhanden, so ist die Nichtmarktproduktion als Restposten, d. h. als Gesamtproduktionskosten abzüglich ihrer Einnahmen aus Marktproduktion zu ermitteln. |
|
3.52 |
Die Marktproduktion von Nichtmarktproduzenten wird zu Herstellungspreisen bewertet. Die gesamte Produktion einer örtlichen FE als Nichtmarktproduzent einschließlich Marktproduktion, Produktion für die Eigenverwendung und Nichtmarktproduktion wird anhand der Summe der Produktionskosten bewertet. Der Wert der Marktproduktion ergibt sich aus den Umsatzerlösen aus marktbestimmten Gütern. Der Wert der Nichtmarktproduktion wird als Differenz zwischen dem Produktionswert insgesamt und der Summe der Marktproduktion sowie der Produktion für die Eigenverwendung ermittelt. Einnahmen aus dem Verkauf von Nichtmarkgütern gegen wirtschaftlich nicht signifikante Preise werden bei diesen Berechnungen nicht berücksichtigt — sie sind Teil der Nichtmarktproduktion. |
|
3.53 |
Im Folgenden werden einige Ausnahmen und Erklärungen zu Buchungszeitpunkt und Bewertung bestimmter Waren und Dienstleistungen in der Reihenfolge der CPA-Codes gegeben. |
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (Teil A)
|
3.54 |
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird so gebucht, als würden sie kontinuierlich über die gesamte Wachstumszeit produziert (nicht nur zur Erntezeit pflanzlicher bzw. zur Schlachtzeit tierischer Erzeugnisse). Getreide auf dem Halm, Holz auf dem Stamm und für Nahrungszwecke aufgezogene Fisch- bzw. Tierbestände werden während der Wachstumsphase als Vorräte an unfertigen Erzeugnissen und danach als Vorräte an Fertigerzeugnissen behandelt. Die Erzeugung umschließt keine Veränderungen freier Tier- und Pflanzenbestände, z. B. beim natürlichen Wachstum von Tieren und Vögeln, von frei lebenden Fischbeständen oder beim nichtkultivierten Wachstum von Wäldern. |
Hergestellte Waren (Teil C); Gebäude und Bauarbeiten (Teil F)
|
3.55 |
Wenn die Errichtung eines Gebäudes oder eines sonstigen Bauwerks sich über mehrere Rechnungszeiträume erstreckt, so wird die in jedem Zeitraum erzeugte Produktion so behandelt, als würde sie zum Ende des jeweiligen Zeitraums an den Käufer veräußert, d. h. sie wird als Anlageinvestition des Käufers verbucht und nicht als unfertiges Erzeugnis im Baugewerbe. Die Produktion wird als in Etappen an den Käufer verkauft betrachtet. Sind im Vertrag Abschlagszahlungen vorgesehen, so kann der Produktionswert anhand des Wertes der in jedem Zeitraum vorgenommenen etappenweisen Zahlungen geschätzt werden. Wenn der Käufer nicht sicher zu ermitteln ist, so wird die in jedem Zeitraum erzeugte unvollendete Produktion als unfertiges Erzeugnis gebucht. |
Handelsleistungen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen (Teil G)
|
3.56 |
Die Produktion von Leistungen des Groß- und Einzelhandels wird anhand der Handelsspannen gemessen, die beim Weiterverkauf der Handelsware erzielt werden. Definition: Eine Handelsspanne ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen oder unterstellten Verkaufspreis, der mit einer für den Weiterverkauf erworbenen Ware (Handelsware) erzielt wird, und dem Preis, der vom Händler gezahlt werden müsste, um die Handelsware zum Zeitpunkt ihres Verkaufs oder ihrer anderweitigen Veräußerung wiederzubeschaffen. Die Handelsspannen einiger Waren können negativ sein, wenn Preisabschläge vorgenommen werden. Bei Waren, die weggeworfen oder gestohlen werden, sind die Handelsspannen ebenfalls negativ. Die Handelsspannen von Waren, die als Naturaleinkommen an Arbeitnehmer abgegeben werden oder die für den eigenen Konsum von den Besitzern entnommen werden, sind gleich Null. Umbewertungsgewinne und -verluste sind nicht in der Handelsspanne enthalten. Die Produktion eines Groß- oder Einzelhändlers wird wie folgt bestimmt:
|
Verkehrs- und Lagereileistungen (Teil H)
|
3.57 |
Die Produktion von Verkehrsdienstleistungen wird in Höhe der für die Beförderung von Waren oder Personen zu zahlenden Beträge gemessen. Die Beförderung eigener Waren in den örtlichen FE (Werksverkehr) wird als Hilfstätigkeit betrachtet und nicht gesondert ausgewiesen. |
|
3.58 |
Lagereileistungen werden wie Weiterverarbeitungsproduktion an unfertigen Erzeugnissen gemessen. Preissteigerungen bei Warenvorräten sollten nicht als unfertige Erzeugnisse und Produktion, sondern als Umbewertungsgewinne behandelt werden. Spiegelt der Wertzuwachs einen Preisanstieg ohne Änderung der Qualität wider, so gibt es in dem betreffenden Zeitraum neben den Lagerkosten oder dem ausdrücklichen Kauf zur Erbringung einer Lagereileistung keine weitere Produktion. In drei Fällen wird der Wertzuwachs allerdings als Produktion angesehen:
|
|
3.59 |
Die meisten Preisveränderungen von Warenvorräten werden nicht als Weiterverarbeitungsproduktion an unfertigen Erzeugnissen behandelt. Um die über die Lagerkosten hinausgehende Wertsteigerung der Waren zu schätzen, kann die erwartete Wertsteigerung über die allgemeine Inflationsrate hinaus für einen vorher festgelegten Zeitraum herangezogen werden. Alle Gewinne außerhalb des vorher festgelegten Zeitraums werden weiterhin als Umbewertungsgewinn oder –verlust verbucht. Lagereileistungen umschließen keine Preisveränderungen aufgrund von finanziellen Vermögenswerten, Wertsachen oder anderem Sachvermögen wie Land oder Gebäude. |
|
3.60 |
Die Produktion von Reisebüroleistungen wird als der Wert des Dienstleistungsentgelts der Büros (Gebühren oder Provisionen) gemessen und nicht anhand der vollen Ausgaben der Reisenden im Reisebüro, einschließlich von Dritten erhobene Beförderungsentgelte. |
|
3.61 |
Die Dienstleistungsproduktion von Reiseveranstaltern wird anhand der vollen Beträge gemessen, die die Reisenden dem Reiseveranstalter zahlen. |
|
3.62 |
Der Unterschied zwischen den Dienstleistungen von Reisebüros und den von Reiseveranstaltern besteht darin, dass Dienstleistungen von Reisebüros lediglich Vermittlungsleistungen für den Reisenden sind, während mit den Dienstleistungen von Reiseveranstaltern ein neues Produkt geschaffen wird, nämlich eine Reise, die aus mehreren Komponenten besteht (Fahrt, Unterbringung, Unterhaltung). |
Beherbergung und Gastronomiedienstleistungen (Teil I)
|
3.63 |
Der Wert der Dienstleistungsproduktion von Hotels und Gaststätten schließt den Wert der dort verzehrten Speisen, Getränke usw. ein. |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Teil K): Produktion der Zentralbank
Die Zentralbank erbringt folgende Dienstleistungen:
|
a) |
Geldpolitik |
|
b) |
Finanzielle Mittlertätigkeit |
|
c) |
die Aufsicht über finanzielle Kapitalgesellschaften |
Die Produktion der Zentralbank wird als Summe ihrer Kosten gemessen.
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Teil K): Finanzdienstleistungen allgemein
Finanzdienstleitungen umfassen Folgendes:
|
a) |
die finanzielle Mittlertätigkeit (einschließlich Dienstleistungen von Versicherungen und Alterssicherungssystemen), |
|
b) |
Dienstleistungen des Kredit- und Versicherungshilfsgewerbes, |
|
c) |
sonstige Finanzdienstleistungen. |
|
3.64 |
Die finanzielle Mittlertätigkeit beinhaltet das Finanzrisikomanagement und die Umwandlung von Liquidität in begebbare Vermögenswerte. Gesellschaften, die diese Tätigkeiten ausüben, erhalten Mittel, beispielsweise durch Einlagen und auch durch Ausgabe von Wechseln, Anleihen und anderen Wertpapieren. Die Gesellschaften nutzen diese Mittel sowie Eigenmittel zum Erwerb von Forderungen durch die Vergabe von Krediten an Dritte und durch Ankauf von Wechseln, Anleihen und anderen Wertpapieren. Die finanzielle Mittlertätigkeit schließt Dienstleistungen von Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen ein. |
|
3.65 |
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten erleichtern das Finanzrisikomanagement und die Umwandlung von Liquidität in begebbare Vermögenswerte. Unternehmen, die Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten ausüben, werden im Namen anderer Einheiten tätig und übernehmen selbst keine Risiken durch den Erwerb finanzieller Aktiva oder das Eingehen von Verbindlichkeiten im Rahmen einer Mittlertätigkeit. |
|
3.66 |
Zu den sonstigen Finanzdienstleistungen zählen Aufsichtstätigkeiten (z. B. Überwachung des Aktien- und Anleihenmarktes), Sicherheitsdienstleistungen für Kunden (z. B. Depots für Schmuck und wichtige Unterlagen) und Handelsdienstleistungen (z. B. Devisen- und Wertpapierhandel). |
|
3.67 |
Finanzdienstleistungen werden fast ausschließlich von Finanzinstituten erbracht, weil diese Dienstleistungen streng überwacht werden. Möchte beispielsweise ein Einzelhändler seinen Kunden Kredite anbieten, so werden die Kreditfazilitäten normalerweise von einem Finanzinstitut, das eine Tochtergesellschaft des Einzelhändlers ist, oder einem anderen spezialisierten Finanzinstitut angeboten. |
|
3.68 |
Finanzdienstleistungen können direkt oder indirekt bezahlt werden. Für einige Transaktionen mit finanziellen Aktiva können sowohl direkte als auch indirekte Gebühren erhoben werden. Finanzdienstleistungen werden hauptsächlich auf vier Arten erbracht und in Rechnung gestellt:
|
Finanzdienstleistungen, die für direkte Entgelte erbracht werden
|
3.69 |
Diese Finanzdienstleistungen sind Gegenleistungen für direkte Entgelte und umfassen ein breites Spektrum von Dienstleistungen, die von unterschiedlichen Arten von Finanzinstituten erbracht werden können. Die folgenden Beispiele zeigen, welche Dienstleistungen für direkte Entgelte erbracht werden:
|
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung von Zinsen
|
3.70 |
So akzeptiert etwa bei finanziellen Mittlerdiensten ein Finanzinstitut, z. B. eine Bank, Einlagen von Einheiten, die Zinsen für Mittel erhalten möchten, die die Einheit nicht unmittelbar benötigt und die sie anderen Einheiten leiht, deren Mittel wiederum zur Deckung ihrer Bedürfnisse nicht ausreichen. Die Bank stellt also einen Mechanismus zur Verfügung, der es der ersten Einheit ermöglicht, der zweiten Einheit Mittel zu leihen. Jede der beiden Parteien entrichtet eine Gebühr für die erbrachte Dienstleistung an die Bank. Die Einheit, die Mittel verleiht, zahlt, indem sie einen unter dem „Referenzzinssatz“ liegenden Zinssatz akzeptiert, während die Einheit, die Mittel leiht, zahlt, indem sie einen Zinssatz akzeptiert, der über dem „Referenzzinssatz“ liegt. Die Differenz zwischen dem Zinssatz, den die Kreditnehmer an die Bank zahlen und dem Zinssatz, den die Einleger erhalten, ist daher eine Gebühr für FISIM. |
|
3.71 |
Es kommt selten vor, dass der Betrag der von einer Finanzinstitution verliehenen Mittel exakt dem Betrag der Einlagen entspricht. Manche Beträge wurden vielleicht als Einlage eingezahlt, aber noch nicht verliehen. Manche Darlehen werden möglicherweise aus den Eigenmitteln der Bank und nicht aus geliehenen Mitteln finanziert. Unabhängig von der Mittelquelle wird eine Dienstleistung im Zusammenhang mit den angebotenen Darlehen und Einlagen erbracht. Eine Gebühr für FISIM wird unterstellt. Diese indirekten Gebühren beziehen sich nur auf Darlehen und Einlagen, die von Finanzinstituten zur Verfügung gestellt bzw. dort eingezahlt werden. |
|
3.72 |
Der Referenzzinssatz liegt zwischen den Bankzinssätzen für Kredite und Einlagen. Er wird jedoch nicht als arithmetischer Mittelwert der Sätze für Kredite oder Einlagen gebildet. Der für Interbankkredite geltende Satz ist geeignet. Für die einzelnen Währungen, auf die Darlehen und Einlagen lauten, sind jedoch verschiedene Referenzzinssätze erforderlich, insbesondere bei Beteiligung eines nicht gebietsansässigen Finanzinstituts. FISIM werden in Kapitel 14 näher beschrieben. |
Finanzdienstleistungen bestehend aus dem Erwerb und der Veräußerung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf den Finanzmärkten
|
3.73 |
Wenn ein Finanzinstitut ein Wertpapier (z. B. Wechsel oder Anleihe) zum Verkauf anbietet, wird eine Servicegebühr erhoben. Der Verkaufspreis (der Ausgabepreis) entspricht dem geschätzten Marktwert des Wertpapiers zuzüglich einer Spanne. Eine weitere Gebühr wird bei Verkauf eines Wertpapiers erhoben, da der Preis, der dem Verkäufer angeboten wird (der Rücknahmepreis) dem Marktwert abzüglich einer Spanne entspricht. Spannen zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis gelten auch bei Anteilsrechten, Investmentzertifikaten und Fremdwährungen. Diese Spannen werden als Erbringung von Finanzdienstleistungen behandelt. |
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen und Alterssicherungssystemen; ihre Tätigkeit wird durch Versicherungsbeiträge und Sparerträge finanziert
|
3.74 |
Hierzu gehören folgende Finanzdienstleistungen. Jede resultiert in der Umverteilung finanzieller Mittel:
|
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens (Teil L)
|
3.75 |
Die Produktion von Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohnungsbesitz wird in der geschätzten Höhe des Mietbetrages bewertet, den ein Mieter für die gleiche Unterkunft zahlen würde, wobei Faktoren wie Lage, Qualität des Wohnumfeldes usw. sowie Größe und Qualität der Wohnung selbst zu berücksichtigen sind. Bei von Wohnungen getrennt gelegenen Garagen, die vom Eigentümer im Zusammenhang mit der Wohnungsnutzung für Zwecke des eigenen Konsums genutzt werden, ist eine ähnliche Unterstellung vorzunehmen. Der Mietwert von eigengenutzten Wohnungen im Ausland, zum Beispiel von Ferienhäusern, wird nicht als Teil der Inlandsproduktion, sondern als Import von Dienstleistungen aus der übrigen Welt und der entsprechende Nettobetriebsüberschuss als aus der übrigen Welt erhaltenes Primäreinkommen gebucht. Für eigengenutzte Wohnungen, deren Eigentümer Gebietsfremde sind, werden entsprechende Buchungen vorgenommen. Im Fall von Time-Sharing-Wohnungen wird ein Anteil des Dienstleistungsentgelts gebucht. |
|
3.76 |
Zur Schätzung des Wertes der von Eigentümerwohnungen erbrachten Dienstleistungen wird die Schichtungsmethode herangezogen. Der Wohnungsbestand wird nach Wohnumfeld, Art der Wohnung und anderen Faktoren, die die Höhe der Miete beeinflussen, geschichtet. Daten über die tatsächlichen Wohnungsmieten werden genutzt, um den Mietwert des gesamten Wohnungsbestandes zu ermitteln. Die durchschnittliche tatsächliche Miete je Schicht wird mit allen Wohnungen in der jeweiligen Schicht kombiniert. Falls die Daten über Wohnungsmieten aus Stichprobenerhebungen stammen, bezieht sich die Hochrechnung des Mietwertes des gesamten Wohnungsbestands sowohl auf einen Teil der Mietwohnungen als auch auf sämtliche Eigentümerwohnungen. Die detaillierte Berechnung von Schichtenmieten erfolgt üblicherweise für ein Basisjahr und wird dann für spätere Zeitabschnitte fortgeschrieben. |
|
3.77 |
Die Miete, die bei der Schichtungsmethode auf Eigentümerwohnungen entfällt, ist definiert als die Miete, die auf dem privaten Wohnungsmarkt für das Recht auf Nutzung einer unmöblierten Wohnung fällig ist. Zur Ermittlung der unterstellten Mieten werden die Mieten für unmöblierte Wohnungen aus allen Verträgen des privaten Wohnungsmarkts herangezogen. Auch Mieten des privaten Wohnungsmarkts, die durch regulative Eingriffe der Regierung niedrig gehalten werden, werden berücksichtigt. Falls die Daten von den Mietern stammen, werden die erhobenen Mieten um die spezifischen Mietzuschüsse erhöht, die direkt an die Vermieter gezahlt werden. Ist der beschriebene Stichprobenumfang für die erhobenen Mieten nicht groß genug, können zur Hochrechnung auch die für möblierte Wohnungen erhobenen Mieten verwendet werden, sofern sie um das Entgelt für die Nutzung des Mobiliars bereinigt wurden. Ausnahmsweise können auch erhöhte Mieten für staatliche Wohnungen herangezogen werden. Verbilligte Mieten für Wohnungen, die Verwandten oder Arbeitnehmern überlassen werden, sollten unberücksichtigt bleiben. |
|
3.78 |
Die Schichtungsmethode dient dazu, auf alle Mietwohnungen hochzurechnen. Die Durchschnittsmiete für die vorstehende Hochrechnung auf Eigentümerwohnungen kann bei einigen Segmenten des Mietmarkts unzulässig sein. So sind beispielsweise verminderte Mieten für möblierte Wohnungen oder erhöhte Mieten für staatliche Wohnungen ungeeignet für die Berechnung der jeweils tatsächlich vermieteten Wohnungen. In diesem Fall müssen tatsächlich vermietete, möblierte Wohnungen oder Sozialwohnungen getrennt geschichtet und mit geeigneten Durchschnittsmieten kombiniert werden. |
|
3.79 |
Wenn der Mietwohnungsmarkt nicht groß genug ist, um für Eigentümerwohnungen repräsentativ zu sein, wird die Nutzerkostenmethode auf Eigentümerwohnungen angewandt. Bei der Nutzerkostenmethode ergibt sich der Produktionswert der Wohnungsdienstleistungen aus der Summe von Vorleistungen, Abschreibungen, sonstigen Produktionsabgaben abzüglich sonstiger Subventionen und Nettobetriebsüberschuss. Um den Nettobetriebsüberschuss zu erhalten, ist eine konstante reale Jahresertragsrate auf den Nettowert des eigengenutzten Wohnungsbestands zu jeweiligen Preisen (Wiederbeschaffungspreis) anzuwenden. |
|
3.80 |
Die Produktion von Immobiliendienstleistungen im Zusammenhang mit Nichtwohngebäuden ist in Höhe der fälligen Miete zu messen. |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (Teil M); Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (Teil N)
|
3.81 |
Die Dienstleistungsproduktion des Operating-Leasing (z. B. Vermietung beweglicher Anlagegüter) wird in Höhe des entrichteten Mietbetrages gemessen. Operating-Leasing ist klar vom Finanzierungsleasing zu unterscheiden: Beim Finanzierungsleasing handelt es sich um eine Methode zur Finanzierung des Erwerbs von Anlagegütern, indem der Leasingnehmer vom Leasinggeber einen Kredit erhält. Beim Finanzierungsleasing bestehen die Leasingeinnahmen aus Tilgungen und Zinszahlungen, wobei ein geringes Entgelt für erbrachte Dienstleistungen erhoben wird (siehe Kapitel 15: Nutzungsrechte). |
|
3.82 |
Forschung und Entwicklung (F&E) sind kreative Tätigkeiten, die systematisch durchgeführt werden, um Kenntnisse zu erweitern und diese Kenntnisse für die Entdeckung oder Entwicklung neuer Produkte, einschließlich verbesserter Versionen oder Merkmale vorhandener Produkte, oder für die Entdeckung oder Entwicklung neuer oder effizienterer Produktionsverfahren einzusetzen. F&E-Tätigkeiten von signifikantem Umfang (im Verhältnis zur Haupttätigkeit) werden als Nebentätigkeit der örtlichen FE verbucht. Soweit möglich, wird für F&E eine getrennte örtliche FE berücksichtigt. |
|
3.83 |
Die Dienstleistungsproduktion der F&E wird wie folgt gemessen:
Ausgaben für F&E werden von den Ausgaben für Bildung und Ausbildung getrennt erfasst. Ausgaben für F&E enthalten nicht die Kosten für die in Haupt- oder Nebentätigkeit entwickelte Software. |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung (Teil O)
|
3.84 |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der gesetzlichen Sozialversicherung sind Nichtmarktproduktion und entsprechend zu messen. |
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen (Teil P); Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens (Teil Q)
|
3.85 |
Bei Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen wird klar zwischen Marktproduzenten und Nichtmarktproduzenten und zwischen ihrer Markt- und Nichtmarktproduktion unterschieden. Für einige Formen der Ausbildung und der medizinischen Behandlung können staatliche Einrichtungen (oder andere Einrichtungen infolge spezieller Subventionen) geringe symbolische Gebühren erheben, während sie für andere Ausbildungsmaßnahmen und spezielle medizinische Behandlungen gewerbliche Tarife berechnen. Ein ähnliches Beispiel ist, dass gleiche Dienstleistungen (z. B. die Hochschulbildung) zum einen vom Staat und zum anderen von gewerblichen Einrichtungen erbracht werden. Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen schließen F&E-Leistungen nicht ein; Gesundheitsleistungen schließen Ausbildungsleistungen (etwa an Universitätskliniken) nicht ein. |
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen (Teil R); Sonstige Dienstleistungen (Teil S)
|
3.86 |
Bei der Produktion von Büchern, Tonaufnahmen, Filmen, Software, Musikbändern, Schallplatten usw. sind zwei Phasen zu unterscheiden:
|
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen (Teil T)
|
3.87 |
Der Produktionswert häuslicher Dienste wird anhand des an bezahlte Hausangestellte geleisteten Arbeitnehmerentgelts gemessen. Dieses umschließt Naturaleinkommen, wie unentgeltliche Verpflegung und Unterkunft |
VORLEISTUNGEN (P.2)
|
3.88 |
Definition: Die Vorleistungen umfassen die im Produktionsprozess verbrauchten, verarbeiteten oder umgewandelten Waren und Dienstleistungen. Nicht dazu gehört die Nutzung von Anlagegütern, die anhand der Abschreibungen gemessen wird. |
|
3.89 |
Folgende Fälle sind in den Vorleistungen enthalten:
|
|
3.90 |
Die Vorleistungen enthalten nicht:
|
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Vorleistungen
|
3.91 |
Als Vorleistungen verwendete Güter werden zu dem Zeitpunkt gebucht und bewertet, zu dem sie in den Produktionsprozess eingehen. Sie werden zu den Anschaffungspreisen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen bewertet, die zum Zeitpunkt der Verwendung gelten. |
|
3.92 |
Produzierende Einheiten buchen die Verwendung der Waren im Produktionsprozess nicht direkt. Vielmehr buchen sie die Käufe von Vorleistungsgütern abzüglich ihrer Vorratsveränderung. |
KONSUM (P.3, P.4)
|
3.93 |
Es werden zwei Konsumkonzepte unterschieden:
Die Konsumausgaben sind die Ausgaben für Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten, privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und vom Staat zur Deckung des individuellen und kollektiven Bedarfs verwendet werden. Dagegen bezieht sich der Konsum nach dem Verbrauchskonzept auf die Konsumgüter, die der Sektor insgesamt für den Verbrauch erhalten hat. Der Unterschied zwischen beiden Konzepten betrifft die Zuordnung der Waren und Dienstleistungen, die vom Staat oder von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck finanziert, aber privaten Haushalten als soziale Sachtransfers unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. |
Konsumausgaben (P.3)
|
3.94 |
Definition: Konsumausgaben sind die Ausgaben gebietsansässiger institutioneller Einheiten für Waren und Dienstleistungen, die zur unmittelbaren Befriedigung individueller Bedürfnisse und Wünsche oder kollektiver Bedürfnisse der Allgemeinheit verwendet werden. |
|
3.95 |
Zu den Konsumausgaben der privaten Haushalte gehören folgende Beispiele:
|
|
3.96 |
In den Konsumausgaben der privaten Haushalte sind nicht enthalten:
|
|
3.97 |
Die Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck enthalten zwei Kategorien:
|
|
3.98 |
Die Konsumausgaben (P.3) des Staates enthalten die gleichen Kategorien:
|
|
3.99 |
Kapitalgesellschaften haben keine Konsumausgaben. Wenn sie Waren und Dienstleistungen kaufen, wie diese von den Haushalten für deren Konsumausgaben verwendet werden, zählen diese zu den Vorleistungen oder zu den Naturallöhnen; im letzten Fall werden die Güter als unterstellte Konsumausgaben der privaten Haushalte ausgewiesen. |
Konsum nach dem Verbrauchskonzept (P.4)
|
3.100 |
Definition: Der Konsum nach dem Verbrauchskonzept umfasst die Güter, die von gebietsansässigen institutionellen Einheiten zur unmittelbaren Befriedigung individueller oder kollektiver Bedürfnisse erworben werden. |
|
3.101 |
Definition: Der Individualkonsum umfasst die von privaten Haushalten empfangenen Güter, die der Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder der inländischen privaten Haushalte unmittelbar dienen. Diese Güter haben folgende Merkmale:
|
|
3.102 |
Definition: Der Kollektivkonsum umfasst die „kollektiven Dienstleistungen“, die allen Mitgliedern der Bevölkerung oder allen Angehörigen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, beispielsweise allen privaten Haushalten einer bestimmten Region, gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Kollektive Dienstleistungen haben folgende Merkmale:
|
|
3.103 |
Die gesamten Konsumausgaben der privaten Haushalte sind Teil des Individualkonsums. Auch die Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck zählen vollständig zum Individualkonsum. |
|
3.104 |
Die Konsumausgaben des Staates werden auf der Grundlage der Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates (COFOG) in individualisierbare und kollektive Güter eingeteilt. Die Konsumausgaben des Staates folgender COFOG-Positionen zählen zum Individualkonsum:
|
|
3.105 |
Legt man die Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualkonsums (Coicop) zugrunde, so entsprechen die Ausgaben des Staates für den Individualkonsum Abteilung 14, die folgende Gruppen umfasst:
|
|
3.106 |
Die Ausgaben für den Kollektivkonsum sind die restlichen Konsumausgaben des Staates. Sie bestehen aus den folgenden COFOG-Gruppen:
|
|
3.107 |
Die Zusammenhänge zwischen dem Ausgaben- und dem Verbrauchskonzept sind in Tabelle 3.2 ausgewiesen: Tabelle 3.2 — Ausgaben
|
|||||||||||||||||||||||||
|
3.108 |
Die Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck sind vollständig Individualkonsum. Der gesamte Konsum nach dem Verbrauchskonzept ist gleich der Summe aus Individualkonsum (der privaten Haushalte) und Kollektivkonsum (des Staates). |
|
3.109 |
Es gibt keine sozialen Sachleistungen mit der übrigen Welt (obwohl es entsprechende Geldtransfers gibt). Der gesamte Konsum nach dem Verbrauchskonzept ist gleich den gesamten Konsumausgaben nach dem Ausgabenkonzept. |
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Konsumausgaben
|
3.110 |
Die Ausgaben für eine Ware werden zum Zeitpunkt des Eigentümerwechsels und die Ausgaben für eine Dienstleistung werden zum Zeitpunkt der vollständigen Erbringung der Dienstleistung gebucht. |
|
3.111 |
Bei Ratenkauf und ähnlichen Kreditfinanzierungen (ebenso wie bei Finanzierungsleasing) werden die Ausgaben zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren gebucht, auch wenn der Eigentumswechsel zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattfindet. |
|
3.112 |
Der Konsum selbstproduzierter Erzeugnisse wird zum Produktionszeitpunkt ausgewiesen. |
|
3.113 |
Die Konsumausgaben der privaten Haushalte werden zu Anschaffungspreisen gebucht. Dabei handelt es sich um den Preis, den der Käufer zum Zeitpunkt der Anschaffung für die Güter tatsächlich bezahlt. Eine ausführlichere Definition findet sich unter 3.06. |
|
3.114 |
Die Güter, die als Naturaleinkommen den Arbeitnehmern als Lohnbestandteil zur Verfügung gestellt werden, werden zu Herstellungspreisen bewertet, wenn sie vom Arbeitgeber erzeugt wurden, und zu den Anschaffungspreisen des Arbeitgebers, wenn sie von ihm angekauft wurden. |
|
3.115 |
Für den Konsum entnommene selbstproduzierte Güter werden zu Herstellungspreisen bewertet. |
|
3.116 |
Konsumausgaben des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck werden, soweit die Güter selbst erzeugt wurden, zum Zeitpunkt ihrer Produktion gebucht, der zugleich der Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Güter durch den Staat oder die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck ist. Bei Ausgaben für Güter, die direkt von den Marktproduzenten an die Endverbraucher geliefert werden, gilt die Lieferung als Buchungszeitpunkt. |
|
3.117 |
Die Konsumausgaben (P.3) des Staates oder der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck umfassen ihre eigene Produktion (P.1) und die Ausgaben für Güter, die von Marktproduzenten direkt an private Haushalte geliefert werden - sie sind Teil der sozialen Sachleistungen (D.632) - abzüglich der Einnahmen aus Verkäufen an andere Einheiten - Marktproduktion (P.11) und Zahlungen für Nichtmarktproduktion (P.131) - und abzüglich der selbsterstellten Anlagen (P.12). |
Buchungszeitpunkt und Bewertung des Konsums nach dem Verbrauchskonzept
|
3.118 |
Güter werden von institutionellen Einheiten zu dem Zeitpunkt bezogen, zu dem sie Eigentümer werden und wenn die Dienstleistungen erbracht werden. |
|
3.119 |
Für den Endverbrauch bezogene Konsumgüter werden zu den Anschaffungspreisen der Einheiten bewertet, die die Güter gekauft haben. |
|
3.120 |
Sachleistungen, die keine sozialen Sachleistungen vom Staat oder von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck sind, werden wie Geldtransfers behandelt. Folglich werden die Güter in den Ausgaben der institutionellen Einheiten oder Sektoren gebucht, die die Güter letztlich erhalten. |
|
3.121 |
Die Gesamtgrößen des Konsums sind nach dem Ausgabenkonzept und nach dem Verbrauchskonzept gleich groß. Die den privaten Haushalten durch soziale Sachleistungen bereitgestellten Güter werden zu den gleichen Preisen bewertet wie nach dem Ausgabenkonzept. |
BRUTTOINVESTITIONEN (P.5)
|
3.122 |
Zu den Bruttoinvestitionen gehören:
|
|
3.123 |
Brutto bedeutet vor Abzug der Abschreibungen. Die Nettoinvestitionen sind die Bruttoinvestitionen abzüglich der Abschreibungen. |
Bruttoanlageinvestitionen (P.51g)
|
3.124 |
Definition:Die Bruttoanlageinvestitionen (P.51) umfassen den Erwerb abzüglich der Veräußerungen von Anlagegütern durch gebietsansässige Produzenten in einem Zeitraum zuzüglich gewisser Werterhöhungen an nichtproduzierten Vermögensgütern durch produktive Tätigkeiten von Produzenten oder institutionellen Einheiten. Zu den Anlagegütern zählen produzierte Güter, die länger als ein Jahr in der Produktion eingesetzt werden. |
|
3.125 |
Bruttoanlageinvestitionen ergeben sich aus Zugängen und Abgängen:
|
|
3.126 |
Zu den Veräußerungen von Anlagegütern zählen nicht:
|
|
3.127 |
Folgende Arten von Bruttoanlageinvestitionen werden unterschieden:
|
|
3.128 |
Zu den erheblichen Bodenverbesserungen gehören:
Diese Tätigkeiten können zur Schaffung bedeutender neuer Bauten, wie Dämmen, Hochwassersperren und Staumauern, führen, die allerdings nicht zur Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden, sondern den Grund und Boden verbessern und Grund und Boden werden als nichtproduziertem Vermögensgut in der Produktion eingesetzt. Ein Staudamm, der zur Erzeugung von Elektrizität gebaut wurde, dient z. B. einem anderen Zweck als ein Damm, der gebaut wurde, um das Meer abzuhalten. Nur der letztgenannte Damm wird als Verbesserung von Grund und Boden ausgewiesen. |
|
3.129 |
Die Bruttoanlageinvestitionen umfassen folgende Grenzfälle:
|
|
3.130 |
Die Bruttoanlageinvestitionen enthalten nicht:
|
|
3.131 |
Bruttoanlageinvestitionen in Form von Verbesserungen an vorhandenen Anlagegütern werden wie der Erwerb von gleichartigen neuen Anlagegütern behandelt. |
|
3.132 |
Geistiges Eigentum ist das Ergebnis von Forschung und Entwicklung, Untersuchung oder Innovation, die zu Wissen führen, dessen Nutzung durch Gesetze oder andere Schutzinstrumente eingeschränkt wird. Beispiele für Güter des geistigen Eigentums sind:
|
|
3.133 |
Die Eigentumsübertragungskosten umfassen beim Käufer von Anlagegütern und nichtproduzierten nicht-finanziellen Vermögensgütern folgende Positionen:
Diese Kosten sind als Bruttoanlageinvestitionen des neuen Eigentümers zu buchen. |
Buchungszeitpunkt und Bewertung von Bruttoanlageinvestitionen
|
3.134 |
Bruttoanlageinvestitionen werden zu dem Zeitpunkt nachgewiesen, zu dem das Eigentum auf die institutionelle Einheit (den Investor) übergeht, die die Anlage in der Produktion nutzen will. Zu dieser Regel gibt es Modifikationen bei:
|
|
3.135 |
Die Bewertung von Bruttoanlageinvestitionen erfolgt zu Anschaffungspreisen einschließlich Montagekosten und anderer Kosten der Eigentumsübertragung. Selbsterstellte Anlagen werden zu Herstellungspreisen vergleichbarer Güter bewertet und, falls solche Preise nicht zur Verfügung stehen, anhand der Produktionskosten zuzüglich eines Aufschlags (außer für Nichtmarktproduzenten) für den Nettobetriebsüberschuss oder das Selbständigeneinkommen. |
|
3.136 |
Der Zugang an geistigem Eigentum wird unterschiedlich bewertet:
|
|
3.137 |
Der Verkauf gebrauchter Anlagegüter wird zum Verkaufspreis bewertet, der die Kosten des Eigentumsübergangs beim Verkäufer nicht umfasst. |
|
3.138 |
Die Kosten des Eigentumsübergangs gelten sowohl für produzierte Vermögensgüter, wozu auch die Anlagegüter zählen, als auch für nichtproduzierte Vermögensgüter, wie Grund und Boden. Bei produzierten Vermögensgütern werden diese Kosten in den Anschaffungswert einbezogen. Im Fall von Grund und Boden sowie sonstigen nichtproduzierten Vermögensgütern werden sie von den Käufen und Verkäufen getrennt und als gesonderte Position bei den Bruttoanlageinvestitionen gebucht. |
Abschreibungen (P.51C)
|
3.139 |
Definition: Abschreibungen (P.51c) messen die Wertminderung von Anlagegütern durch normalen Verschleiß und wirtschaftliches Veralten. Die geschätzte Wertminderung umfasst auch das Risiko von Verlusten von Anlagegütern durch versicherbare Schadensfälle. Abschreibungen decken vorhersehbare Beseitigungs- und Wiederherstellungskosten ab, wie Kosten zur Stilllegung von Kernkraftwerken oder Bohrinseln oder zur Sanierung von Deponien. Diese Beseitigungs- und Wiederherstellungskosten werden als Abschreibungen nach Ablauf der Nutzungsdauer gebucht, d. h. wenn die Beseitigungs- und Wiederherstellungskosten als Bruttoanlageinvestitionen gebucht werden. |
|
3.140 |
Abschreibungen werden auf alle Anlagegüter (außer Tiere) berechnet, einschließlich geistigen Eigentums, erheblicher Bodenverbesserungen sowie Eigentumsübertragungskosten nichtproduzierter Vermögensgüter. |
|
3.141 |
Volkswirtschaftliche Abschreibungen unterscheiden sich von den steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Abschreibungen. Bei den Abschreibungen wird von dem Bestand an Anlagegütern und von der normalen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der einzelnen Güterarten ausgegangen. Zur Berechnung des Bestands an Anlagevermögen wird die Kumulationsmethode (Perpetual-Inventory-Methode) angewandt, wenn direkte Informationen über den Bestand an Anlagegütern fehlen. Der Bestand an Anlagegütern wird zu den Anschaffungspreisen der jeweiligen Berichtsperiode bewertet. |
|
3.142 |
Verluste an Anlagegütern aufgrund von versicherbaren Schadensfällen werden berücksichtigt, indem die durchschnittliche Nutzungsdauer der betreffenden Güter entsprechend verkürzt wird. Für die Volkswirtschaft insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Schadensfälle innerhalb einer Periode gleich oder nahe dem Durchschnitt sind. Für einzelne Einheiten und Gruppen von Einheiten kann der tatsächliche Schadensfall vom durchschnittlichen Schadensfall abweichen. In diesem Fall wird für die Sektoren die Differenz zwischen den tatsächlichen und den durchschnittlichen Verlusten als sonstige reale Veränderung des Vermögens an Anlagegütern gebucht. |
|
3.143 |
Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode berechnet, bei der der Wert des Anlageguts mit einer konstanten Rate über die gesamte Nutzungsdauer abgeschrieben wird. In einigen Fällen wird die geometrische Abschreibungsmethode angewandt, wenn dies aufgrund der Struktur der Wertminderung eines Anlagegutes erforderlich ist. |
|
3.144 |
In einigen Fällen wird die geometrische Abschreibungsmethode verwendet, wenn die Art der Wertminderung eines Anlageguts dies erfordert. |
|
3.145 |
In der Kontenabfolge werden die Abschreibungen unter den einzelnen Kontensalden gebucht, die jeweils brutto und netto ausgewiesen werden. Brutto bedeutet vor Abzug der Abschreibungen und netto nach Abzug der Abschreibungen. |
Vorratsveränderungen (P.52)
|
3.146 |
Definition: Vorratsveränderungen erfassen den Wert der Vorratszugänge abzüglich des Wertes der Abgänge und abzüglich regelmäßiger Verluste vom Vorratsbestand. |
|
3.147 |
Durch Verderb, Schadensfälle oder kleinere Diebstähle können bei Vorräten regelmäßig Verluste auftreten, und zwar Verluste an
|
|
3.148 |
Vorräte setzen sich aus folgenden Kategorien zusammen:
|
Buchungszeitpunkt und Bewertung der Vorratsveränderungen
|
3.149 |
Buchungszeitpunkt und Bewertung von Vorratsveränderungen stimmen mit denen der anderen Gütertransaktionen überein. Derartige Transaktionen sind die Vorleistungen (z. B. Vorleistungsgüter wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe), der Produktionswert (z. B. unfertige Erzeugnisse und Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse) und die Bruttoanlageinvestitionen (z. B. angefangene Investitionsgüter). Wenn Waren im Ausland veredelt werden und es dabei zu einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums kommt, müssen sie zu den Exporten (und später dann zu den Importen) gerechnet werden. Die Exporte führen zu einer Abnahme der Vorräte, während die entsprechenden späteren Importe zu einer Zunahme der Vorräte führen, wenn diese Güter nicht sofort anders verwendet oder verkauft werden. |
|
3.150 |
Bei der Erfassung der Vorratsveränderungen werden Wareneingänge zum Zeitpunkt des Lagerzugangs und Warenausgänge zum Zeitpunkt des Lagerabgangs gebucht. |
|
3.151 |
Die verwendeten Preise zur Erfassung der Waren in den Vorratsveränderungen sind wie folgt:
|
|
3.152 |
Verluste durch Verderb, versicherbare Schadensfälle oder kleinere Diebstähle werden wie folgt gebucht und bewertet:
|
|
3.153 |
Bei fehlenden Angaben werden die folgenden Näherungsverfahren zur Schätzung der Vorratsveränderungen herangezogen:
Saisonbedingte Preisänderungen können Qualitätsunterschiede reflektieren, wie Ausverkaufspreise oder Preise für Obst und Gemüse außerhalb der Saison. Diese Qualitätsunterschiede werden der Volumenkomponente zugerechnet. |
Nettozugang an Wertsachen (P.53)
|
3.154 |
Definition: Wertsachen sind nichtfinanzielle Vermögensgüter, die primär als Wertanlage dienen und nicht der Produktion oder dem Konsum und die normalerweise ihren physischen Wert erhalten. |
|
3.155 |
Zu den Wertsachen zählen folgende Typen von Gütern:
|
|
3.156 |
Derartige Waren werden als Nettozugang an Wertsachen gebucht, wenn sie z. B. von folgenden Sektoren erworben oder veräußert werden:
Im ESVG werden vereinbarungsgemäß auch die folgenden Fälle als Nettozugang an Wertsachen gebucht:
Mit dieser Vereinbarung sollen häufige Umbuchungen zwischen Wertsachen, Anlagegütern und Vorräten vermieden werden, die beispielsweise erforderlich wären, wenn private Haushalte derartige Waren von Kunsthändlern kaufen oder an sie verkaufen. |
|
3.157 |
Die Produktion von Wertsachen wird zu Herstellungspreisen bewertet. Der Erwerb von Wertsachen wird zu den für sie gezahlten Anschaffungspreisen einschließlich eventuell gezahlter Gebühren, Provisionen oder Handelsspannen beim Kauf vom Händler bewertet. Veräußerungen von Wertsachen werden zu den Preisen bewertet, die die Verkäufer nach Abzug aller an Vertreter oder andere Mittler gezahlten Gebühren oder Provisionen erzielen. Erwerb und Veräußerungen zwischen den gebietsansässigen Sektoren gleichen sich insgesamt aus, übrig bleiben die Gewinnspannen der Vertreter und Händler. |
EXPORTE UND IMPORTE VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN (P.6 und P.7)
|
3.158 |
Definition: Die Exporte umfassen Transaktionen mit Waren und Dienstleistungen (Verkäufe, Tausch und Schenkungen) von Gebietsansässigen an Gebietsfremde. |
|
3.159 |
Definition: Die Importe umfassen Transaktionen mit Waren und Dienstleistungen (Verkäufe, Tausch und Schenkungen) von Gebietsfremden an Gebietsansässige. |
|
3.160 |
Die Exporte und Importe enthalten nicht:
|
|
3.161 |
Bei den Exporten und den Importen wird unterschieden zwischen:
Beide Typen werden als Exporte und Importe bezeichnet. |
Warenexporte und Warenimporte (P.61 und P.71)
|
3.162 |
Warenexporte und Warenimporte finden statt, wenn zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden ein Wechsel des wirtschaftlichen Eigentums an den Waren erfolgt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Grenze physisch überschritten wird. |
|
3.163 |
Bei Lieferungen zwischen Einheiten, die einer institutionellen Einheit gehören (z. B. Filialen), wird ein Wechsel des wirtschaftlichen Eigentums unterstellt, wenn zwischen den verbundenen Einheiten Waren geliefert werden. Dies gilt nur, wenn die Einheit, die die Waren empfängt, Verantwortung für die Entscheidungen über Umfang und Höhe der Lieferung bzw. die Preise übernimmt, mit denen die Waren auf den Markt gebracht werden. |
|
3.164 |
Bei folgenden Beispielen finden Warenexporte statt, ohne dass die Waren die Staatsgrenze überschreiten:
Ähnliches gilt auch für Warenimporte. |
|
3.165 |
Zu den Warenexporten und Warenimporten gehören Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden einschließlich:
|
|
3.166 |
Nicht zu den Warenexporten und Warenimporten gehören folgende Waren, selbst wenn sie die Staatsgrenze überschreiten:
|
|
3.167 |
Warenexporte und Warenimporte werden beim Übergang des Eigentums an den Waren gebucht. Der Eigentumswechsel gilt als vollzogen, wenn die Transaktion in den Büchern der Beteiligten ausgewiesen wird. Dieser Zeitpunkt muss nicht übereinstimmen mit dem Zeitpunkt:
|
|
3.168 |
Warenexporte und Warenimporte werden zum fob-Wert (frei an Bord) an der Grenze des Ausfuhrlandes ausgewiesen. Dieser Wert ist:
In den Aufkommens- und Verwendungstabellen sowie in den symmetrischen Input-Output-Tabellen wird der Warenimport in Gütergliederung zum cif-Wert (Kosten, Versicherung, Fracht) an der Grenze des Einfuhrlandes bewertet. |
|
3.169 |
Definition: Der cif-Wert ist der Wert einer an die Grenze des Einfuhrlandes gelieferten Ware oder der Wert einer für einen Gebietsansässigen erbrachten Dienstleistung vor der Zahlung eventueller Zölle oder Importabgaben oder Handels- und Transportspannen im Einfuhrland. |
|
3.170 |
Die Verwendung von Ersatzwerten für den fob-Wert kann zum Beispiel unter folgenden Umständen erforderlich werden:
|
Dienstleistungsexporte und Dienstleistungsimporte (P.62 und P.72)
|
3.171 |
Definition: Dienstleistungsexporte umfassen alle von Gebietsansässigen an Gebietsfremde erbrachten Dienstleistungen. |
|
3.172 |
Definition: Dienstleistungsimporte umfassen alle von Gebietsfremden an Gebietsansässige erbrachten Dienstleistungen. |
|
3.173 |
Die Dienstleistungsexporte umfassen folgende Fälle:
|
|
3.174 |
Die Dienstleistungsimporte werden unter Nummer 3.173 als Spiegelbild der Liste der Dienstleistungsexporte dargestellt; nur die nachfolgenden Dienstleistungsimporte bedürfen einer genaueren Beschreibung. |
|
3.175 |
Die Importe von Verkehrsleistungen schließen folgende Beispiele ein:
Wenn ausgeführte Waren nach Verlassen der Grenze des Ausfuhrlandes von einem gebietsfremden Spediteur transportiert werden, so gehen diese Verkehrsleistungen nicht in die Dienstleistungsimporte ein (Fälle 5 und 6 in Tabelle 3.3). Da die Warenexporte fob bewertet werden, gelten alle Transportleistungen nach dem Überschreiten der Ausfuhrgrenze als Transaktionen zwischen Gebietsfremden, also als Transportleistungen eines gebietsfremden Spediteurs für einen gebietsfremden Importeur. Dies gilt auch dann, wenn diese Verkehrsleistungen vom Exporteur im Rahmen von cif-Ausfuhrverträgen bezahlt werden. |
|
3.176 |
Die Importe in Form von Direktkäufen im Ausland durch Gebietsansässige umfassen die Käufe von Waren und Dienstleistungen durch Gebietsansässige bei geschäftlichen oder privaten Auslandsreisen. Es ist hierbei zwischen zwei Kategorien zu unterscheiden, die unterschiedlich zu behandeln sind:
|
|
3.177 |
Die Importe und Exporte von Dienstleistungen werden zum Zeitpunkt ihrer Erbringung gebucht. Dieser Zeitpunkt stimmt mit dem Zeitpunkt ihrer Produktion überein. Die Dienstleistungsimporte werden zu Anschaffungspreisen, die Dienstleistungsexporte zu Herstellungspreisen bewertet. Tabelle 3.3 — Transport exportierter Waren
|
|
3.178 |
Der erste Teil dieser Tabelle zeigt, dass sechs Möglichkeiten des Transports von exportierten Waren unterschieden werden können, je nachdem, ob der Transporteur gebietsansässig oder gebietsfremd ist und wo der Transport stattfindet, nämlich von einem Ort im Inland (Exportland) zur Landesgrenze, von der Landesgrenze zur Grenze des Importlandes oder von der Grenze des Importlandes zu einem Ort innerhalb des Importlandes. Im zweiten Teil der Tabelle wird für jede dieser sechs Möglichkeiten angegeben, ob Buchungen von Warenexporten, Dienstleistungsexporten, Warenimporten oder Dienstleistungsimporten vorzunehmen sind. Tabelle 3.4 — Transport importierter Waren
|
|
3.179 |
Die Tabelle zeigt, dass auch beim Warenimport sechs Möglichkeiten des Transports unterschieden werden können, je nachdem, ob der Transporteur gebietsansässig oder gebietsfremd ist und wo der Transport stattfindet, nämlich von einem Ort innerhalb des Exportlandes zur Grenze des Exportlandes, von der Grenze des Exportlandes zur Grenze des Importlandes oder von der Landesgrenze des Importlandes zu einem Ort im Inland. Im zweiten Teil der Tabelle wird für jede dieser sechs Möglichkeiten angegeben, ob Buchungen von Warenimporten, Dienstleistungsimporten, Warenexporten oder Dienstleistungsexporten vorzunehmen sind. In einigen Fällen (2 und 5) hängt die Buchung davon ab, ob die Warenimporte cif oder fob bewertet werden. Der Übergang von der cif-Bewertung der Warenimporte zur fob-Bewertung erfolgt durch:
|
TRANSAKTIONEN MIT VORHANDENEN GÜTERN
|
3.180 |
Definition: Vorhandene Güter sind bereits verwendete Güter (Vorräte nicht inbegriffen). |
|
3.181 |
Zu den vorhandenen Gütern gehören:
Die Transaktionen mit vorhandenen Gütern werden als Negativausgabe beim Verkäufer und als positive Ausgabe beim Käufer gebucht. |
|
3.182 |
Diese Definition vorhandener Güter hat folgende Konsequenzen:
|
|
3.183 |
Transaktionen mit vorhandenen Gütern werden zum Zeitpunkt ihres Eigentumswechsels gebucht. Dabei werden die Bewertungsgrundsätze angewendet, die für vergleichbare Gütertransaktionen gelten. |
NETTOZUGANG AN NICHTPRODUZIERTEN VERMÖGENSGÜTERN (NP)
|
3.184 |
Definition: Nichtproduzierte Vermögensgüter umfassen Aktiva, die (innerhalb des Produktionskonzepts) nicht produziert wurden und die möglicherweise für die Produktion von Gütern eingesetzt werden. |
|
3.185 |
Beim Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern werden drei Kategorien unterschieden:
|
|
3.186 |
Die natürlichen Ressourcen umfassen folgende Kategorien:
Nutztiere und Nutzpflanzungen gehören nicht zu den natürlichen Ressourcen. Käufe oder Verkäufe von Nutztieren und Nutzpflanzungen werden nicht als Nettozugang an natürlichen Ressourcen gebucht, sondern als Anlageinvestition. Auch Zahlungen für die vorübergehende Nutzung natürlicher Ressourcen werden nicht als Zugang an natürlichen Ressourcen gebucht, sondern als Pacht, d. h. als Vermögenseinkommen (siehe Kapitel 15 „Nutzungsrechte“). |
|
3.187 |
Zum Grund und Boden gehören der Boden selbst einschließlich Bodendecke und zugehörige Oberflächengewässer. Zu den zugehörigen Oberflächengewässern gehören die Binnengewässer — Stauseen, Seen, Flüsse usw. —, an denen Eigentumsrechte bestehen können. |
|
3.188 |
Die folgenden Posten sind in der Position Grund und Boden nicht enthalten:
Die Posten a und b zählen zu den produzierten Anlagegütern, die Posten c bis e zu den nicht produzierten Vermögensgütern. |
|
3.189 |
Erwerb und Veräußerungen von Grund und Boden und sonstigen natürlichen Ressourcen werden zu den jeweiligen Marktpreisen bewertet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs bzw. der Veräußerung gelten. Transaktionen bei natürlichen Ressourcen werden in den Konten des Käufers und in den Konten des Verkäufers mit demselben Wert gebucht. Dieser Wert enthält nicht die im Zusammenhang mit der Übertragung des Eigentums an natürlichen Ressourcen entstehenden Kosten. Diese Kosten werden den Bruttoanlageinvestitionen zugerechnet. |
|
3.190 |
Nutzungsrechte als nichtproduzierte Vermögensgüter umfassen folgende Kategorien:
|
|
3.191 |
Ausgeschlossen von den Nutzungsrechten als Kategorie nichtproduzierter Vermögensgüter ist das Operating Leasing derartiger Aktiva; Zahlungen für Operating Leasing werden als Vorleistungen gebucht. Der Wert des Erwerbs und der Veräußerung von Nutzungsrechten schließt die damit verbundenen Kosten der Eigentumsübertragung aus. Letztere sind eine Komponente der Bruttoanlageinvestitionen. |
|
3.192 |
Definition: Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte sind die Differenz zwischen dem für ein Unternehmen als „Ganzes“ effektiv gezahlten Betrag und der Summe der Aktiva abzüglich der Summe der Passiva des Unternehmens. Um den Gesamtwert der Aktiva abzüglich der Passiva zu ermitteln, wird jeder Aktiv- und jeder Passivposten getrennt ermittelt und bewertet. |
|
3.193 |
Der Firmenwert wird nur dann erfasst, wenn der Wert durch eine Markttransaktion belegt wird, beispielsweise durch den Verkauf des gesamten Unternehmens. Werden veräußerbare Marketing-Vermögenswerte einzeln und gesondert vom gesamten Unternehmen verkauft, wird ihr Verkauf unter diesem Posten verbucht. |
|
3.194 |
Der Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern wird im Vermögensbildungskonto der Sektoren, der Gesamtwirtschaft und der übrigen Welt gebucht. |
KAPITEL 4
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN
|
4.01 |
Definition: Verteilungstransaktionen umfassen die Verteilung der Wertschöpfung auf Arbeit, Kapital und den Staat sowie die Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Es wird zwischen laufenden Transfers und Vermögenstransfers unterschieden; durch Vermögenstransfers wird nicht Einkommen, sondern Ersparnis oder Vermögen umverteilt. |
ARBEITNEHMERENTGELT (D.1)
|
4.02 |
Definition: Das Arbeitnehmerentgelt (D.1) umfasst sämtliche Geld- und Sachleistungen, die von einem Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer erbracht werden, und zwar als Entgelt für die von diesem in einem Darstellungszeitraum geleistete Arbeit. Das Arbeitnehmerentgelt umfasst folgende Bestandteile:
|
Bruttolöhne und -gehälter (D.11)
Bruttolöhne und -gehälter in Form von Geldleistungen
|
4.03 |
Bruttolöhne und -gehälter in Form von Geldleistungen schließen alle vom Arbeitnehmer geleisteten Sozialbeiträge, Einkommensteuern und sonstigen Zahlungen ein, auch wenn diese vom Arbeitgeber einbehalten und für den Arbeitnehmer direkt an Systeme der sozialen Sicherung, Steuerbehörden usw. abgeführt werden. Bruttolöhne und -gehälter in Form von Geldleistungen umfassen:
|
Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen
|
4.04 |
Definition: Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen umfassen Waren, Dienstleistungen und sonstige unbare Leistungen, die unentgeltlich oder verbilligt von den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt werden und von den Arbeitnehmern nach eigenem Ermessen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse oder der Bedürfnisse von Mitgliedern ihres Haushalts verwendet werden können. |
|
4.05 |
Beispiele für Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen sind:
|
|
4.06 |
Waren und Dienstleistungen, die den Arbeitnehmern als Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden, werden zu Herstellungspreisen bewertet, wenn sie vom Arbeitgeber produziert werden, und zu Anschaffungspreisen, wenn sie vom Arbeitgeber gekauft werden. Werden die Waren und Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung gestellt, so werden die Bruttolöhne und -gehälter in Form von Sachleistungen anhand des Herstellungspreises (oder, wenn sie vom Arbeitgeber gekauft werden, anhand des Anschaffungspreises) der betreffenden Waren und Dienstleistungen berechnet. Von diesem Wert wird der vom Arbeitnehmer gezahlte Betrag abgezogen, wenn die Waren und Dienstleistungen nicht unentgeltlich, sondern verbilligt zur Verfügung gestellt werden. |
|
4.07 |
Bruttolöhne und -gehälter umfassen nicht:
|
Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.12)
|
4.08 |
Definition: Sozialbeiträge der Arbeitgeber sind Sozialbeiträge, die Arbeitgeber an die Sozialversicherung oder an andere beschäftigungsbezogene Systeme der sozialen Sicherung zahlen, damit ihre Arbeitnehmer Sozialleistungen erhalten. In das Arbeitnehmerentgelt wird ein Betrag in Höhe des Wertes der Sozialbeiträge einbezogen, die von den Arbeitgebern geleistet werden, um damit ihren Arbeitnehmern einen Anspruch auf Sozialleistungen zu sichern. Bei den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber handelt es sich entweder um tatsächliche oder um unterstellte Beträge. |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.121)
|
4.09 |
Definition: Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.121) umfassen deren Zahlungen an Versicherungsträger (Sozialversicherung und andere beschäftigungsbezogene Systeme der sozialen Sicherung) zugunsten ihrer Arbeitnehmer. Derartige Zahlungen umfassen die gesetzlich vorgeschriebenen, die gewohnheitsmäßig gewährten, die vertraglichen sowie die freiwilligen Beträge zur Versicherung gegen soziale Risiken oder Bedürfnisse. Obwohl derartige Arbeitgeberbeiträge von den Arbeitgebern direkt an die Versicherungsträger gezahlt werden, sind sie als ein Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts anzusehen. Verbucht wird dann die Abführung der Beiträge durch die Arbeitnehmer an die Versicherungsträger. Es gibt zwei Kategorien von tatsächlichen Sozialbeiträgen der Arbeitgeber: Die Beiträge zur Alterssicherung und Beiträge für andere Leistungen werden separat unter den folgenden Positionen verbucht:
Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung entsprechen Beiträgen im Zusammenhang mit sozialen Risiken und Bedürfnissen, bei denen es nicht um die Alterssicherung geht, wie Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall, Invalidität, Entlassung usw. ihrer Arbeitnehmer. |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.122)
|
4.10 |
Definition: Die unterstellten Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.122) stellen den Gegenwert von sonstigen Leistungen zur sozialen Sicherung (D.622) (vermindert um einen Betrag in Höhe eventueller Arbeitnehmerbeiträge) dar, die von den Arbeitgebern direkt, also ohne Zwischenschaltung einer Versicherungsgesellschaft oder einer rechtlich selbständigen Altersvorsorgeeinrichtung und ohne dass zu diesem Zweck spezielle Fonds oder spezielle Rückstellungen gebildet werden, an die von ihnen gegenwärtig oder früher beschäftigten Arbeitnehmer oder sonstige Berechtigte gezahlt werden. Es gibt zwei Kategorien von unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber:
|
|
4.11 |
In den Konten der Sektoren erscheinen die Ausgaben für direkte Sozialleistungen einmal auf der Verwendungsseite des Einkommensentstehungskontos als Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts und ein zweites Mal auf der Verwendungsseite des Kontos der sekundären Einkommensverteilung als sonstige Sozialleistungen der Arbeitgeber. Um das letztgenannte Konto auszugleichen, wird angenommen, dass die Arbeitnehmerhaushalte an den jeweiligen Arbeitgebersektor die unterstellten Sozialbeiträge zurückzahlen, mit denen (zusammen mit eventuellen Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer) die von ihnen empfangenen Sozialleistungen dieser Arbeitgeber finanziert werden. Dieser unterstellte Kreislauf entspricht dem der tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, welche die Konten des Sektors private Haushalte durchlaufen und damit buchungsmäßig von diesen an die Versicherer gezahlt werden. |
|
4.12 |
Buchungszeitpunkt der Arbeitnehmerentgelte:
|
|
4.13 |
Das Arbeitnehmerentgelt umfasst folgende Bestandteile:
Diese Bestandteile a bis c werden folgendermaßen gebucht:
|
PRODUKTIONS- UND IMPORTABGABEN (D.2)
|
4.14 |
Definition: Produktions- und Importabgaben (D.2) sind Zwangsabgaben in Form von Geld- oder Sachleistungen, die der Staat oder die Organe der Europäischen Union ohne Gegenleistung auf die Produktion und die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen, die Beschäftigung von Arbeitskräften oder das Eigentum an oder den Einsatz von Grundstücken, Gebäuden oder anderen im Produktionsprozess eingesetzten Aktiva erheben. Derartige Steuern sind unabhängig von den Betriebsgewinnen zu entrichten. |
|
4.15 |
Produktions- und Importabgaben umfassen folgende Bestandteile:
|
Gütersteuern (D.21)
|
4.16 |
Definition: Gütersteuern (D.21) sind Steuern, die pro Einheit einer produzierten oder gehandelten Ware oder Dienstleistung zu entrichten sind. Sie können entweder als ein bestimmter Geldbetrag pro Mengeneinheit einer Ware oder Dienstleistung festgesetzt oder als ein bestimmter Prozentsatz des Preises pro Einheit oder des Wertes der den Gegenstand der Transaktion bildenden Waren oder Dienstleistungen berechnet werden. Steuern, die auf ein Gut erhoben werden, werden unabhängig davon, von welcher institutionellen Einheit sie gezahlt werden, den Gütersteuern zugerechnet, es sei denn, sie sind ausdrücklich in eine andere Position einbezogen. |
Mehrwertsteuer (MwSt.) (D.211)
|
4.17 |
Definition: Eine Steuer vom Typ Mehrwertsteuer (MwSt.) ist eine Steuer auf Waren und Dienstleistungen, die stufenweise bei den Unternehmen erhoben und letztlich vollständig vom Endabnehmer getragen wird. Diese Position umfasst die vom Staat auf Güter der Inlandsproduktion und auf Importe erhobene MwSt. ebenso wie etwaige sonstige abzugsfähige Gütersteuern, soweit sie ähnlichen Regeln wie die der MwSt. unterliegen. Alle Steuern vom Typ Mehrwertsteuer werden im Folgenden als „MwSt.“ bezeichnet. Das gemeinsame Merkmal der Steuern vom Typ MwSt. ist, dass die Produzenten lediglich die Differenz zwischen der MwSt. auf ihre Verkäufe und der MwSt. auf ihre Käufe von Vorleistungen und Bruttoanlageinvestitionen an den Staat abführen müssen. Die MwSt. ist nach dem Nettosystem zu buchen; das bedeutet:
Für die Gesamtwirtschaft entspricht die MwSt. der Differenz zwischen der gesamten in Rechnung gestellten und der gesamten abziehbaren MwSt. (siehe Nummer 4.27) |
Importabgaben (D.212)
|
4.18 |
Definition: Importabgaben (D.212) umfassen alle Zwangsabgaben, ausgenommen die MwSt., die vom Staat oder den Organen der Europäischen Union auf eingeführte Güter, die in den freien Verkehr des Wirtschaftsgebiets eingehen, oder auf Dienstleistungen, die von gebietsfremden Einheiten für gebietsansässige Einheiten erbracht werden, erhoben werden. Zu den Zwangsabgaben gehören:
Diese Position umfasst:
Nettoimportabgaben werden als Differenz zwischen den Importabgaben (D.212) und den Importsubventionen (D.311) ermittelt. |
Sonstige Gütersteuern (D.214)
|
4.19 |
Definition: Sonstige Gütersteuern (D.214) umfassen Steuern auf Waren und Dienstleistungen, die aufgrund der Produktion, des Exports, des Verkaufs, der Übertragung, des Leasings oder der Lieferung dieser Waren und Dienstleistungen oder aufgrund ihrer Verwendung für den Eigenverbrauch oder für die Produktion von selbsterstellten Anlagen zu entrichten sind. |
|
4.20 |
Hierzu gehören
|
|
4.21 |
Die Nettogütersteuern werden als Differenz zwischen den Gütersteuern (D.21) und den Gütersubventionen (D.31) ermittelt. |
Sonstige Produktionsabgaben (D.29)
|
4.22 |
Definition: Sonstige Produktionsabgaben (D.29) umfassen sämtliche Steuern, die von Unternehmen aufgrund ihrer Produktionstätigkeit, unabhängig von der Menge oder dem Wert der produzierten oder verkauften Güter, zu entrichten sind. Sonstige Produktionsabgaben sind zahlbar auf den Grund und Boden, das Anlagevermögen oder die Arbeitskräfte, die im Rahmen des Produktionsprozesses eingesetzt werden, oder auf bestimmte Tätigkeiten oder Transaktionen. |
|
4.23 |
Die sonstigen Produktionsabgaben (D.29) umfassen:
|
|
4.24 |
Die sonstigen Produktionsabgaben umfassen nicht von den privaten Haushalten zu entrichtende Steuern auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen usw. für private Zwecke, die den laufenden Steuern auf Einkommen, Vermögen usw. zugeordnet werden. |
Produktions- und Importabgaben an die Organe der Europäischen Union
|
4.25 |
Die Produktions- und Importabgaben an die Organe der Europäischen Union umfassen die folgenden Steuern, die von den zuständigen einzelstaatlichen Stellen für Rechnung von Organen der Europäischen Union erhoben werden: Einnahmen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik: Abschöpfungsbeträge für importierte landwirtschaftliche Erzeugnisse, Währungsausgleichsbeträge, die beim Export oder Import erhoben werden, Zuckerabgabe und Isoglucosesteuer sowie die Mitverantwortungsabgabe auf Milch und Getreide; Einnahmen aus dem Handel mit Drittländern: Zölle, die auf der Grundlage des Integrierten Tarifs der Europäischen Gemeinschaften (Taric) erhoben werden. Die Produktions- und Importabgaben an die Organe der Europäischen Union umfassen nicht die MwSt.-basierte dritte Eigenmittelquelle, die bei anderen laufenden Transfers unter der Position „MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel“ (D.76) erfasst ist (siehe Nummer 4.140). |
Produktions- und Importabgaben: Buchungszeitpunkt und zu buchende Beträge
|
4.26 |
Buchung der Produktions- und Importabgaben: Produktions- und Importabgaben werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Tätigkeiten, Transaktionen oder sonstigen Ereignisse stattfinden, durch die die Steuerverbindlichkeiten entstehen. |
|
4.27 |
Einige steuerpflichtige wirtschaftliche Tätigkeiten, Transaktionen oder Ereignisse entgehen jedoch der Aufmerksamkeit der Steuerbehörden. Durch derartige Tätigkeiten, Transaktionen oder Ereignisse entstehen keine finanziellen Aktiva oder Passiva in Form von Forderungen oder Verbindlichkeiten. Verbucht werden nur Beträge, die durch Steuerbescheide, -erklärungen oder andere Unterlagen nachgewiesen werden, durch die Verbindlichkeiten in Form von Zahlungsverpflichtungen seitens der Steuerpflichtigen entstehen. Steuern, für die keine Steuerbescheide vorliegen, werden nicht unterstellt. Für die Verbuchung von Steuern in den Konten kommen zwei Quellen in Betracht: auf Veranlagungen und Erklärungen beruhende Beträge oder Kasseneinnahmen.
|
|
4.28 |
Der gebuchte Steuergesamtbetrag enthält auch Verzugszuschläge und Steuerstrafen, wenn diese nicht getrennt gebucht werden können. Auch zusätzliche Einziehungs- und Veranlagungskosten sind im Steuergesamtbetrag enthalten. Dieser Betrag vermindert sich um Steuererstattungen, die der Staat im Rahmen seiner Wirtschaftspolitik vornimmt, sowie um Rückzahlungen bei ungerechtfertigter Erhebung. |
|
4.29 |
Im Kontensystem werden die Produktions- und Importabgaben (D.2) wie folgt gebucht:
Die Gütersteuern werden auf der Aufkommensseite des Güterkontos der Gesamtwirtschaft gebucht. Durch diesen Buchungsvorgang kann das Aufkommen an Waren und Dienstleistungen, das zu Herstellungspreisen (also ohne die Gütersteuern) bewertet wird, mit der Güterverwendung zu Anschaffungspreisen (also einschließlich derartiger Steuern) ausgeglichen werden. Die sonstigen Produktionsabgaben (D.29) werden auf der Verwendungsseite der Einkommensentstehungskonten der Wirtschaftsbereiche und Sektoren gebucht, die sie entrichten. |
SUBVENTIONEN (D.3)
|
4.30 |
Definition: Subventionen (D.3) sind laufende Zahlungen ohne Gegenleistung, die der Staat oder die Organe der Europäischen Union an gebietsansässige Produzenten leisten. Beispiele für die Ziele der Subventionsgewährung:
Nichtmarktproduzenten können sonstige Subventionen nur erhalten, wenn ihre Zahlung in allgemeinen Vorschriften geregelt ist, die sowohl für Markt- als auch für Nichtmarktproduzenten gelten. Auf Nichtmarktproduktion (P.13) werden keine Gütersubventionen verbucht. |
|
4.31 |
Von den Organen der Europäischen Union gewährte Subventionen umfassen nur die von diesen direkt an gebietsansässige Produktionseinheiten geleisteten laufenden Transfers. |
|
4.32 |
Die Subventionen untergliedern sich in:
|
Gütersubventionen (D.31)
|
4.33 |
Definition: Gütersubventionen (D.31) sind Subventionen, die pro Einheit einer produzierten oder importierten Ware oder Dienstleistung geleistet werden. Der Betrag der Gütersubventionen kann angegeben werden als:
Gütersubventionen sind in der Regel zahlbar, wenn die Ware oder Dienstleistung produziert, verkauft oder importiert wird, aber gelegentlich auch unter anderen Umständen, etwa wenn die Ware übertragen oder geleast wird, oder wenn sie zum Eigenverbrauch oder zum Aufbau des eigenen Anlagevermögens verwendet wird. Gütersubventionen beziehen sich ausschließlich auf die Marktproduktion (P.11) oder die Produktion für die Eigenverwendung (P.12). |
Importsubventionen (D.311)
|
4.34 |
Definition: Importsubventionen (D.311) sind Subventionen auf Waren oder Dienstleistungen, die zahlbar sind, wenn die Waren die Grenze zur Verwendung im Wirtschaftsgebiet überschreiten oder wenn die Dienstleistungen für gebietsansässige institutionelle Einheiten erbracht werden. Zu den Importsubventionen gehört auch die Deckung von Verlusten staatlicher Handels- und Vorratsstellen, die aufgrund einer bewussten staatlichen Politik von gebietsfremden Einheiten Güter kaufen und diese zu niedrigeren Preisen an gebietsansässige Einheiten verkaufen. |
Sonstige Gütersubventionen (D.319)
|
4.35 |
Die sonstigen Gütersubventionen (D.319) umfassen Folgendes:
|
Sonstige Subventionen (D.39)
|
4.36 |
Definition: Sonstige Subventionen (D.39) sind alle an gebietsansässige Produktionseinheiten gezahlten Subventionen, die nicht zu den Gütersubventionen zählen. Nichtmarktproduzenten können für ihre Nichtmarktproduktion sonstige Subventionen nur erhalten, wenn ihre Zahlung in allgemeinen Vorschriften geregelt ist, die sowohl für Markt- als auch für Nichtmarktproduzenten gelten. |
|
4.37 |
Zu den sonstigen Subventionen (D.39) zählen folgende Beispiele:
|
|
4.38 |
Nicht als Subventionen gelten (D.3):
|
|
4.39 |
Buchungszeitpunkt: Subventionen (D.3) werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Transaktion oder das Ereignis (Produktion, Verkauf, Import usw.) stattfindet, das die Subvention nach sich zieht. Sonderfälle sind:
|
|
4.40 |
Subventionen (D.3) werden wie folgt gebucht:
Gütersubventionen werden mit einem negativen Vorzeichen auf der Aufkommensseite des Güterkontos der Gesamtwirtschaft gebucht. Sonstige Subventionen (D.39) werden mit einem negativen Vorzeichen auf der Verwendungsseite der Einkommensentstehungskonten der Wirtschaftsbereiche oder der Sektoren gebucht, die sie erhalten. Auswirkungen multipler Wechselkurse auf die Produktions- und Importabgaben und auf die Subventionen: Die Mitgliedstaaten wenden derzeit keine multiplen Wechselkurse an. Bei Vorliegen multipler Wechselkurse gilt:
|
VERMÖGENSEINKOMMEN (D.4)
|
4.41 |
Definition: Vermögenseinkommen (D.4) fällt an, wenn die Eigentümer finanzieller Forderungen und natürlicher Ressourcen diese anderen institutionellen Einheiten zur Verfügung stellen. Das für die Nutzung finanzieller Forderungen gezahlte Einkommen wird als Kapitalertrag, das für die Nutzung einer natürlichen Ressource gezahlte Einkommen als Pachteinkommen bezeichnet. Vermögenseinkommen ist die Summe aus Kapitalertrag und Pachteinkommen. Vermögenseinkommen werden wie folgt untergliedert:
|
Zinsen (D.41)
|
4.42 |
Definition: Zinsen (D.41) sind das Vermögenseinkommen, das die Eigentümer von Forderungen dafür erhalten, dass sie die Forderung einer anderen institutionellen Einheit zur Verfügung stellen. Zinsen werden für die folgenden Forderungen berücksichtigt:
Einkommen aus SZR-Beständen und -Zuteilungen sowie aus Goldsammelverwahrungskonten wird ebenfalls als Zinsen behandelt. Finanzielle Aktiva, die zu Zinsen führen, sind Forderungen von Gläubigern an Schuldner. Gläubiger leihen an Schuldner Mittel aus, die zur Schaffung eines oder mehrerer der oben genannten Finanzinstrumente führen. |
Zinsen auf Einlagen und Kredite
|
4.43 |
Der Betrag der an Finanzinstitute gezahlten und von Finanzinstituten erhaltenen Zinsen auf Kredite und Einlagen wird um eine Spanne bereinigt, die eine implizite Zahlung für die Dienstleistungen darstellt, die die Finanzinstitute durch die Vergabe von Krediten und die Hereinnahme von Einlagen erbringen. Die Zahlung oder der Erhalt wird in den Dienstleistungsteil und in das Zinskonzept der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unterteilt. Die tatsächlich an die Finanzinstitute geleisteten oder von ihnen erhaltenen Zinszahlungen, die als Bankzinsen bezeichnet werden, müssen so aufgeteilt werden, dass die Zinsen nach dem VGR-Konzept und die Dienstleistungsentgelte getrennt gebucht werden können. Die Beträge der von Kreditnehmern an Finanzinstitute gezahlten Zinsen nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen liegen um die geschätzten Werte der gezahlten Entgelte unter den Bankzinsen, während die Beträge der von den Einlegern erhaltenen Zinsen nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen um den Betrag des gezahlten Dienstleistungsentgelts über den Bankzinsen liegen. Dieses Entgelt wird in den Produktionskonten der Finanzinstitute als Dienstleistungsverkäufe und in den Konten ihrer Kunden als Verwendungen gebucht. |
Zinsen auf Schuldverschreibungen
|
4.44 |
Sie umfassen Zinsen auf kurzfristige und Zinsen auf langfristige Schuldverschreibungen. |
Zinsen auf kurzfristige Schuldverschreibungen
|
4.45 |
Die Verzinsung während der Laufzeit eines Papiers ohne laufende Zinsauszahlungen errechnet sich als Differenz zwischen dem Nennwert und dem Emissionskurs (also als Diskontabschlag). Bei dem Wertzuwachs eines Geldmarktpapiers aufgrund aufgelaufener Zinsen handelt es sich nicht um einen Umbewertungsgewinn, da dieser Wertzuwachs auf einen Anstieg des ausstehenden Kapitalbetrags und nicht auf eine Änderung des Kurses des Papiers zurückzuführen ist Sonstige Änderungen des Wertes des Papiers werden als Umbewertungsgewinne behandelt. |
Zinsen auf langfristige Schuldverschreibungen
|
4.46 |
Hierbei handelt es sich um Zinsen auf langfristige Wertpapiere, die dem Inhaber feste oder vereinbarte variable Kuponzahlungen und/oder vorher festgelegte Beträge zu mehreren Zeitpunkten oder am Rückzahlungszeitpunkt garantieren.
Die aufgrund der Indexierung aufgelaufenen Zinsen werden in das Wertpapier reinvestiert und sind im Finanzierungskonto des Inhabers und des Emittenten des Papiers zu buchen. |
Zinsswaps und Forward Rate Agreements
|
4.47 |
Zahlungen aufgrund von Swapvereinbarungen aller Art werden als Transaktionen mit Finanzderivaten im Finanzierungskonto verbucht und nicht als Zinsen beim Vermögenseinkommen erfasst. Transaktionen aufgrund von Forward Rate Agreements werden als Transaktionen mit Finanzderivaten im Finanzierungskonto und nicht als Vermögenseinkommen verbucht. |
Zinsen auf Finanzierungsleasing
|
4.48 |
Finanzierungsleasing ist eine Art der Finanzierung beispielsweise des Kaufs von beweglichen Anlagegütern. Der Leasinggeber kauft das Anlagegut, und der Leasingnehmer verpflichtet sich zur Zahlung von Leasingraten, die es dem Leasinggeber ermöglichen, während der Vertragslaufzeit die ihm entstandenen Kosten einschließlich der entgangenen Zinsen auf das für den Ankauf des Anlageguts eingesetzte Kapital zu decken. In diesem Fall wird angenommen, dass der Leasinggeber dem Leasingnehmer einen Kredit in Höhe des Anschaffungspreises des Anlageguts gewährt. Anschließend wird dieser Kredit während der Vertragslaufzeit zurückgezahlt. Weiterhin wird angenommen, dass sich die vom Leasingnehmer gezahlten Leasingraten jeweils aus zwei Bestandteilen zusammensetzen: einer Tilgungszahlung und einer Zinszahlung. Der für den unterstellten Kredit gezahlte Zinssatz ergibt sich aus dem Verhältnis des Gesamtbetrags der während der Vertragslaufzeit gezahlten Leasingraten zum Anschaffungspreis des Anlageguts. In dem Maße, in dem der Kapitalbetrag zurückgezahlt wird, verringert sich während der Laufzeit des Vertrags der auf die Zinszahlung entfallende Teil der Leasingraten. Der vom Leasingnehmer ursprünglich in Anspruch genommene Kredit und die Tilgungszahlungen werden im Finanzierungskonto des Leasinggebers und des Leasingnehmers gebucht. Die Zinszahlungen werden unter der Position Zinsen im Konto der primären Einkommensverteilung ausgewiesen. |
Sonstige Zinsen
|
4.49 |
Die sonstigen Zinsen umfassen:
|
Buchungszeitpunkt
|
4.50 |
Die Buchung der Zinsen erfolgt nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung entsprechend ihrem Auflaufen, d. h. bei der Buchung der Zinsen wird davon ausgegangen, dass die Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dem Gläubiger kontinuierlich zuwachsen. Die pro Rechnungszeitraum auflaufenden Zinsen sind unabhängig davon zu buchen, ob sie tatsächlich ausgezahlt oder dem ausstehenden Kapitalbetrag zugeschlagen werden. Werden die Zinsen nicht ausgezahlt, so wird der Anstieg des Kapitalbetrags im Finanzierungskonto als Erwerb eines finanziellen Aktivums durch den Gläubiger und als Erhöhung der entsprechenden Verbindlichkeit des Schuldners ausgewiesen. |
|
4.51 |
Zinsen werden vor Abzug von Steuern gebucht. Empfangene und geleistete Zinsen schließen Zinszuschüsse ein, unabhängig davon, ob diese direkt an Kreditinstitute oder an die Begünstigten gezahlt werden (siehe Nummer 4.37). Da der Wert der von finanziellen Mittlern erbrachten Dienstleistungen den verschiedenen Kunden zugerechnet wird, werden die von den finanziellen Mittlern tatsächlich geleisteten oder empfangenen Zinszahlungen um die Spanne bereinigt, bei der es sich um das implizite (unterstellte) Entgelt der finanziellen Mittler handelt. Der Betrag der von Kreditnehmern an finanzielle Mittler gezahlten Zinsen muss um den geschätzten Wert des gezahlten Entgelts verringert werden; dagegen muss der Betrag der von Einlegern empfangenen Zinsen erhöht werden. Dieses Entgelt wird als Zahlungen für die von finanziellen Mittlern für ihre Kunden erbrachten Dienstleistungen behandelt und nicht als Zinszahlungen. |
|
4.52 |
Im Kontensystem werden die Zinsen wie folgt verbucht:
|
Ausschüttungen und Entnahmen (D.42)
Ausschüttungen (D.421)
|
4.53 |
Definition: Ausschüttungen (D.421) sind Vermögenseinkommen, das die Eigentümer von Anteilsrechten (AF. 5) als Gegenleistung dafür erhalten, dass sie beispielsweise Kapitalgesellschaften finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Die Beschaffung von Eigenkapital durch die Ausgabe von Beteiligungsscheinen (z. B. Aktien, GmbH-Anteile, Investmentzertifikate) ist eine Art der Mittelaufnahme. Anders als mit Fremdkapital ist mit Eigenkapital keine in monetärer Hinsicht feste Verbindlichkeit verbunden, und die Anteilsinhaber einer Kapitalgesellschaft haben kein Anrecht auf ein festes oder im voraus festgelegtes Einkommen. Ausschüttungen sind alle Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften an ihre Aktionäre oder Eigentümer. |
|
4.54 |
Zu den Ausschüttungen zählen auch:
|
|
4.55 |
Nicht zu den Ausschüttungen (D.421) zählen Superdividenden. Superdividenden sind Ausschüttungen, die gemessen an der in jüngster Zeit beobachteten Höhe von Ausschüttungen und Gewinnen hoch sind. Um zu beurteilen, ob die Ausschüttungen hoch sind, wird das Konzept des ausschüttungsfähigen Gewinns zugrunde gelegt. Der ausschüttungsfähige Gewinn einer Kapitalgesellschaft ist gleich dem Unternehmensgewinn zuzüglich aller empfangenen laufenden Transfers abzüglich aller geleisteten laufenden Transfers und abzüglich der Anpassung betrieblicher Versorgungsansprüche. Anhand des Verhältnisses der Ausschüttungen zum ausschüttungsfähigen Gewinn in der jüngsten Vergangenheit wird die Plausibilität des derzeitigen Ausschüttungsniveaus beurteilt. Liegt das erklärte Ausschüttungsniveau deutlich höher, so werden die den Überschuss darstellenden Ausschüttungen als finanzielle Transaktionen behandelt und als „Superdividenden“ bezeichnet. Derartige Superdividenden werden unter F. 5 (Anteilsrechte) als Entnahme von Eigenkapital aus der Kapitalgesellschaft gebucht. Diese Behandlung gilt für Kapitalgesellschaften, unabhängig davon, ob sie Aktiengesellschaften oder Quasi-Kapitalgesellschaften sind und ob sie ausländischer oder inländischer privater Kontrolle unterliegen. |
|
4.56 |
Im Falle öffentlicher Kapitalgesellschaften sind Superdividenden hohe und unregelmäßige Zahlungen oder Zahlungen, die den Unternehmensgewinn des entsprechenden Rechnungszeitraums überschreiten und die aus den kumulierten Rücklagen oder aus Verkäufen von Vermögensgütern finanziert werden. Superdividenden öffentlicher Kapitalgesellschaften sind unter F. 5 als Entnahmen von Eigenkapital in Höhe der Differenz zwischen den Zahlungen und dem Unternehmensgewinn des entsprechenden Rechnungszeitraums zu verbuchen (siehe Nummer 20.206). Zwischendividenden werden unter Nummer 20.207 beschrieben. |
|
4.57 |
Buchungszeitpunkt: Auch wenn Ausschüttungen einen Teil des Einkommens darstellen, das während eines bestimmten Zeitraums erwirtschaftet wurde, werden sie nicht nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung gebucht. Während eines kurzen Zeitraums nach der Erklärung einer Ausschüttung, jedoch vor ihrer tatsächlichen Auszahlung, können Aktien „ex Dividende“ verkauft werden, das heißt die Ausschüttung ist noch an den Anteilseigner zum Zeitpunkt der Erklärung der Ausschüttung auszuzahlen und nicht an den Anteilseigner zum Fälligkeitszeitpunkt. Eine „ex Dividende“ verkaufte Aktie ist daher weniger wert als eine ohne diese Einschränkung verkaufte. Der Buchungszeitpunkt von Ausschüttungen ist der Zeitpunkt, zu dem der Aktienkurs auf der Basis „ex Dividende“ und nicht zu einem die Dividende einschließenden Kurs börsennotiert wird. Ausschüttungen werden wie folgt gebucht:
|
Gewinnentnahmen (D.422)
|
4.58 |
Definition: Gewinnentnahmen (D.422) sind die Beträge, die die Eigentümer für ihren eigenen Bedarf den erzielten Gewinnen ihrer Quasi-Kapitalgesellschaften entnehmen. Derartige Entnahmen werden vor Abzug der laufenden Steuern auf Einkommen, Vermögen usw. gebucht, da diese Steuern immer als von den Eigentümern gezahlt nachgewiesen werden. Wenn eine Quasi-Kapitalgesellschaft Gewinne erzielt, kann ihr die Einheit, der sie angehört, ganz oder teilweise das Verfügungsrecht über den Gewinn einräumen, insbesondere zu Investitionszwecken. Die in Quasi-Kapitalgesellschaften einbehaltenen Gewinne erscheinen als eigene Ersparnis der Quasi-Kapitalgesellschaften, da lediglich die von den Eigentümern entnommenen Gewinne bei den Gewinnentnahmen gebucht werden. |
|
4.59 |
Wenn in der übrigen Welt von Zweigstellen, Niederlassungen, Geschäftsstellen usw. gebietsansässiger Unternehmen, die dort nicht zu den inländischen Einheiten zählen, Gewinne erzielt werden, werden einbehaltene Gewinne als reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen (D.43) ausgewiesen. Nur die tatsächlich an das Mutterunternehmen abgeführten Gewinne werden als von der übrigen Welt empfangene Gewinnentnahmen aus Quasi-Kapitalgesellschaften nachgewiesen. Entsprechend wird verfahren, um die Beziehungen zwischen den im Inland tätigen Zweigstellen, Niederlassungen, Geschäftsstellen usw., die gebietsfremden Unternehmengehören, darzustellen. |
|
4.60 |
Gewinnentnahmen schließen auch den Nettobetriebsüberschuss ein, den Gebietsansässige als Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden in der übrigen Welt erhalten bzw. den Gebietsfremde aus dem Eigentum von Grundstücken und Gebäuden im Inland erzielen. Gebietsfremde Einheiten, die im Wirtschaftsgebiet eines Landes Transaktionen in Grundstücken und Gebäuden tätigen, werden als fiktive gebietsansässige Einheiten des Landes angesehen, in dem sich ihr Besitz befindet. Auch für Eigentümerwohnungen in der übrigen Welt, die von Gebietsansässigen selbst genutzt werden, wird ein (unterstellter) Nettobetriebsüberschuss als Gewinnentnahme (Teil der Primäreinkommen) aus der übrigen Welt gebucht; der (unterstellte) Mietwert dieser Eigentümerwohnungen ist Teil des Dienstleistungsimports. Für von Gebietsfremden im Inland selbst genutzte Eigentümerwohnungen gilt Spiegelbildliches. Zu den Gewinnentnahmen aus Quasi-Kapitalgesellschaften gehört Einkommen, das durch schattenwirtschaftliche Tätigkeiten von Quasi-Kapitalgesellschaften entsteht und an die an derartigen Wirtschaftstätigkeiten beteiligten Eigentümer für den privaten Gebrauch übertragen wird. |
|
4.61 |
In die Gewinnentnahmen sind die Beträge nicht einbezogen, die den Eigentümern aus folgenden Transaktionen zufließen:
Derartige Beträge werden im Finanzierungskonto als Kapitalentnahmen ausgewiesen, da sie einer teilweisen oder vollständigen Liquidation einer Beteiligung an der Quasi-Kapitalgesellschaft entsprechen. Wenn sich die Quasi-Kapitalgesellschaft in Staatsbesitz befindet und aufgrund einer gezielten staatlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik anhaltende Betriebsverluste ausweist, werden sämtliche regelmäßigen Transfers des Staates an das Unternehmen zur Verlustdeckung als Subventionen behandelt. |
|
4.62 |
Buchungszeitpunkt: Gewinnentnahmen werden zum Zeitpunkt der Entnahme durch die Eigentümer gebucht. |
|
4.63 |
Im Kontensystem erscheinen die Gewinnentnahmen:
|
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen (D.43)
|
4.64 |
Definition: Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen (D.43) sind gleich dem Betriebsüberschuss des Unternehmens, das Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition ist,
|
|
4.65 |
Bei einem Unternehmen, das Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition ist, handelt es sich um ein Unternehmen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, bei dem ein ausländischer Investor mindestens 10 Prozent der Stammaktien oder der Stimmrechte eines Unternehmens mit eigener Rechtspersönlichkeit oder einen vergleichbaren Anteil an einem Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. Unternehmen, die Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition sind, umfassen Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und Zweigniederlassungen. Ein Tochterunternehmen ist ein Unternehmen, an dem der Investor zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist, an einem verbundenen Unternehmen ist der Investor zu höchstens 50 Prozent beteiligt, und eine Zweigniederlassung ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das sich vollständig oder teilweise im Besitz des Investors befindet. Die Direktinvestitionsbeziehung kann direkt sein oder indirekt, wenn sie auf einer Eigentümerkette beruht. Der Begriff „Unternehmen, das Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition ist“, ist daher umfassender als der Begriff „ausländisch kontrollierte Kapitalgesellschaft“. |
|
4.66 |
Die Verteilung des Unternehmensgewinns eines Unternehmens, das Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition ist, kann in Form von Ausschüttungen oder Gewinnentnahmen aus Quasi-Kapitalgesellschaften erfolgen. Einbehaltene Gewinne werden behandelt, als ob sie an die ausländischen Direktinvestoren im Verhältnis zu ihrer Beteiligung ausgeschüttet und von diesen dann reinvestiert würden. Reinvestierte Gewinne aus ausländischen Direktinvestitionen können positiv oder negativ sein. |
|
4.67 |
Buchungszeitpunkt: Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erzielt werden. Im Kontensystem werden die reinvestierten Gewinne aus Direktinvestitionen wie folgt verbucht:
|
Sonstige Kapitalerträge (D.44)
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen (D.441)
|
4.68 |
Definition: Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen entsprechen den gesamten Primäreinkommen aus der Anlage versicherungstechnischer Rückstellungen. Die Rückstellungen sind diejenigen Beträge, bei denen eine Versicherungsgesellschaft eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber den Versicherungsnehmern anerkennt. Die versicherungstechnischen Rückstellungen werden von Versicherungsgesellschaften in finanzielle Aktiva, in Grundvermögen (in diesem Fall entstehen Nettoeinkommen aus Vermögen, d. h. Vermögenseinkommen nach Abzug sämtlicher Zinszahlungen) oder in Gebäude angelegt (in letzterem Fall entstehen Nettobetriebsüberschüsse). Bei Kapitalerträgen aus Versicherungsverträgen wird zwischen Nichtlebens- und Lebensversicherungsverträgen unterschieden. Bei Nichtlebensversicherungsverträgen hat die Versicherungsgesellschaft Verbindlichkeiten gegenüber dem Versicherungsnehmer in Höhe der bei der Gesellschaft eingelegten, aber noch nicht verdienten Prämie, des Werts der fälligen, aber noch nicht gezahlten Leistungen, und eine Rückstellung für noch nicht angemeldete Leistungen oder angemeldete, aber noch nicht erbrachte Leistungen. Aufgerechnet gegen diese Verbindlichkeit hält die Versicherungsgesellschaft technische Rücklagen. Die Kapitalerträge aus diesen Rücklagen werden als Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen behandelt, danach den Versicherungsnehmern im primären Einkommensverteilungskonto zugeordnet und an die Versicherungsgesellschaft als zusätzliche Prämien im Konto der sekundären Einkommensverteilung zurückgezahlt. Eine institutionelle Einheit, die ein System standardisierter Kreditgarantien gegen Gebühren betreibt, kann auch aus den Rückstellungen des Systems Kapitalerträge erzielen; diese sind ebenfalls verteilt auf die die Gebühren zahlenden Einheiten (die möglicherweise nicht die gleichen Einheiten sind, die in den Genuss der Garantien kommen) auszuweisen und im Konto der sekundären Einkommensverteilung als zusätzliche Gebühren zu verbuchen. Bei Lebensversicherungsverträgen und anderen kapitalbildenden Versicherungen haben Versicherungsgesellschaften gegenüber den Versicherungsnehmern und Rentenempfängern Verbindlichkeiten in Höhe des derzeitigen Werts der voraussichtlichen Leistungen. Aufgerechnet gegen diese Verbindlichkeiten verfügen Versicherungsgesellschaften über finanzielle Mittel, die den Versicherungsnehmern gehören und aus Boni für Lebensversicherungen mit Gewinnbeteiligung sowie Rückstellungen für Versicherungsnehmer und Rentenempfänger für die Zahlung künftiger Boni und anderer Leistungen bestehen. Diese Mittel werden in eine Reihe finanzieller und nichtfinanzieller Aktiva investiert. Die gegenüber den Lebensversicherungsnehmern deklarierten Boni werden als Kapitalertrag der Versicherungsnehmer verbucht und als zusätzliche Prämien, gezahlt von den Versicherungsnehmern an die Versicherungsgesellschaften, behandelt. Kapitalerträge aus Lebensversicherungsverträgen werden als von der Versicherungsgesellschaft geleistet und von den privaten Haushalten empfangen im Konto der primären Einkommensverteilung gebucht. Im Gegensatz zu Nichtlebensversicherungen oder Alterssicherungsleistungen spiegelt sich der Betrag in der Ersparnis wider und wird dann als finanzielle Transaktion gebucht, konkret als Erhöhung der Verbindlichkeiten von Lebensversicherungsgesellschaften, zusätzlich zu neuen Prämien abzüglich des Dienstleistungsentgelts und gezahlter Leistungen. |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen (D.442)
|
4.69 |
Ansprüche auf Alterssicherungsleistungen können gegenüber zwei verschiedenen Arten von Alterssicherungssystemen bestehen: gegenüber Systemen mit Beitragszusagen oder Systemen mit Leistungszusagen. Bei einem System mit Beitragszusagen werden Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Namen der Arbeitnehmer als den künftigen Empfängern der Alterssicherungsleistungen investiert. Eine andere Finanzierungsquelle der Alterssicherungsleistungen besteht nicht, die Mittel werden nicht anders verwendet. Die Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen mit Beitragszusagen sind gleich den Kapitalerträgen aus den finanziellen Mitteln zuzüglich der durch die Verpachtung von Boden oder Vermietung von Gebäuden im Besitz des Fonds verdienten Einkommen. Die Besonderheit eines Systems mit Leistungszusagen besteht darin, dass die Höhe der Zahlungen an die Leistungsempfänger anhand einer Formel bestimmt wird. Dadurch ist es möglich, die Höhe der Ansprüche als den gegenwärtigen Wert aller künftigen Zahlungen festzulegen, der auf der Grundlage versicherungsmathematischer Annahmen zur Lebensdauer und wirtschaftlicher Annahmen zu Zins- und Diskontsätzen berechnet wird. Der gegenwärtige Wert der zu Beginn des Jahres bestehenden Ansprüche steigt, weil der Zeitpunkt, zu dem die Leistungen fällig werden, ein Jahr näher gerückt ist. Die Steigerung wird im Falle der Systeme mit Leistungszusagen als Kapitalertrag des Empfängers der Alterssicherungsleistung betrachtet. Der Umfang der Steigerung hängt weder davon ab, ob das Altersicherungssystem tatsächlich genügend Mittel besitzt, um alle Verpflichtungen zu erfüllen, noch von der Art der Mittelerhöhung, also etwa davon, ob es sich um Kapitalerträge oder um Umbewertungsgewinne handelt. |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen (D.443)
|
4.70 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen (einschließlich Anteilen an Mutual Funds und Unit Trusts) umfassen zwei getrennte Komponenten:
Die Komponente der Ausschüttungen wird exakt in gleicher Weise gebucht wie die oben beschriebenen Ausschüttungen für einzelne Kapitalgesellschaften. Die Komponente der einbehaltenen Gewinne wird nach den gleichen Grundsätzen gebucht, wie sie für Unternehmen gelten, die Gegenstand ausländischer Direktinvestitionen sind, wird jedoch ohne reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen berechnet. Die verbleibenden einbehaltenen Gewinne fließen den Eigentümern von Investmentfondsanteilen zu (der Investmentfonds behält kein Sparvermögen) und werden dem Fonds durch die Anteilseigner in einer Transaktion wieder zugeführt, die im Finanzierungskonto verbucht wird. Von Investmentfonds empfangene Vermögenseinkommen werden als Vermögenseinkommen von Anteilseignern gebucht, auch wenn sie nicht ausgeschüttet, sondern in ihrem Namen reinvestiert werden. Anteilseigner bezahlen indirekt aus ihren Fondsanteilen Verwaltungsgesellschaften für die Verwaltung ihrer Investitionen. Bei diesem Dienstleistungsentgelt handelt es sich um Ausgaben der Anteilseigner, nicht um Ausgaben der Fonds. Buchungszeitpunkt: Sonstige Kapitalerträge werden gebucht, wenn sie anfallen. |
|
4.71 |
Im Kontensystem werden sonstige Kapitalerträge wie folgt gebucht:
|
Pachteinkommen (D.45)
|
4.72 |
Definition: Pacht ist das Einkommen, das der Eigentümer einer natürlichen Ressource als Gegenleistung dafür erhält, dass er diese Ressource einer anderen institutionellen Einheit zur Verfügung stellt. Es gibt zwei Arten von Pachteinkommen: Pachten für Land und Gewässer und Pachten für den Abbau von Bodenschätzen. Pachteinkommen für andere natürliche Ressourcen wie Funkfrequenzen folgen dem gleichen Muster. Der Unterschied zwischen Pachten und Mieten besteht darin, dass die Pacht eine Form des Vermögenseinkommens und Mieten Dienstleistungsentgelte sind. Mieten sind Zahlungen, die im Rahmen eines Operating-Leasing zur Nutzung eines Anlageguts im Besitz einer anderen Einheit geleistet werden. Eine Pacht ist eine Zahlung im Rahmen eines Ressourcen-Leasing für den Zugang zu einer natürlichen Ressource. |
Pachten für Land und Gewässer
Bei den Pachten, die Grundeigentümer von den Pächtern erhalten, handelt es sich um Vermögenseinkommen. Dazu gehören auch die an Eigentümer von Binnengewässern gezahlten Pachten für die Nutzung dieser Gewässer zu Erholungs- und anderen Zwecken einschließlich des Fischfangs.
Ein Grundeigentümer zahlt Grundsteuern und tätigt bestimmte Ausgaben für den laufenden Unterhalt infolge seines Grundeigentums. Diese Steuern und Ausgaben werden als vom Pächter gezahlte Steuern und Ausgaben behandelt, die von der Pacht abgezogen werden, die andernfalls an den Grundeigentümer zu zahlen wäre. Pacht, von der auf diese Weise Steuern oder sonstige Abgaben abgezogen werden, die der Grundeigentümer zahlen muss, wird „after-tax rent“ (Nachsteuer-Pacht) genannt.
|
4.73 |
Pachten schließen nicht die Mieten für auf dem entsprechenden Grund und Boden befindliche Gebäude und Wohnungen ein. Diese Mieten werden als Entgelt für Dienstleistungen angesehen, die vom Eigentümer an den Mieter des Gebäudes oder der Wohnung erbracht werden, und werden als Vorleistung oder als Konsum des Mieters verbucht. Fehlt eine objektive Basis für die Aufteilung der Zahlungen in Pacht und in Miete für die auf dem Grund und Boden befindlichen Gebäude, so wird der Gesamtbetrag nach dem geschätzten Schwerpunkt entweder dem Pachteinkommen oder der Miete zugerechnet. |
Pachten für den Abbau von Bodenschätzen
|
4.74 |
Diese Position umfasst die Zahlungen, die die Eigentümer (private oder staatliche Einheiten) von Mineralvorkommen oder von Vorkommen fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) dafür erhalten, dass sie anderen institutionellen Einheiten während eines bestimmten Zeitraums die Untersuchung oder den Abbau dieser Vorkommen gestatten. |
|
4.75 |
Buchungszeitpunkt: Pachteinkommen werden in dem Zeitraum gebucht, in dem sie fällig werden. |
|
4.76 |
Im Kontensystem werden Pachteinkommen wie folgt gebucht:
|
EINKOMMEN- UND VERMÖGENSTEUERN (D.5)
|
4.77 |
Definition: Die Einkommen- und Vermögensteuern (D.5) umfassen alle laufenden Zwangsabgaben in Form von Geld- und Sachleistungen, die regelmäßig vom Staat und von der übrigen Welt ohne Gegenleistung auf Einkommen und Vermögen von institutionellen Einheiten erhoben werden. Eingeschlossen sind einige regelmäßig zu entrichtende Steuern, die weder auf das Einkommen noch auf das Vermögen erhoben werden. Die Einkommen- und Vermögensteuern untergliedern sich in:
|
Einkommensteuer (D.51)
|
4.78 |
Definition: Die Einkommensteuern (D.51) umfassen Steuern auf Einkommen, Gewinne und Kapitalerträge. Sie werden auf das tatsächliche oder angenommene Einkommen von natürlichen Personen, privaten Haushalten, Kapitalgesellschaften oder Organisationen ohne Erwerbszweck erhoben. Sie schließen auch auf das Vermögen oder den Grund- und Immobilienbesitz bezogene Steuern ein, wenn die entsprechenden Vermögenswerte zur Schätzung des Einkommens ihrer Eigentümer verwendet werden. Zu den Einkommensteuern gehören:
|
Sonstige direkte Steuern und Abgaben (D.59)
|
4.79 |
Die sonstigen direkten Steuern und Abgaben (D.59) umfassen:
|
|
4.80 |
Die Einkommen- und Vermögensteuern umfassen nicht:
|
|
4.81 |
Der Steuergesamtbetrag enthält auch Verzugszuschläge und Steuerstrafen, wenn keine Daten vorliegen, anhand deren diese Zuschläge und Strafen getrennt geschätzt werden könnten, sowie eventuelle zusätzliche Einziehungs- und Veranlagungskosten, ohne Steuernachlässe, die der Staat im Rahmen seiner Wirtschaftspolitik gewährt, und ohne Steuerrückzahlungen bei ungerechtfertigter Erhebung. Einige Subventionen und Sozialleistungen werden über das Steuersystem in Form von Steuergutschriften bereitgestellt; die Zahlungssysteme werden zunehmend mit dem Steuererhebungssystem verknüpft. Steuergutschriften stellen Steuererleichterungen dar und verringern somit die Steuerschuld des Begünstigten. Sieht das Gutschriftsystem vor, dass der Begünstigte den Überschuss erhält, wenn die Steuererleichterung größer ist als die Steuerschuld, so handelt es sich um ein System der direkten Auszahlung der Steuergutschrift (Payable Tax Credit). Im Rahmen eines solchen Systems können sowohl Nichtsteuerzahler als auch Steuerzahler Zahlungen erhalten. Der Gesamtbetrag der nach einem System der Direktauszahlung geleisteten Steuergutschriften wird als Staatsausgaben und nicht als Steuermindereinnahmen gebucht. Bei einigen Steuergutschriftsystemen sind die Gutschriften jedoch auf den Umfang der Steuerschuld begrenzt und werden daher nicht ausgezahlt (Non-Payable Tax Credit). Bei einem System der nicht auszuzahlenden Steuergutschriften sind alle Steuergutschriften im Steuersystem verankert und werden als Verminderung der Steuereinnahmen des Staates gebucht. |
|
4.82 |
Einkommen- und Vermögensteuern werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Tätigkeiten, Transaktionen oder sonstigen Ereignisse stattfinden, durch die die Steuerverbindlichkeiten entstehen. Einige an sich steuerpflichtige Tätigkeiten, Transaktionen oder Ereignisse bleiben den Steuerbehörden jedoch auf Dauer verborgen. Es wäre unrealistisch anzunehmen, dass in diesen Fällen Steuerforderungen oder -verbindlichkeiten entstehen. Verbucht werden nur Beträge, die durch Steuerbescheide, -erklärungen oder andere Unterlagen nachgewiesen werden, durch die Verbindlichkeiten in Form von eindeutigen Zahlungsverpflichtungen seitens der Steuerpflichtigen entstehen. Nicht gezahlte Steuern, für die keine Steuerbescheide vorliegen, werden nicht unterstellt. Für die Verbuchung von Steuern in den Konten kommen zwei Quellen in Betracht: auf Veranlagungen und Erklärungen beruhende Beträge oder Kasseneinnahmen.
Einkommen- und Vermögensteuern, die von einem Arbeitgeber einbehalten werden, werden in die Bruttolöhne und -gehälter einbezogen, und zwar auch dann, wenn sie der Arbeitgeber nicht an den Staat abgeführt hat. Die Darstellung erfolgt so, als ob die privaten Haushalte den vollen Betrag an den Staat zahlen. Die in Wirklichkeit nicht gezahlten Beiträge werden unter D.995 als Vermögenstransfer des Staates an die Sektoren der Arbeitgeber neutralisiert. In einigen Fällen wird die Einkommensteuerverbindlichkeit erst in einem späteren Rechnungszeitraum festgelegt als dem, in dem das Einkommen anfällt. Hinsichtlich des Verbuchungszeitpunkts derartiger Steuern ist daher eine gewisse Flexibilität erforderlich. An der Quelle einbehaltene Einkommensteuern, wie Lohnsteuer und regelmäßige Einkommensteuervorauszahlungen, können in den Zeiträumen gebucht werden, in denen sie gezahlt werden, und die Buchung der endgültigen Steuerverbindlichkeit kann in dem Zeitraum erfolgen, in dem diese festgelegt wird. Einkommen- und Vermögensteuern werden wie folgt gebucht:
|
SOZIALBEITRÄGE UND SOZIALLEISTUNGEN (D.6)
|
4.83 |
Definition: Sozialleistungen sind Geld- oder Sachtransfers, die im Rahmen kollektiver Vorsorgesysteme oder von staatlichen Einheiten bzw. von Organisationen ohne Erwerbszweck an private Haushalte erbracht werden, um die Lasten zu decken, die den privaten Haushalten durch bestimmte Risiken oder Bedürfnisse entstehen. Zu den Sozialleistungen des Staates gehören Zahlungen des Staates an Produzenten, die einzelnen privaten Haushalten zugute kommen und im Zusammenhang mit sozialen Risiken oder Bedürfnissen erfolgen. |
|
4.84 |
Die Risiken und Bedürfnisse, die Anlass für Sozialleistungen sein können, sind:
Als Sozialleistungen gelten die Zahlungen des Staates an Wohnungsmieter zwecks Senkung ihrer Mietbelastung, nicht jedoch Sonderzuschüsse des Staates in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber. Letztere sind Teil der Bruttolöhne und -gehälter. |
|
4.85 |
Sozialleistungen umfassen:
|
|
4.86 |
Sozialleistungen umfassen nicht:
|
|
4.87 |
Ein Einzelversicherungsvertrag kann nur dann als Teil eines Systems der sozialen Sicherung behandelt werden, wenn die Ereignisse und Umstände, gegen die die Versicherungsnehmer versichert sind, den Risiken oder Bedürfnissen (siehe Nummer 4.84) entsprechen und wenn darüber hinaus mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
|
|
4.88 |
Definition: Systeme der sozialen Sicherung sind Systeme, durch die die Teilnehmer von ihren Arbeitgebern oder vom Staat dazu verpflichtet oder ermutigt werden, sich gegen bestimmte Ereignisse oder Umstände zu versichern, die ihr Wohlergehen oder das ihrer Angehörigen beeinträchtigen könnten. In derartigen Systemen entrichten Arbeitnehmer oder andere natürliche Personen oder Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer Sozialbeiträge und sichern damit in laufenden und in künftigen Rechnungszeiträumen für diese Arbeitnehmer oder andere Beitragszahler, ihre Angehörigen oder Hinterbliebenen einen Anspruch auf Leistungen zur sozialen Sicherung. Systeme der sozialen Sicherung werden für Gruppen von Arbeitskräften eingerichtet oder stehen per Gesetz allen Arbeitskräften oder einer bestimmten Gruppe von Arbeitskräften offen, und zwar Nichterwerbstätigen ebenso wie Arbeitnehmern. Sie können von privaten Systemen für ausgewählte Gruppen von Arbeitskräften, die von einem einzigen Arbeitgeber beschäftigt werden, bis hin zu Systemen der sozialen Sicherung für alle Arbeitskräfte eines Landes reichen. Die Teilnahme an den Systemen kann für die betreffenden Arbeitskräfte freiwillig sein, ist aber in den meisten Fällen verpflichtend. So kann etwa die Teilnahme an den von einzelnen Arbeitgebern betriebenen Systemen in den gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern vereinbarten Beschäftigungsbedingungen festgelegt sein. |
|
4.89 |
Zwei Arten von Systemen der sozialen Sicherung können unterschieden werden:
|
|
4.90 |
Systeme der sozialen Sicherung, die von staatlichen Einheiten für ihre eigenen Arbeitnehmer im Gegensatz zur Erwerbsbevölkerung insgesamt eingerichtet werden, werden nicht der Sozialversicherung, sondern den anderen beschäftigungsbezogenen Systemen zugeordnet. |
Nettosozialbeiträge (D.61)
|
4.91 |
Definition: Nettosozialbeiträge sind die tatsächlichen oder unterstellten Beiträge privater Haushalte zu Systemen der sozialen Sicherung, um Rückstellungen für die Zahlung von Sozialleistungen zu bilden. Nettosozialbeiträge (D.61) setzen sich wie folgt zusammen: Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611)
Die Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger entsprechen den Dienstleistungsgebühren der Einheiten, die die Systeme verwalten. Sie erscheinen hier als Teil der Berechnung der Nettosozialbeiträge (D.61), sind jedoch keine Umverteilungstransaktionen, sondern Teil des Produktionswerts und der Konsumausgaben. |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611)
|
4.92 |
Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611) entsprechen dem Strom D.121. Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber werden von den Arbeitgebern an die Sozialversicherung und andere beschäftigungsbezogene Systeme der sozialen Sicherung gezahlt, damit ihre Arbeitnehmer Sozialleistungen erhalten. Da die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber zugunsten ihrer Arbeitnehmer gezahlt werden, werden diese Beiträge gemeinsam mit den Bruttolöhnen und -gehältern in Form von Geld- und von Sachleistungen als Arbeitnehmerentgelt gebucht. Sie werden ferner als laufende Transfers der Arbeitnehmer an die Sozialversicherung und andere beschäftigungsbezogene Systeme der sozialen Sicherung ausgewiesen. Diese Position ist in zwei Kategorien untergliedert:
|
|
4.93 |
Tatsächliche Sozialbeiträge können aufgrund eines Gesetzes, einer Rechtsverordnung, eines Tarifvertrags für einen Wirtschaftsbereich, einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern auf Unternehmensebene oder aufgrund des Arbeitsvertrags selbst entrichtet werden. Die Beiträge können in bestimmten Fällen freiwillig sein. Bei diesen freiwilligen Beiträgen handelt es sich um:
|
|
4.94 |
Buchungszeitpunkt: Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611) werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Arbeitsleistung erbracht wird, durch die die Verpflichtung zur Entrichtung der Beiträge entsteht. |
|
4.95 |
Für die Verbuchung von an den Sektor Staat zu zahlenden Sozialbeiträgen in den Konten werden zwei Quellen herangezogen: auf Veranlagungen und Erklärungen beruhende Beträge oder Kasseneinnahmen.
An den Staat zu zahlende Sozialbeiträge, die vom Arbeitgeber einbehalten werden, werden in die Bruttolöhne und -gehälter einbezogen, und zwar unabhängig davon, ob der Arbeitgeber sie an den Staat abgeführt hat oder nicht. Die Darstellung erfolgt dann so, als ob die privaten Haushalte den vollen Betrag an den Staat zahlen. Die in Wirklichkeit nicht gezahlten Beiträge werden unter D.995 als Vermögenstransfer des Staates an die Sektoren der Arbeitgeber neutralisiert. |
|
4.96 |
Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber werden wie folgt gebucht:
|
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.612)
|
4.97 |
Definition: Die unterstellten Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.612) stellen den Gegenwert von Sozialleistungen (vermindert um den Betrag eventueller Arbeitnehmerbeiträge) dar, die von den Arbeitgebern direkt (also unabhängig von ihren tatsächlichen Beitragszahlungen) an die von ihnen gegenwärtig oder früher beschäftigten Arbeitnehmer oder an sonstige Berechtigte gezahlt werden. Sie entsprechen dem Strom D.122, wie unter „Arbeitnehmerentgelt“ beschrieben. Ihr Wert ist anhand versicherungsmathematischer Erwägungen oder auf der Grundlage eines angemessenen Prozentsatzes der den gegenwärtig beschäftigten Arbeitnehmern gezahlten Löhne und Gehälter festzulegen oder wird mit den ohne spezielle Deckungsmittel finanzierten Leistungen (ohne Leistungen zur Alterssicherung) gleichgesetzt, die vom Arbeitgeber während desselben Rechnungszeitraums zu zahlen sind. Es gibt zwei Kategorien von unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber (D.612):
|
|
4.98 |
Buchungszeitpunkt: Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber, denen als Gegenbuchung direkte gesetzliche Sozialleistungen gegenüberstehen, werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Arbeit geleistet wird. Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber, denen als Gegenbuchung direkte freiwillige Sozialleistungen gegenüberstehen, werden zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung gebucht. |
|
4.99 |
Die unterstellten Sozialbeiträge der Arbeitgeber werden wie folgt gebucht:
|
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte (D.613)
|
4.100 |
Definition: Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte sind die von Arbeitnehmern, Selbständigen oder Nichterwerbstätigen an Systeme der sozialen Sicherung gezahlten Sozialbeiträge. Es gibt zwei Kategorien von tatsächlichen Sozialbeiträgen der privaten Haushalte (D.613):
Buchungszeitpunkt: Die tatsächlichen Sozialbeiträge der privaten Haushalte werden nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung gebucht. Für die Erwerbstätigen ist dies der Zeitpunkt, zu dem die Arbeitsleistung erbracht wird, durch die die Verpflichtung zur Entrichtung der Beiträge entsteht. Bei Nichterwerbstätigen ist dies der Zeitpunkt, zu dem die Beiträge zu leisten sind. Im Kontensystem werden die tatsächlichen Sozialbeiträge der privaten Haushalte wie folgt verbucht:
|
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (D.614)
|
4.101 |
Definition: Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung bestehen aus dem Vermögenseinkommen, das im Rechnungszeitraum aus dem Vermögensbestand, auf den privaten Haushalte gegenüber Alterssicherungssystemen und anderen Systemen als Alterssicherungssystemen Ansprüche haben. Diese Position ist in zwei Kategorien untergliedert:
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung sind in dem Vermögenseinkommen enthalten, das von den Verwaltern von Alterssicherungssystemen im primären Einkommensverteilungskonto an private Haushalte gezahlt wird (Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Alterssicherungssystemen D.442). Da dieses Einkommen in der Praxis von den Verwaltern der Alterssicherungssysteme einbehalten wird, wird es im Konto der sekundären Einkommensverteilung als Beträge ausgewiesen, die von den privaten Haushalten in Form von Sozialbeiträgen aus Kapitalerträgen aus Systemen der sozialen Sicherung an die Alterssicherungssysteme zurückgezahlt wurden. Buchungszeitpunkt: Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung werden gebucht, wenn sie anfallen. |
Monetäre Sozialleistungen (D.62)
|
4.102 |
Die Position D.62 umfasst drei Unterpositionen:
|
Geldleistungen der Sozialversicherung (D.621)
|
4.103 |
Definition: Geldleistungen der Sozialversicherung sind Leistungen zur sozialen Sicherung, die von der gesetzlichen Sozialversicherung in Form von Geldleistungen an die privaten Haushalte erbracht werden. Erstattungen sind ausgeschlossen und werden als soziale Sachleistungen (D.632) behandelt. Derartige Leistungen werden im Rahmen von Sozialversicherungssystemen erbracht. Sie können untergliedert werden in
|
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung (D.622)
|
4.104 |
Definition: Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung entsprechen den von den Arbeitgebern im Zusammenhang mit anderen beschäftigungsbezogenen Systemen der sozialen Sicherung gezahlten Leistungen. Sonstige beschäftigungsbezogene Leistungen zur sozialen Sicherung sind Sozialleistungen (in Form von Geld- oder Sachleistungen), die von Systemen der sozialen Sicherung (außer der Sozialversicherung) an die Beitragszahler, ihre Angehörigen oder ihre Hinterbliebenen gezahlt werden. Typische Beispiele sind:
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung können untergliedert werden in:
|
Sonstige soziale Geldleistungen (D.623)
|
4.105 |
Definition: Sonstige soziale Geldleistungen sind laufende Transfers, die von staatlichen Einheiten oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck an private Haushalte geleistet werden und sich auf die durch Leistungen zur sozialen Sicherung gedeckten Bedürfnisse beziehen, jedoch nicht im Rahmen eines Systems der sozialen Sicherung erbracht werden, das üblicherweise die Teilnahme mittels Sozialbeiträgen erfordert. Sie schließen daher alle von der gesetzlichen Sozialversicherung gezahlten Leistungen aus. Soziale Geldleistungen können unter folgenden Umständen erbracht werden:
Nicht zu diesen Leistungen gehören laufende Transfers aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die normalerweise nicht durch Systeme der sozialen Sicherung abgedeckt sind (z. B. Transfers aufgrund von Naturkatastrophen, die den sonstigen laufenden Transfers oder den sonstigen Vermögenstransfers zugeordnet werden). |
|
4.106 |
Buchungszeitpunkt der monetären Sozialleistungen (D.62):
|
|
4.107 |
Monetäre Sozialleistungen (D.62) werden wie folgt gebucht:
|
Soziale Sachleistungen (D.63)
|
4.108 |
Definition: Soziale Sachleistungen (D.63) umfassen Waren und Dienstleistungen, die einzelnen privaten Haushalten von staatlichen Einheiten und von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck kostenlos oder zu einem wirtschaftlich nicht signifikanten Preis als Sachleistungen zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob sie von den staatlichen Einheiten oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck am Markt gekauft werden oder Teil von deren nichtmarktbestimmter Produktion sind. Soziale Sachleistungen werden aus Steuereinnahmen, sonstigen staatlichen Einkommen oder Sozialversicherungsbeiträgen bzw., im Fall von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, aus Schenkungen oder Vermögenseinkommen finanziert. Dienstleistungen, die für private Haushalte kostenlos oder zu einem wirtschaftlich nicht signifikanten Preis erbracht werden, werden als individuelle Dienstleistungen bezeichnet, um sie von kollektiven Dienstleistungen zu unterscheiden, die für die gesamte Bevölkerung oder weite Bevölkerungskreise erbracht werden, wie etwa Verteidigungsleistungen und Straßenbeleuchtung. Die individuellen Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Bildungs- und Gesundheitsleistungen, wobei häufig jedoch auch andere Arten von Dienstleistungen, etwa Wohnungsdienstleistungen oder Kultur- und Freizeitdienstleistungen, individualisierbar sind. |
|
4.109 |
Soziale Sachleistungen (D.63) untergliedern sich in:
|
|
4.110 |
Beispiele für soziale Sachleistungen (D.63) sind ärztliche, zahnärztliche oder chirurgische Behandlungen, stationäre Versorgung, Brillen oder Kontaktlinsen, medizinische Hilfsmittel und Geräte sowie vergleichbare Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Risiken und Bedürfnissen. Weitere Beispiele für Leistungen, die nicht durch ein System der sozialen Sicherung abgedeckt sind, sind die Unterbringung in Unterkünften und Wohnungen, die Kinderbetreuung in Einrichtungen, die berufliche Fortbildung, die Reduzierung von Fahrpreisen (vorausgesetzt, dass sie einem sozialen Zweck dient) sowie ähnliche Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Risiken und Bedürfnissen. Nicht unter soziale Risiken und Bedürfnissen fallen Waren und Dienstleistungen wie Freizeit-, Kultur- oder Sportdienstleistungen, die der Staat einzelnen Haushalten kostenlos oder zu einem wirtschaftlich nicht signifikanten Preis zur Verfügung stellt; diese werden als soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (D.631) behandelt. |
|
4.111 |
Buchungszeitpunkt: Soziale Sachleistungen (D.63) werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Leistungen erbracht werden bzw. zu dem die Waren, die privaten Haushalten von Produzenten direkt zur Verfügung gestellt werden, den Eigentümer wechseln. Soziale Sachleistungen (D.63) werden wie folgt gebucht:
Der Verbrauch der Waren- und Dienstleistungstransfers wird im Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) gebucht. Es gibt keine sozialen Sachleistungen, die an die übrige Welt erbracht oder von ihr empfangen werden (derartige Transfers werden unter der Position D.62 Monetäre Sozialleistungen gebucht). |
SONSTIGE LAUFENDE TRANSFERS (D.7)
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen (D.71)
|
4.112 |
Definition: Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen (D.71) umfassen Prämien aufgrund von Versicherungsverträgen, die von institutionellen Einheiten ausschließlich im eigenen Interesse abgeschlossen wurden. Bei den von einzelnen privaten Haushalten abgeschlossenen Nichtlebensversicherungverträgen handelt es sich um Versicherungsverträge, die außerhalb eines Systems der sozialen Sicherung ohne Beteiligung der Arbeitgeber und des Staates abgeschlossen werden. Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen umfassen sowohl die tatsächlichen Prämien, die von den Versicherten im Rechnungszeitraum gezahlt werden, um den Versicherungsschutz zu erlangen (verdiente Prämien), als auch die zusätzlichen Prämien in Höhe der Vermögenseinkommen aus Versicherungsverträgen abzüglich des Dienstleistungsentgelts der Versicherungsgesellschaften. Die Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen ermöglichen die Deckung der Risiken verschiedener Ereignisse oder Umstände, die auf natürliche Ursachen oder menschliche Einflussnahme zurückzuführen sind und Personen- oder Sachschäden zur Folge haben, beispielsweise Feuer, Überschwemmung, Unglück, Verkehrsunfall, Diebstahl, Gewaltanwendung, Unfall, Krankheit usw., sowie des Risikos von finanziellen Verlusten aufgrund von Ereignissen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall usw. Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen untergliedern sich in zwei Kategorien:
|
|
4.113 |
Buchungszeitpunkt: Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie verdient werden. Bei den Versicherungsprämien handelt es sich um den Teil der im laufenden Rechnungszeitraum oder in früheren Rechnungszeiträumen insgesamt eingezahlten Prämien, der im laufenden Rechnungszeitraum zur Risikodeckung bestimmt ist, abzüglich des Dienstleistungsentgelts. Die im laufenden Rechnungszeitraum verdienten Prämien unterscheiden sich von den im laufenden Rechnungszeitraum fälligen Prämien insofern, als letztere der Risikodeckung sowohl im laufenden als auch in künftigen Rechnungszeiträumen dienen können. Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen werden wie folgt gebucht:
|
Nichtlebensversicherungsleistungen (D.72)
|
4.114 |
Definition: Nichtlebensversicherungsleistungen (D.72) sind die aufgrund von Nichtlebensversicherungen fälligen Leistungen, d. h. die Beträge, die von Versicherungsgesellschaften zur Regelung von Schadensfällen zu zahlen sind, die Personen oder Sachen (einschließlich Anlagegütern) erleiden. Diese Position ist in zwei Kategorien untergliedert:
|
|
4.115 |
Nicht zu den Nichtlebensversicherungsleistungen gehören die Zahlungen, die als Sozialleistungen anzusehen sind. Die erbrachte Nichtlebensversicherungsleistung wird als Transfer an den Geschädigten behandelt. Derartige Zahlungen werden immer als laufende Transfers behandelt, selbst wenn es bei zerstörten Anlagegütern oder schwerwiegenden Personenschäden um große Beträge geht. Außergewöhnlich umfangreiche Leistungen, z. B. im Fall einer Katastrophe, werden unter Umständen nicht als laufende Transfers, sondern als Vermögenstransfers behandelt (siehe Nummer 4.165 Buchstabe k). Die an die Geschädigten gezahlten Beträge sind in der Regel nicht zweckgebunden, und die beschädigten oder zerstörten Vermögenswerte müssen nicht unbedingt repariert oder ersetzt werden. Versicherungsleistungen sind zu erbringen, weil der Versicherungsnehmer einem Dritten einen Personen- oder Sachschaden verursacht hat (Haftpflichtversicherung). Derartige Leistungen werden als von der Versicherungsgesellschaft direkt an den Geschädigten und nicht als indirekte über den Versicherungsnehmer erbrachte Leistungen gebucht. |
|
4.116 |
Nettorückversicherungsprämien und -leistungen werden in genau der gleichen Weise wie Nichtlebensversicherungsprämien und -leistungen berechnet. Da die Rückversicherungsgesellschaften in einigen wenigen Ländern konzentriert sind, bestehen die meisten Rückversicherungsverträge mit gebietsfremden Einheiten. Einige Einheiten, vor allem staatliche Einheiten, leisten möglicherweise eine Garantie für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners unter Bedingungen, die denen einer Nichtlebensversicherung entsprechen. Dies ist der Fall, wenn viele Garantien der gleichen Art übernommen werden und es möglich ist, den Gesamtumfang der Ausfälle realistisch einzuschätzen. In derartigen Fällen werden die gezahlten Gebühren (und das damit verdiente Vermögenseinkommen) ebenso behandelt wie Nichtlebensversicherungsprämien, und die Forderungen im Rahmen der standardisierten Kreditgarantien werden ebenso behandelt wie Nichtlebensversicherungsleistungen. |
|
4.117 |
Buchungszeitpunkt: Nichtlebensversicherungsleistungen werden zum Zeitpunkt des Schadenseintritts gebucht. Sie werden wie folgt gebucht:
|
Laufende Transfers innerhalb des Staates (D.73)
|
4.118 |
Definition: Die laufenden Transfers innerhalb des Staates (D.73) enthalten Transfers zwischen den verschiedenen Teilsektoren des Staates (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) mit Ausnahme von Steuern, Subventionen, Investitionszuschüssen und sonstigen Vermögenstransfers. Zu den laufenden Transfers innerhalb des Staates (D.73) gehören nicht die Transaktionen zugunsten einer anderen institutionellen Einheit. Diese sind nur einmal zu buchen, und zwar als Aufkommen der Einheit, zu deren Gunsten die Transaktion durchgeführt wird (siehe Nummer 1.78). Dies geschieht, wenn eine Körperschaft (z. B. der Bund) Steuern einnimmt, die vollständig oder teilweise einer anderen staatlichen Stelle (z. B. einer lokalen Gebietskörperschaft) zustehen. In derartigen Fällen wird der der anderen staatlichen Stelle zustehende Anteil als direkt von dieser Stelle erhobene Steuer gebucht und nicht als laufende Transfers innerhalb des Staates. Die Lösung bietet sich insbesondere dann an, wenn Steuern in Form von Zuschlägen zu Steuern des Bundes (Zentralstaats) erhoben werden, jedoch für andere staatliche Stellen bestimmt sind. Verzögerungen bei der Weiterleitung der Steuern von der einen an die andere staatliche Einheit sind im Finanzierungskonto als sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten zu buchen. Transfers von Steuereinnahmen, die als Teil eines Pauschaltransfers vom Bund (Zentralstaat) an andere staatliche Stellen überwiesen werden, (z. B. im Rahmen des Finanzausgleichs), zählen zu den laufenden Transfers innerhalb des Staates. Derartige Transfers sind an keine besondere Steuerart gebunden und erfolgen nicht automatisch, sondern hauptsächlich über bestimmte Fonds (Provinzialfonds, Gemeindefonds) und entsprechend bestimmten vom Bund (Zentralstaat) festgesetzten Verteilungsschlüsseln (z. B. allgemeine Finanzzuweisung). |
|
4.119 |
Buchungszeitpunkt: Laufende Transfers innerhalb des Staates werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zu erfolgen haben. |
|
4.120 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates werden auf der Verwendungs- und der Aufkommensseite des Kontos der sekundären Einkommensverteilung der Teilsektoren des Staates verbucht. Bei den laufenden Transfers innerhalb des Staates handelt es sich um innersektorale Ströme, die in den konsolidierten Konten für den gesamten Sektor Staat nicht erscheinen. |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit (D.74)
|
4.121 |
Definition: Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit (D.74) umfassen alle Sach- und Geldtransfers zwischen dem Staat und staatlichen Stellen oder internationalen Organisationen in der übrigen Welt außer Investitionszuschüssen und sonstigen Vermögenstransfers. |
|
4.122 |
Die Position D.74 enthält:
Die laufenden Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit umfassen auch Übertragungen zwischen dem Staat und den im Land ansässigen internationalen Organisationen, da internationale Organisationen nicht als gebietsansässige institutionelle Einheiten des Landes, in dem sie ansässig sind, behandelt werden. |
|
4.123 |
Buchungszeitpunkt: Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit werden entweder zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Übertragungen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften vorzunehmen sind (Pflichttransfers), oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erfolgen (freiwillige Transfers). |
|
4.124 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit werden wie folgt gebucht:
|
Übrige laufende Transfers (D.75)
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (D.751)
|
4.125 |
Definition: Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck umfassen alle Spenden (außer Vermächtnissen), Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse, die private Organisationen ohne Erwerbszweck von privaten Haushalten (einschließlich gebietsfremder privater Haushalte) und in geringerem Umfang auch von anderen Einheiten erhalten. |
|
4.126 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck umfassen:
Nicht zu den laufenden Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck gehören Mitgliedsbeiträge an marktbestimmte Organisationen ohne Erwerbszweck im Dienst von Kapitalgesellschaften, wie etwa Industrie- und Handelskammern oder Fachverbände; diese Beiträge werden als Dienstleistungsentgelte gebucht. |
|
4.127 |
Buchungszeitpunkt: Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erfolgen. |
|
4.128 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck werden wie folgt gebucht:
|
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten (D.752)
|
4.129 |
Definition: Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten (D.752) umfassen alle laufenden Geld- und Sachtransfers, die gebietsansässige private Haushalte an andere gebietsansässige oder an gebietsfremde private Haushalte leisten oder von diesen empfangen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Geldüberweisungen von Auswanderern und dauernd im Ausland wohnenden (oder mindestens ein Jahr lang im Ausland arbeitenden) Arbeitnehmern an ihre im Herkunftsland verbliebenen Familienangehörigen oder von Eltern an ihre an einem anderen Ort lebenden Kinder. |
|
4.130 |
Buchungszeitpunkt der laufenden Transfers zwischen privaten Haushalten: sie werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erfolgen. |
|
4.131 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten werden wie folgt gebucht:
|
Übrige laufende Transfers, a.n.g. (D.759)
Geldstrafen und gebührenpflichtige Verwarnungen
|
4.132 |
Definition: Geldstrafen und gebührenpflichtige Verwarnungen, die gegen institutionelle Einheiten von Gerichten oder Organen mit quasi-richterlichen Aufgaben ausgesprochen wurden, werden als übrige laufende Transfers (D.759) behandelt. |
|
4.133 |
Nicht zu den übrigen laufenden Transfers, a.n.g. (D.759) zählen:
|
|
4.134 |
Buchungszeitpunkt: Geldstrafen und gebührenpflichtige Verwarnungen werden zum Zeitpunkt des Entstehens der Verbindlichkeit gebucht. |
Lotterien und Spiele
|
4.135 |
Definition: Die für Lotterielose gezahlten oder bei Wetten und Spielen eingesetzten Beträge umfassen zwei Teile: das Dienstleistungsentgelt an den Lotterie-, Wett- oder Spielveranstalter und einen verbleibenden Teil, der als laufender Transfer an die Gewinner ausgezahlt wird. Das Dienstleistungsentgelt kann einen wesentlichen Betrag ausmachen und schließt Wett- und Lotteriesteuern ein. Die laufenden Transfers werden im ESVG direkt zwischen den Lotterie- oder Wettspielern, also zwischen privaten Haushalten, gebucht. Sofern sich Gebietsfremde an Lotterien, Spielen oder Wetten im Inland beteiligen, kann es zu beachtlichen Nettotransfers zwischen den Sektoren private Haushalte und übrige Welt kommen. Buchungszeitpunkt: Laufende Transfers werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erfolgen. |
Entschädigungszahlungen
|
4.136 |
Definition: Entschädigungszahlungen sind laufende Transfers, mit Ausnahmen von Nichtlebensversicherungsleistungen, die von institutionellen Einheiten an andere institutionelle Einheiten geleistet werden, um sie für Personen- oder Sachschäden zu entschädigen. Bei den Entschädigungszahlungen handelt es sich um gerichtlich angeordnete Pflichtzahlungen oder außergerichtlich vereinbarte freiwillige Zahlungen. Die Position umfasst auch freiwillige Entschädigungszahlungen von staatlichen Einheiten oder privaten Organisationen ohne Erwerbszweck für Katastrophenschäden, sofern sie nicht den Vermögenstransfers zuzuordnen sind. |
|
4.137 |
Buchungszeitpunkt: Entschädigungszahlungen werden zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erfolgen (freiwillige Zahlungen) oder zu dem sie fällig sind (Pflichtzahlungen). |
|
4.138 |
Sonstige Formen übriger laufender Transfers
|
|
4.139 |
Buchungszeitpunkt: Mit Ausnahme der Transfers des Staates und der Transfers an den Staat, die zum Fälligkeitszeitpunkt auszuweisen sind, werden die unter Nummer 4.138 aufgeführten Transfers zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erfolgen. Die übrigen laufenden Transfers werden wie folgt gebucht:
|
MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel (D.76)
|
4.140 |
Definition: Die Zahlungen im Rahmen der auf dem BNE und der Mehrwertsteuer basierenden dritten und vierten Eigenmittelquelle (D.76) sind laufende Transfers des Sektors Staat der EU-Mitgliedstaaten an die Organe der Europäischen Union. Die MwSt.-Eigenmittel der EU (dritte Eigenmittelquelle) (D.761) und die BNE-Eigenmittel der EU (vierte Eigenmittelquelle) (D.762) sind Beiträge zum Haushalt der Organe der Union. Die Höhe des Beitrags der einzelnen Mitgliedstaaten richtet sich nach der Höhe ihrer MwSt.-Bemessungsgrundlage und ihres BNE. Die Position D.76 umfasst auch sonstige Beiträge des Staates an die Organe der Europäischen Union (ohne Steuern) (D.763). Buchungszeitpunkt: Zahlungen im Rahmen der auf der Mehrwertsteuer und dem Bruttonationaleinkommen basierenden dritten bzw. vierten Eigenmittelquelle werden zum Fälligkeitszeitpunkt gebucht. Die Zahlungen im Rahmen der MwSt.- und BNE-basierten dritten bzw. vierten Eigenmittelquelle werden wie folgt gebucht:
|
ZUNAHME BETRIEBLICHER VERSORGUNGSANSPRÜCHE (D.8)
|
4.141 |
Definition: Die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8) hat den Zweck, in die Ersparnis der privaten Haushalte die Veränderung der Alterssicherungsansprüche einzubeziehen, auf die die privaten Haushalte einen festen Anspruch haben. Die Veränderung der Versorgungsansprüche entsteht durch Beitragszahlungen und Leistungen, die im Konto der sekundären Einkommensverteilung nachgewiesen werden. |
|
4.142 |
Da die Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen im ESVG in den Finanzierungskonten und in den Vermögensbilanzen als Forderungen der privaten Haushalte ausgewiesen werden, muss durch einen Berichtigungsposten gewährleistet werden, dass sich der Beitrag, um den die Alterssicherungsbeiträge die Alterssicherungsleistungen gegebenenfalls übersteigen, nicht auf die Ersparnis der privaten Haushalte auswirkt. Zu diesem Zweck wird in den Einkommensverwendungskonten das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (Ausgaben- wie auch Verbrauchskonzept) vor dem Ausweis der Ersparnis um einen Posten ergänzt, der wie folgt errechnet wird: Gesamtbetrag der tatsächlichen und unterstellten Sozialbeiträge zur Alterssicherung, die an Alterssicherungssysteme geleistet werden, gegenüber denen die privaten Haushalte einen festen Anspruch haben
Auf diese Weise ergibt sich für die Ersparnis der privaten Haushalte derselbe Wert, der sich ergeben hätte, wenn die Alterssicherungsbeiträge und -leistungen nicht im Konto der sekundären Einkommensverteilung als laufende Transfers gebucht worden wären. Dieser Berichtigungsposten ist erforderlich, damit die Ersparnis der privaten Haushalte mit der Veränderung ihrer Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen im Finanzierungskonto in Einklang steht. Im Einkommensverwendungskonto der für die Zahlung von Alterssicherungsleistungen zuständigen Einheiten ist selbstverständlich eine entsprechende Gegenberichtigung vorzunehmen. |
|
4.143 |
Buchungszeitpunkt: Der Berichtigungsposten wird zum gleichen Zeitpunkt wie seine Bestandteile gebucht. |
|
4.144 |
Die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche wird wie folgt gebucht:
|
VERMÖGENSTRANSFERS (D.9)
|
4.145 |
Definition: Vermögenstransfers setzen den Zugang oder den Abgang eines oder mehrerer Vermögenswerte bei mindestens einem der Transaktionspartner voraus. Sie ziehen, unabhängig davon, ob es sich um Geld- oder um Sachtransfers handelt, eine entsprechende Veränderung der in der Vermögensbilanz eines oder beider Transaktionspartner ausgewiesenen finanziellen oder nichtfinanziellen Aktiva nach sich. |
|
4.146 |
Ein Sachvermögenstransfer ist die Übertragung des Eigentums an einem Vermögenswert (außer an Vorräten und an Bargeld) ohne Gegenleistung oder die Aufhebung einer Verbindlichkeit seitens eines Gläubigers, wobei auf die Schuldtilgung verzichtet wird. Ein Geldvermögenstransfer ist die Übertragung von Bargeld ohne Gegenleistung, das sich entweder der Geldgeber durch die Veräußerung eines oder mehrerer Vermögenswerte (außer Vorräten) beschafft hat oder das der Empfänger für den Erwerb eines oder mehrerer Vermögenswerte (außer Vorräten) verwenden soll. Geldvermögenstransfers erfolgen häufig unter der Bedingung, dass ihr Empfänger einen Vermögenswert oder mehrere Vermögenswerte erwirbt. Der Transferwert eines nichtfinanziellen Aktivums wird bestimmt anhand des geschätzten Preises, zu dem das (neue oder gebrauchte) Vermögensgut auf dem Markt verkauft werden könnte, zuzüglich Transport-, Installations- oder anderer dem Geber entstehender Kosten der Eigentumsübertragung, jedoch ohne entsprechende dem Empfänger entstehende Kosten. Transfers finanzieller Aktiva werden in der gleichen Weise bewertet wie andere Erwerbe oder Veräußerungen von Forderungen oder Verbindlichkeiten. |
|
4.147 |
Vermögenstransfers umfassen vermögenswirksame Steuern (D.91), Investitionszuschüsse (D.92) und sonstige Vermögenstransfers (D.99). |
Vermögenswirksame Steuern (D.91)
|
4.148 |
Definition: Vermögenswirksame Steuern (D.91) sind Zwangsabgaben, die in unregelmäßigen und sehr großen Abständen auf den Wert der Vermögensgegenstände oder das Reinvermögen der institutionellen Einheiten bzw. auf Vermögenswerte erhoben werden, die zwischen institutionellen Einheiten aufgrund von Vermächtnissen, Schenkungen oder anderen Transfers übertragen werden. |
|
4.149 |
Die vermögenswirksamen Steuern (D.91) umfassen:
Kapitalertragsteuern werden nicht als vermögenswirksame Steuern, sondern als laufende Steuern auf Einkommen, Vermögen usw. behandelt. |
|
4.150 |
Für die Verbuchung von Steuern in den Konten kommen zwei Quellen in Betracht: auf Veranlagungen und Erklärungen beruhende Beträge oder Kasseneinnahmen.
|
|
4.151 |
Vermögenswirksame Steuern werden wie folgt gebucht:
|
Investitionszuschüsse (D.92)
|
4.152 |
Definition: Investitionszuschüsse (D.92) sind Geld- oder Sachvermögenstransfers des Staates oder der übrigen Welt an andere gebietsansässige oder gebietsfremde institutionelle Einheiten, die dazu bestimmt sind, den Erwerb von Anlagevermögen seitens dieser Einheiten ganz oder teilweise zu finanzieren. Investitionszuschüsse aus der übrigen Welt sind namentlich diejenigen, die direkt von den Organen der Europäischen Union überwiesen werden (z. B. Vermögensübertragungen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raum (ELER)). |
|
4.153 |
Investitionszuschüsse in Form von Sachtransfers umfassen die unentgeltlichen Übertragungen von Transportmitteln, Ausrüstungen und sonstigen beweglichen Anlagegütern seitens des Staates an andere gebietsansässige oder gebietsfremde Einheiten sowie die direkte Bereitstellung von Gebäuden oder sonstigen unbeweglichen Anlagegütern an gebietsansässige oder gebietsfremde Einheiten. |
|
4.154 |
Der Wert von Anlageinvestitionen, die der Staat zugunsten anderer Sektoren der Volkswirtschaft tätigt, ist unter den Investitionszuschüssen zu buchen, soweit der Begünstigte eindeutig feststeht und das Eigentum an den Anlagen erwirbt. In diesem Fall sind die Anlageinvestitionen unter den Änderungen der Aktiva im Vermögensbildungskonto des begünstigten Sektors nachzuweisen, finanziert durch einen Investitionszuschuss in gleicher Höhe, der bei den Änderungen der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens desselben Kontos verbucht wird. |
|
4.155 |
Investitionszuschüsse (D.92) umfassen sowohl einmalige Zahlungen für die Finanzierung von Investitionen während des gleichen Zeitraums als auch zeitlich gestaffelte Zahlungen, die sich auf Anlageinvestitionen beziehen, die im Laufe früherer Perioden durchgeführt wurden. Jährliche Zahlungen des Staates an Unternehmen, die Tilgungsraten von Schulden der Unternehmen darstellen, welche diese zur Durchführung von staatlichen Investitionsvorhaben aufgenommen haben, werden als Investitionszuschüsse behandelt. |
|
4.156 |
Nicht zu den Investitionszuschüssen gehören vom Staat gewährte Zinszuschüsse. Die Übernahme eines Teils der Zinsbelastung durch die öffentliche Hand ist eine Einkommensverteilungstransaktion. Dies gilt nicht für den Fall, in dem ein Zuschuss gleichzeitig zur Tilgung des aufgenommenen Kredits und zur Zinszahlung verwendet werden kann, ohne dass diese beiden Elemente getrennt nachweisbar sind. In diesem Fall ist der gesamte Zuschuss als Investitionszuschuss zu buchen. |
|
4.157 |
Investitionszuschüsse an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften umfassen außer den Zuschüssen an private Unternehmen auch die Zuweisungen an öffentliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, soweit nicht die staatliche Stelle, welche die Mittel gewährt, damit eine Forderung gegenüber den öffentlichen Unternehmen erwirbt. |
|
4.158 |
Investitionszuschüsse an den Sektor private Haushalte umfassen außer Modernisierungsprämien an Unternehmen, die keine Kapital- oder Quasi-Kapitalgesellschaften sind, die Prämien, die privaten Haushalten für den Wohnungsbau, -erwerb oder -umbau gewährt werden. |
|
4.159 |
Investitionszuschüsse an staatliche Stellen umfassen Zahlungen (außer Zinszuschüsse) an Teilsektoren des Staates, die den Zweck haben, Anlageinvestitionen zu finanzieren. Investitionszuschüsse zwischen staatlichen Stellen sind innersektorale Ströme, die in den konsolidierten Konten für den gesamten Staatssektor nicht erscheinen. Beispiele für Investitionszuschüsse innerhalb des Sektors Staat sind die Zuweisungen des Bundes (Zentralstaats) an die Gemeinden, deren ausdrücklicher Zweck in der Finanzierung von Anlageinvestitionen besteht. Transfers für verschiedene unbestimmte Zwecke werden als laufende Transfers innerhalb des Staatssektors gebucht, selbst wenn sie zur Deckung von Investitionsausgaben herangezogen werden. |
|
4.160 |
Investitionszuschüsse des Staates oder der übrigen Welt an private Organisationen ohne Erwerbszweck sind anhand des in Nummer 4.159 genannten Kriteriums von den laufenden Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck abzugrenzen. |
|
4.161 |
Investitionszuschüsse an die übrige Welt sind ebenfalls auf Transfers beschränkt, deren besonderer Zweck die Finanzierung von Anlageinvestitionen gebietsfremder Einheiten ist. Sie betreffen beispielsweise verlorene Zuschüsse zum Bau von Brücken, Fabriken, Krankenhäusern, Schulen in Entwicklungsländern oder für den Bau von Gebäuden für internationale Organisationen. Sie können sowohl zeitlich gestaffelte als auch einmalige Zahlungen umfassen. Die geschenkte oder verbilligte Lieferung von Anlagegütern ist ebenfalls in dieser Position nachzuweisen. |
|
4.162 |
Buchungszeitpunkt: Investitionszuschüsse in Form von Geldtransfers werden zum Fälligkeitszeitpunkt gebucht. Investitionszuschüsse in Form von Sachtransfers werden zu dem Zeitpunkt ausgewiesen, zu dem das Eigentum an dem Vermögenswert übertragen wird. |
|
4.163 |
Investitionszuschüsse werden wie folgt gebucht:
|
Sonstige Vermögenstransfers (D.99)
|
4.164 |
Definition: Als sonstige Vermögenstransfers (D.99) werden alle Transfers (außer Investitionszuschüssen und vermögenswirksamen Steuern) erfasst, die keine Transaktionen der Einkommensverteilung darstellen, sondern eine Ersparnis- oder Vermögensumverteilung zwischen den verschiedenen Sektoren oder Teilsektoren der Volkswirtschaft oder mit der übrigen Welt bewirken. Sie können in Form von Geld- oder Sachtransfers erfolgen (bei Schuldenübernahme oder Schuldenaufhebung) und entsprechen freiwilligen Vermögenstransfers. |
|
4.165 |
Die sonstigen Vermögenstransfers (D.99) enthalten folgende Transaktionen:
|
|
4.166 |
Der Buchungszeitpunkt wird wie folgt festgelegt:
|
|
4.167 |
Die sonstigen Vermögenstransfers werden unter der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens im Vermögensbildungskonto der Sektoren und dem Außenkonto der Vermögensbildung ausgewiesen. |
MITARBEITERAKTIENOPTIONEN
|
4.168 |
Eine besondere Form des Sacheinkommens besteht darin, dass ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer die Option einräumt, zu einem künftigen Zeitpunkt Aktien (Anteile) zu einem im Voraus festgelegten Preis zu erwerben. Die Mitarbeiteraktienoption ähnelt einem Finanzderivat. Der Arbeitnehmer wird von der Option möglicherweise keinen Gebrauch machen, weil entweder der Aktienkurs nun niedriger ist als der Preis, zu dem er das Optionsrecht ausüben kann, oder weil er nicht mehr bei dem Arbeitgeber beschäftigt ist und daher das Optionsrecht verloren hat. |
|
4.169 |
Üblicherweise informiert ein Arbeitgeber die von ihm beschäftigten Arbeitnehmer über seinen Beschluss, eine Aktienoption zu einem bestimmten Preis (Basis- oder Ausübungspreis) nach einer bestimmten Zeit unter bestimmten Bedingungen (zum Beispiel, dass das Beschäftigungsverhältnis noch besteht, oder in Abhängigkeit vom Erfolg des Unternehmens) einzuräumen. Der Buchungszeitpunkt der Mitarbeiteraktienoption in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen muss genau festgelegt werden. Der „Tag der Gewährung“ ist der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer das Optionsrecht erhält, der „Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit“ ist der früheste Zeitpunkt, zu dem das Optionsrecht ausgeübt werden kann, und der „Tag der Ausübung“ der Zeitpunkt, zu dem das Optionsrecht tatsächlich ausgeübt wird (oder erlischt). |
|
4.170 |
Den Buchungsempfehlungen des International Accounting Standards Board (IASB) zufolge ermittelt das Unternehmen einen beizulegenden Zeitwert für die Optionen am Tag der Gewährung, indem es den Basispreis der Anteile zu diesem Zeitpunkt mit der Anzahl der Optionen multipliziert, die am Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit voraussichtlich ausübbar werden, dividiert durch die Anzahl der Dienstjahre, die voraussichtlich bis zum Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit abgeleistet werden. |
|
4.171 |
Im ESVG kann der Wert der Optionen mit Hilfe eines Aktienoptionspreismodells geschätzt werden, wenn es weder einen beobachtbaren Marktpreis noch eine Schätzung durch die Kapitalgesellschaft entsprechend den vorgenannten Empfehlungen gibt. Mit einem solchen Modell sollen zwei Auswirkungen auf den Wert der Option erfasst werden. Erstens wird der Betrag vorausgeschätzt, um den der Marktpreis der betreffenden Anteile den Basiswert am Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit übersteigen wird. Zweitens wird die Erwartung berücksichtigt, dass der Preis vom Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit bis zum Tag der Ausübung weiter steigt. |
|
4.172 |
Vor der Ausübung des Optionsrechts hat die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Charakter eines Finanzderivats und wird als solches in den Finanzierungskonten beider Parteien ausgewiesen. |
|
4.173 |
Eine Schätzung des Werts der Mitarbeiteraktienoption erfolgt zum Tag der Gewährung. Dieser Betrag ist, wenn möglich, in das über den Zeitraum vom Tag der Gewährung bis zum Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit verteilte Arbeitnehmerentgelt einzubeziehen. Wenn dies nicht möglich ist, ist der Wert der Option zum Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit zu buchen. |
|
4.174 |
Die Kosten der Verwaltung von Mitarbeiteraktienoptionen trägt der Arbeitgeber, sie werden ebenso wie alle anderen Verwaltungsaufgaben in Verbindung mit dem Arbeitnehmerentgelt als Teil der Vorleistungen behandelt. |
|
4.175 |
Der Wert der Aktienoption wird zwar als Einkommen betrachtet, aber Mitarbeiteraktienoptionen sind nicht mit Kapitalerträgen verbunden. |
|
4.176 |
In den Finanzierungskonten wird der Erwerb von Mitarbeiteraktienoptionen durch private Haushalte dem entsprechenden Teil des Arbeitnehmerentgelts mit einer entsprechenden Verbindlichkeit des Arbeitgebers zugeordnet. |
|
4.177 |
Grundsätzlich ist jede Änderung des Werts ab dem Tag der Gewährung bis zum Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit als Teil des Arbeitnehmerentgelts zu behandeln, während jede Änderung des Werts ab dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit bis zum Tag der Ausübung nicht als Arbeitnehmerentgelt, sondern als Umbewertungsgewinn oder -verlust behandelt wird. In der Praxis ist es höchst unwahrscheinlich, dass Schätzungen der Kosten von Mitarbeiteraktienoptionen für die Arbeitgeber vom Tag der Gewährung bis zum Tag der Ausübung geändert werden. Aus pragmatischen Gründen wird daher der gesamte Wertanstieg vom Tag der Gewährung bis zum Tag der Ausübung als Umbewertungsgewinn oder -verlust behandelt. Eine Erhöhung des Werts der Aktie über den Basispreis hinaus ist ein Umbewertungsgewinn für den Arbeitnehmer und ein Umbewertungsverlust für den Arbeitgeber und umgekehrt. |
|
4.178 |
Wird eine Mitarbeiteraktienoption ausgeübt, so wird der Eintrag in der Vermögensbilanz gelöscht und durch den Wert der erworbenen Aktien (Anteile) ersetzt. Diese Änderung bei der Klassifikation erfolgt über Transaktionen in den Finanzierungskonten und nicht über das Konto sonstiger realer Vermögensänderungen. |
KAPITEL 5
FINANZIELLE TRANSAKTIONEN
|
5.01 |
Definition: Finanzielle Transaktionen (F) sind Transaktionen mit Forderungen (AF) und mit Verbindlichkeiten zwischen gebietsansässigen institutionellen Einheiten und gebietsfremden institutionellen Einheiten. |
|
5.02 |
Eine finanzielle Transaktion zwischen institutionellen Einheiten beinhaltet die gleichzeitige Entstehung oder Auflösung einer Forderung und der ihr gegenüberstehenden Verbindlichkeit, die Übertragung des Eigentums an einer Forderung oder die Übernahme einer Verbindlichkeit. |
ÜBERBLICK ÜBER FINANZIELLE TRANSAKTIONEN
Finanzielle Vermögenswerte, finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten
|
5.03 |
Definition: Finanzielle Vermögenswerte bestehen aus allen Forderungen, aus Anteilsrechten und dem Teil des Währungsgoldes, der aus Barrengold besteht. |
|
5.04 |
Diese Forderungen sind Wertaufbewahrungsmittel und stehen für Erträge oder Reihen von Erträgen, die der wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die Vermögenswerte eine Zeitlang hält oder nutzt. Sie sind Mittel, um Werte von einem Rechnungszeitraum auf den nächsten zu übertragen. Die Realisierung von Erträgen oder Reihen von Erträgen erfolgt durch Zahlungen, in der Regel in Form von Bargeld (AF.21) oder von Sichteinlagen (AF.22). |
|
5.05 |
Definition: Eine Forderung ist das Recht eines Gläubigers, von einem Schuldner eine Zahlung oder Reihen von Zahlungen zu erhalten. Forderungen sind finanzielle Vermögenswerte, denen Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5) werden als Forderung mit einer gegenüberstehenden Verbindlichkeit behandelt, obwohl sich der Anspruch des Anteilsinhabers gegenüber der Gesellschaft nicht auf einen festen Betrag beläuft. |
|
5.06 |
Definition: Verbindlichkeiten entstehen, wenn ein Schuldner verpflichtet ist, Zahlungen oder Reihen von Zahlungen an einen Gläubiger zu leisten. |
|
5.07 |
Der aus Barrengold bestehende Teil des Währungsgoldes, das die Währungsbehörden als Währungsreserve halten, wird als Forderung behandelt, obwohl der Inhaber keine Ansprüche gegen bestimmte andere Einheiten hat. Für Barrengold gibt es keine gegenüberstehende Verbindlichkeit. |
Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten
|
5.08 |
Definition: Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten sind Verträge, die eine Seite nur dann zu einer Zahlung oder einer Reihe von Zahlungen an eine andere Einheit verpflichtet, wenn bestimmte festgelegte Bedingungen erfüllt sind. Da sich aus ihnen keine unbedingten Verpflichtungen ergeben, werden Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten nicht als Forderungen und Verbindlichkeiten betrachtet. |
|
5.09 |
Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten umfassen:
|
|
5.10 |
Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten umfassen nicht:
|
|
5.11 |
Obwohl Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten im ESVG nicht erfasst werden, sind sie für politische und Analysezwecke von Bedeutung; es wird empfohlen, über sie Informationen zu erfassen und ergänzende Daten aufzubereiten. Obwohl möglicherweise überhaupt keine Zahlungen für Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten zu leisten sind, ist ihr gehäuftes Auftreten u.U. ein Anzeichen für ein allzu hohes Risikoniveau bei den Einheiten, die sie anbieten. |
Kasten 5.1 — Behandlung von Garantien/Bürgschaften im ESVG
|
B5.1.1. |
Definition: Garantien/Bürgschaften sind Vereinbarungen, in denen sich eine Seite, der Garantiegeber bzw. Bürge, gegenüber einem Gläubiger verpflichtet, ihm den Schaden zu ersetzen, der ihm entsteht, wenn der Schuldner ausfällt. Oft ist für die Leistung einer Garantie oder Bürgschaft eine Gebühr zu zahlen. |
|
B5.1.2. |
Es werden drei verschiedene Arten von Garantien/Bürgschaften unterschieden: Alle drei betreffen ausschließlich Garantien oder Bürgschaften für Forderungen. Für Garantien in Form von Gewährleistung oder anderer Garantien von Herstellern wird keine besondere Behandlung vorgeschlagen. Es gibt drei Arten von Garantien/Bürgschaften:
|
Kategorien von Forderungen und Verbindlichkeiten
|
5.12 |
Es werden acht Forderungskategorien unterschieden:
|
|
5.13 |
Jeder Forderung steht eine gleich hohe Verbindlichkeit gegenüber, mit Ausnahme des aus Barrengold bestehenden Teils des Währungsgoldes, das die Währungsbehörden als Währungsreserve halten und das unter Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1) eingeordnet ist. Mit dieser Ausnahme werden acht Arten von Verbindlichkeiten unterschieden, die den Arten der gegenüberstehenden Forderungen entsprechen. |
|
5.14 |
Die Gliederung der finanziellen Transaktionen entspricht der Gliederung der Forderungen und Verbindlichkeiten. Es werden acht Arten von finanziellen Transaktionen unterschieden betreffend:
|
|
5.15 |
Wegen der Symmetrie der Forderungen und Verbindlichkeiten wird der Begriff Instrument so benutzt, dass er sich auf beides bezieht: sowohl auf den Forderungs- als auch auf den Verbindlichkeitsaspekt von finanziellen Transaktionen. Dieser Begriff wird nicht im Sinne einer Erweiterung verwendet, bei der Forderungen und Verbindlichkeiten auch Posten unter dem Strich beinhalten, die in Währungs- und Finanzstatistiken bisweilen als Finanzinstrumente beschrieben werden. |
Vermögensbilanzen, Finanzierungskonto und sonstige Ströme
|
5.16 |
Die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Bestände an Forderungen und Verbindlichkeiten werden in der Vermögensbilanz erfasst. Finanzielle Transaktionen bewirken Änderungen zwischen der Eröffnungs- und der Schlussbilanz. Die Änderungen zwischen der Eröffnungsbilanz und der Schlussbilanz umfassen auch sonstige Ströme, die nicht im gegenseitigen Einvernehmen zwischen institutionellen Einheiten erfolgen. Dazu zählen die Umbewertung von Forderungen und in gleicher Höhe der Verbindlichkeiten sowie die sonstigen Volumenänderungen, die nicht auf finanziellen Transaktionen beruhen. Umbewertungen werden im Umbewertungskonto, Volumenänderungen im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen gebucht. |
|
5.17 |
Das Finanzierungskonto schließt die Transaktionskonten ab. Der Finanzierungssaldo wird nicht auf das folgende Konto übertragen. Der Nettoerwerb von Forderungen abzüglich der Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten ergibt als Saldo des Finanzierungskontos den Finanzierungssaldo (B.9F), und zwar den Finanzierungsüberschuss (+) oder das Finanzierungsdefizit (-). |
|
5.18 |
Der Finanzierungssaldo des Finanzierungskontos entspricht theoretisch dem Saldo des Vermögensbildungskontos. In der Praxis können die beiden Salden etwas voneinander abweichen, da sie anhand unterschiedlicher statistischer Daten berechnet werden. |
Bewertung
|
5.19 |
Finanzielle Transaktionen werden zum Transaktionswert gebucht, d.h. zu dem Wert in Landeswährung, zu dem die betreffenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus rein kommerziellen Gründen geschaffen, aufgelöst, übernommen oder zwischen institutionellen Einheiten ausgetauscht wurden. |
|
5.20 |
Finanzielle Transaktionen und die ihnen gegenüberstehenden finanziellen bzw. nichtfinanziellen Transaktionen werden mit demselben Transaktionswert ausgewiesen. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten:
|
|
5.21 |
Der Transaktionswert bezieht sich jeweils auf eine bestimmte finanzielle Transaktion und die ihr gegenüberstehende Transaktion. Dieser Wert braucht nicht dem am Markt notierten Preis, einem angemessenen Marktpreis oder einem Preis zu entsprechen, der für die Mehrheit der Preise einer Gruppe von vergleichbaren Forderungen und Verbindlichkeiten gilt. Wenn jedoch die gegenüberstehende Transaktion zu einer Finanztransaktion, wie beispielsweise bei einer Transferzahlung, möglicherweise nicht aus ökonomischen Gründen erfolgt, wird für den Transaktionswert der Marktwert der betroffenen Forderung bzw. Verbindlichkeit verwendet. |
|
5.22 |
Nicht zum Transaktionswert zählen Gebühren, Provisionen oder andere Entgelte für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Transaktion erbracht werden. Solche Posten werden als Kauf von Dienstleistungen gebucht. Auch Steuern gehen nicht in den Transaktionswert ein, sondern werden als Gütersteuern auf Dienstleistungen ausgewiesen. Werden im Rahmen einer finanziellen Transaktion neue Verbindlichkeiten eingegangen, ist der Transaktionswert gleich dem Betrag der eingegangenen Verbindlichkeiten abzüglich im Voraus gezahlter Zinsen. Wird eine Verbindlichkeit aufgelöst, ist der Transaktionswert sowohl für den Gläubiger als auch für den Schuldner gleich dem Betrag, um den sich die entsprechenden Verbindlichkeiten verringern. |
Netto- und Bruttoverbuchung
|
5.23 |
Definition: Nettoverbuchung finanzieller Transaktionen bedeutet, dass Forderungserwerbe abzüglich der Abgänge von Forderungen und aufgenommene Verbindlichkeiten abzüglich der Rückzahlung von Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Finanztransaktionen können netto und übergreifend für Forderungen mit unterschiedlichen Merkmalen sowie unterschiedlichen Schuldnern oder Gläubigern dargestellt werden, sofern sie zur selben Kategorie oder Unterkategorie gehören. |
|
5.24 |
Definition: Die Bruttoverbuchung finanzieller Transaktionen bedeutet, dass Erwerbe und Abgänge von Forderungen ebenso gesondert ausgewiesen werden wie die Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten. Die Bruttoverbuchung finanzieller Transaktionen weist für den positiven und den negativen Finanzierungssaldo denselben Betrag aus wie eine Nettoverbuchung der Transaktion. Finanzielle Transaktionen sind bei ausführlichen Finanzmarktanalysen brutto darzustellen. |
Konsolidierung
|
5.25 |
Definition: Die Konsolidierung im Finanzierungskonto ist die Aufrechnung von Transaktionen mit Forderungen für eine bestimmte Gruppe institutioneller Einheiten mit den gegenüberstehenden Transaktionen mit Verbindlichkeiten für dieselbe Gruppe institutioneller Einheiten. Die Konsolidierung lässt sich auf Ebene der Gesamtwirtschaft, der institutionellen Sektoren und der Teilsektoren durchführen. Das Finanzierungskonto der übrigen Welt ist per definitionem konsolidiert, da nur die Transaktionen der gebietsfremden institutionellen Einheiten mit gebietsansässigen institutionellen Einheiten erfasst werden. |
|
5.26 |
Für bestimmte Arten von Analysen eignen sich unterschiedliche Konsolidierungsebenen. So werden bei einer Konsolidierung des Finanzierungskontos für die Gesamtwirtschaft die finanziellen Transaktionen mit gebietsfremden institutionellen Einheiten hervorgehoben, da bei der Konsolidierung alle finanziellen Transaktionen zwischen gebietsansässigen institutionellen Einheiten gegeneinander aufgerechnet werden. Die Konsolidierung der Sektoren ermöglicht die Ermittlung aller finanziellen Transaktionen zwischen den Sektoren anhand des positiven oder negativen Finanzierungssaldos. Wird bei finanziellen Kapitalgesellschaften auf der Ebene der Teilsektoren konsolidiert, so liefert dies u.U. detaillierte Daten über die finanzielle Mittlertätigkeit und ermöglicht beispielsweise die Ermittlung der Transaktionen von Kreditinstituten mit anderen finanziellen Kapitalgesellschaften sowie mit anderen gebietsansässigen Sektoren und gebietsfremden institutionellen Einheiten. Zusätzliche Erkenntnisse kann auch die Konsolidierung auf der Ebene der Teilsektoren im Sektor Staat ergeben, da hierbei die Transaktionen zwischen den einzelnen Teilsektoren des Staats nicht beseitigt werden. |
|
5.27 |
Grundsätzlich werden die Buchungen im ESVG 2010 nicht konsolidiert, da für ein konsolidiertes Finanzierungskonto die Angaben über die gegenüberstehenden Gruppierungen institutioneller Einheiten erforderlich sind. Dazu werden Angaben über finanzielle Transaktionen nach dem Muster „von wem zu wem“ benötigt. Zum Beispiel muss bei der Zusammenstellung der konsolidierten Verbindlichkeiten des Staates unter den Inhabern von Verbindlichkeiten des Staates zwischen dem Staat und anderen institutionellen Einheiten unterschieden werden. |
Saldierung
|
5.28 |
Definition: Die Saldierung ist die Konsolidierung auf der Ebene einer einzigen institutionellen Einheit, wobei die Posten für ein und dieselbe Transaktion auf den beiden Seiten des Kontos gegeneinander aufgerechnet werden. Saldieren ist zu vermeiden, es sei denn, es fehlen Ausgangsdaten. |
|
5.29 |
Die Saldierung kann in unterschiedlichem Ausmaß stattfinden, wenn Transaktionen mit Verbindlichkeiten von Transaktionen mit Forderungen für dieselbe Kategorie oder Teilkategorie von Forderungen subtrahiert werden. |
|
5.30 |
Erwirbt eine Abteilung einer institutionellen Einheit Schuldverschreibungen, die eine andere Abteilung derselben institutionellen Einheit ausgegeben hat, so wird diese Transaktion auf dem Finanzierungskonto dieser Einheit nicht als Erwerb einer Forderung durch eine Abteilung der institutionellen Einheit von einer anderen erfasst. Die Transaktion wird als Rückkauf von Verbindlichkeiten verbucht und nicht als Erwerb von konsolidierenden Forderungen. Derartige finanzielle Instrumente werden als saldiert angesehen. Das Saldieren unterbleibt, wenn es für die Einhaltung gesetzlicher Bilanzierungsvorschriften erforderlich ist, das finanzielle Instrument sowohl auf der Habenseite als auch auf der Sollseite auszuweisen. |
|
5.31 |
Unumgänglich sind Saldierungen u.U. für Transaktionen einer institutionellen Einheit mit Finanzderivaten, weil für diese Transaktionen in der Regel keine nach Forderungen und Verbindlichkeiten getrennten Daten verfügbar sind. Es ist angebracht, diese Transaktionen zu saldieren, weil sich beim Wert einer Position in Finanzderivaten das Vorzeichen ändern kann und somit aus einer Forderung eine Verbindlichkeit wird, wenn sich der Wert des dem Derivatvertrag unterlegten Instruments im Verhältnis zum Preis des Vertrages ändert. |
Regeln für die Verbuchung finanzieller Transaktionen
|
5.32 |
Die Vierfachbuchung ist ein Buchungsverfahren, bei dem jede Transaktion, an der zwei institutionelle Einheiten beteiligt sind, von jeder der beiden Einheiten zweimal verbucht wird. Tauschen beispielsweise Unternehmen Waren gegen Bargeld, so führt dies bei beiden Einheiten zu Buchungen sowohl im Produktionskonto als auch im Finanzierungskonto. Die Vierfachbuchung gewährleistet die Symmetrie der Bilanzierung durch die institutionellen Einheiten und damit die Konsistenz innerhalb des Kontensystems. |
|
5.33 |
Zu einer finanziellen Transaktion gibt es stets eine gegenüberstehende Transaktion. Bei dieser Gegenbuchung kann es sich um eine andere finanzielle Transaktion oder um eine nichtfinanzielle Transaktion handeln. |
|
5.34 |
Handelt es sich bei einer Transaktion und der ihr gegenüberstehenden Transaktion um finanzielle Transaktionen, so ändert sich die Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten und u.U. die Summe der finanziellen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten der institutionellen Einheiten. Der Finanzierungssaldo und das Reinvermögen werden davon allerdings nicht berührt. |
|
5.35 |
Die Gegenbuchung zu einer finanziellen Transaktion kann eine nichtfinanzielle Transaktion sein, zum Beispiel eine Gütertransaktion, eine Verteilungstransaktion oder eine Transaktion mit nichtproduziertem Sachvermögen. Ist die Gegenbuchung zu einer finanziellen Transaktion keine finanzielle Transaktion, ändert sich der Finanzierungssaldo der institutionellen Einheiten. |
Eine finanzielle Transaktion mit einem laufenden oder Vermögenstransfer als Gegenbuchung
|
5.36 |
Die Gegenbuchung zu einer finanziellen Transaktion kann ein Transfer sein. In diesem Fall beinhaltet die finanzielle Transaktion einen Wechsel des Eigentums an der Forderung oder das Eingehen einer Verbindlichkeit als Schuldner, die sogenannte Schuldübernahme, oder die gleichzeitige Auflösung einer Forderung und der ihr gegenüberstehenden Verbindlichkeit (Schuldenaufhebung oder Schuldenerlass). Die Schuldübernahme und die Schuldenaufhebung sind Vermögenstransfers (D.9) und werden im Vermögensbildungskonto gebucht. |
|
5.37 |
Wenn der Eigentümer einer Quasi-Kapitalgesellschaft dieser Gesellschaft Schulden erlässt oder von ihr Schulden übernimmt, so handelt es sich bei der Gegentransaktion zur Schuldübernahme oder -aufhebung um eine Transaktion mit Anteilsrechten (F.51). Eine Ausnahme stellt jedoch eine Operation dar, mit der aufgelaufene oder außergewöhnlich hohe Verluste gedeckt werden sollen oder die im Zusammenhang mir anhaltenden Verlusten erfolgt — solche Operationen werden als nichtfinanzielle Transaktionen klassifiziert, nämlich als Vermögens- oder als laufender Transfer. |
|
5.38 |
Wenn der Staat einer öffentlichen Kapitalgesellschaft, die als solche aufgelöst wird, Schulden erlässt oder von ihr Schulden übernimmt, so wird weder im Vermögensbildungskonto noch im Finanzierungskonto eine Transaktion gebucht. In diesem Fall erfolgt die Gegenbuchung im Konto der sonstigen realen Vermögensänderungen. |
|
5.39 |
Wenn der Staat einer öffentlichen Kapitalgesellschaft im Zuge einer kurzfristig durchzuführenden Privatisierung Schulden erlässt oder von ihr übernimmt, so ist die Gegentransaktion bis zur Gesamthöhe der Privatisierungserlöse eine Transaktion mit Anteilsrechten (F.51). In anderen Worten wird davon ausgegangen, dass der Staat, indem er die Schulden der öffentlichen Kapitalgesellschaft erlässt oder übernimmt, seine Anteilsrechte an der Gesellschaft vorübergehend erhöht. Privatisierung liegt vor, wenn der Staat durch die Veräußerung von Anteilsrechten die Kontrolle über die öffentliche Kapitalgesellschaft aufgibt. Eine solche Schuldenaufhebung oder Schuldenübernahme hat eine Erhöhung der Eigenmittel der öffentlichen Kapitalgesellschaft auch dann zur Folge, wenn keine Anteilsrechte ausgegeben werden. |
|
5.40 |
Die vollständige oder teilweise Abschreibung zweifelhafter Forderungen durch den Gläubiger oder die einseitige Aufhebung von Schulden durch den Schuldner, die so genannte Nichtanerkennung einer Schuld, sind keine Transaktionen, da sie keine Interaktion im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den beteiligten Partnern beinhalten. Die Abschreibung uneinbringlicher Forderungen durch den Gläubiger geht in das Konto sonstiger realer Vermögensänderungen ein. |
Finanztransaktionen, denen Vermögenseinkommen gegenübersteht
|
5.41 |
Die Gegenbuchung zu einer finanziellen Transaktion kann Vermögenseinkommen sein. |
|
5.42 |
Zinsen (D.41) sind zahlbar von Schuldnern und werden durch Gläubiger empfangen. Sie sind auf bestimmte Arten von Forderungen, nämlich auf Währungsgold und Sonderziehungsrechte (AF.1), Einlagen (AF.2), Schuldverschreibungen (AF.3), Kredite (AF.4) oder auf sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (AF.8) zu zahlen. |
|
5.43 |
Die Buchung der Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag erfolgt kontinuierlich entsprechend ihrem Auflaufen beim Gläubiger. Die gegenüberstehende Transaktion zu einer Buchung von Zinsen (D.41) ist stets eine finanzielle Transaktion, bei der ein finanzieller Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner entsteht. Die aufgelaufenen Zinsen werden daher im Finanzierungskonto bei dem zugehörigen Finanzinstrument verbucht. Diese finanzielle Transaktion hat die Reinvestition der Zinsen zur Folge. Die Zinszahlung selbst wird nicht als Zinsen (D.41) gebucht, sondern als Transaktion mit Bargeld und Einlagen (F.2), der eine gleich hohe Rückzahlung entsprechender Aktiva gegenübersteht, durch die die Nettoforderung des Gläubigers gegen den Schuldner verringert wird. |
|
5.44 |
Werden aufgelaufene Zinsen nicht bei Fälligkeit gezahlt, entstehen Zinsrückstände. Da die aufgelaufenen Zinsen gebucht werden, ändert sich durch Zinsrückstände der Gesamtbetrag der Forderungen und Verbindlichkeiten nicht. |
|
5.45 |
Das Einkommen von Kapitalgesellschaften umfasst Dividenden (D.421), Gewinnentnahmen aus Quasi-Kapitalgesellschaften (D.422), reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen (D.43) und einbehaltene Gewinne inländischer Unternehmen. Die gegenüberstehende finanzielle Transaktion führt im Fall reinvestierter Gewinne dazu, dass das Vermögenseinkommen in das Unternehmen reinvestiert wird, das Gegenstand einer ausländischen Direktinvestition ist. |
|
5.46 |
Dividenden werden als Kapitalerträge verbucht, sobald die Aktien ex Dividende notiert werden. Dasselbe gilt für Gewinnentnahmen aus Quasi-Kapitalgesellschaften. Auf andere Weise verbucht werden außerordentlich hohe Dividenden oder Entnahmen, die in keinem Verhältnis zu dem aufgrund der jüngeren Vergangenheit zu erwartenden Betrag stehen, der zur Ausschüttung an die Eigentümer der Kapitalgesellschaft zu Verfügung steht. Eine solche übermäßige Ausschüttung ist als Entnahme von Eigenkapital im Finanzierungskonto zu buchen und nicht als Kapitalerträge. |
|
5.47 |
Von Investmentfonds empfangenes Vermögenseinkommen abzüglich der anteiligen Verwaltungskosten wird, soweit es den Anteilsinhabern zugerechnet, aber nicht ausgeschüttet wird, als Vermögenseinkommen gebucht; die Gegenbuchung erfolgt im Finanzierungskonto unter Investmentzertifikate. Folglich wird das den Aktionären zugerechnete, aber nicht ausgeschüttete Einkommen als Reinvestition in den Fonds behandelt. |
|
5.48 |
Kapitalerträge werden den Inhabern von Versicherungspolicen (D.44), Alterssicherungsansprüchen und von Investmentzertifikaten zugerechnet. Unabhängig von dem Betrag, den die Versicherungsgesellschaft, die Altersvorsorgeeinrichtung oder der Investmentfonds tatsächlich ausgeschüttet hat, wird der gesamte Betrag der von der Versicherungsgesellschaft oder dem Fonds erhaltenen Kapitalerträge als Ausschüttungen an die Versicherungsnehmer oder Inhaber von Investmentzertifikaten ausgewiesen. Der nicht ausgeschüttete Betrag wird als Reinvestition im Finanzierungskonto gebucht. |
Buchungszeitpunkt
|
5.49 |
Finanzielle Transaktionen und die ihnen gegenüberstehenden Transaktionen werden zum selben Zeitpunkt gebucht. |
|
5.50 |
Steht einer finanziellen Transaktion eine nichtfinanzielle Transaktion gegenüber, werden beide Transaktionen zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die nichtfinanzielle Transaktion stattfindet. Wird z.B. beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen ein Handelskredit gewährt, ist diese finanzielle Transaktion zu dem Zeitpunkt auszuweisen, zu dem sie in den entsprechenden Konten für nichtfinanzielle Transaktionen nachgewiesen wird, nämlich zu dem Zeitpunkt, zu dem der Übergang des Eigentums an den Waren stattfindet oder die Dienstleistung erbracht wird. |
|
5.51 |
Steht einer finanziellen Transaktion eine andere finanzielle Transaktion gegenüber, so gibt es drei Möglichkeiten:
|
Ein Finanzierungskonto „von wem zu wem“
|
5.52 |
Das Finanzierungskonto „von wem zu wem“ oder Finanzierungskonto nach Schuldnern/Gläubigern ist eine Erweiterung des unkonsolidierten Finanzierungskontos. Sie ist eine dreidimensionale Darstellung von finanziellen Transaktionen, die beide Transaktionspartner sowie die Art des gehandelten finanziellen Instruments ausweisen. Diese Darstellung liefert Angaben über die Beziehungen zwischen Schuldnern und Gläubigern und steht im Einklang mit einer Bilanz „von wem zu wem“. Sie liefert keine Angaben über die institutionellen Einheiten, an die die Vermögenswerte verkauft oder von denen sie erworben wurden. Dasselbe gilt für die gegenüberstehenden Transaktionen mit Verbindlichkeiten. Das Finanzierungskonto nach dem Muster "von wem zu wem" ist auch als Matrix der Zahlungs- bzw. Buchungsströme bekannt. |
|
5.53 |
Aufbauend auf dem Grundsatz der Vierfachbuchung hat ein Finanzierungskonto "von wem zu wem" drei Dimensionen: die Kategorie des Finanzinstruments, den Sektor des Schuldners und den Sektor des Gläubigers. Ein Finanzierungskonto "von wem zu wem" erfordert dreidimensionale Tabellen, die die Untergliederungen nach dem Finanzinstrument, nach dem Schuldner und nach dem Gläubiger wiedergeben. In solchen Tabellen, wie in Tabelle 5.1, werden die finanziellen Transaktionen in einer Kreuzklassifikation nach Sektor des Schuldners und nach Sektor des Gläubigers dargestellt. |
|
5.54 |
Aus der Tabelle für die Finanzinstrumentkategorie Schuldverschreibungen ist ersichtlich, dass aufgrund der Transaktionen im Bezugszeitraum die von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck erworbenen Schuldverschreibungen abzüglich der Abgänge (275), Forderungen gegen nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (65), finanzielle Kapitalgesellschaften (43), den Staat (124) und die übrige Welt (43) darstellen. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass aufgrund der Transaktionen im Bezugszeitraum nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften Verbindlichkeiten abzüglich der Rücknahmen in Form von Schuldverschreibungen in Höhe von 147 eingegangen sind. Ihre Verbindlichkeiten in dieser Form gegenüber anderen nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften erhöhten sich um 30, gegenüber finanziellen Kapitalgesellschaften um 23, gegenüber dem Staat um 5, gegenüber privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck um 65 und gegenüber der übrigen Welt um 24. Die privaten Haushalte und die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck begaben keine Schuldverschreibungen. Wegen der konsolidierten Darstellung der übrigen Welt werden die Transaktionen zwischen gebietsfremden institutionellen Einheiten nicht ausgewiesen. Ähnliche Tabellen lassen sich für alle Finanzinstrumentkategorien erstellen. Tabelle 5.1 — Ein Finanzierungskonto "von wem zu wem" für Schuldverschreibungen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.55 |
Mit dem Finanzierungskonto "von wem zu wem" lässt sich untersuchen, wer wen mit welchem Betrag und mit welchem finanziellen Vermögenswert finanziert. Es liefert u.a. die Antworten auf Fragen folgender Art:
|
GLIEDERUNGEN DER FINANZIELLEN TRANSAKTIONEN NACH EINZELNEN KATEGORIEN
Im Folgenden werden finanzielle Instrumente definiert und beschrieben. Bei der Buchung einer Transaktion wird der Code F verwendet. Die zugrunde liegenden Bestände oder Niveaus von Aktiva oder Passiva werden bei der Buchung mit AF codiert.
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)
|
5.56 |
Die Kategorie Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) (F.1) besteht aus zwei Unterpositionen:
|
Währungsgold (F.11)
|
5.57 |
Definition: Währungsgold ist Gold, auf das die Währungsbehörden Anspruch haben und das sie als Währungsreserven halten. Dazu gehört Barrengold und bei Gebietsfremden gehaltene Goldsammelverwahrungskonten, die einen Anspruch auf Herausgabe von Gold begründen. |
|
5.58 |
Zu den Währungsbehörden gehören die Zentralbank und zentralstaatliche Einrichtungen, die Geschäfte betreiben, die gewöhnlich der Zentralbank vorbehalten sind. Hierzu gehören die Ausgabe von Zahlungsmitteln, das Halten und die Verwaltung von Währungsreserven sowie die Verwaltung von Währungsausgleichsfonds. |
|
5.59 |
Die tatsächliche Unterstellung unter die Währungsbehörden bedeutet, dass:
|
|
5.60 |
Sämtliches Währungsgold ist Teil der Währungsreserven oder wird von internationalen Finanzorganisationen gehalten. Seine Bestandteile sind folgende:
|
|
5.61 |
Das zum Währungsgold gehörende Barrengold ist der einzige finanzielle Vermögenswert, dem keine Verbindlichkeit gegenübersteht. Es kommt in Form von Münzen, Barren oder Stangen mit einem Reinheitsgrad von wenigstens 995 Promille vor. Nicht als Währungsreserve gehaltenes Barrengold ist ein Sachvermögensgut und gehört zum Warengold. |
|
5.62 |
Goldeinzelverwahrungskonten verschaffen das Eigentum an einem bestimmten Stück Gold. Das Gold bleibt dabei im Eigentum der Einheit, die es in sichere Verwahrung gibt. Diese Konten bieten in der Regel die Möglichkeit, Gold zu kaufen, aufzubewahren und zu verkaufen. Wird Gold in Einzelverwahrung als Währungsreserve gehalten, so wird es als Währungsgold und damit als Forderung klassifiziert. Wird es nicht als Währungsreserve gehalten, so stehen Goldeinzelverwahrungskonten für das Eigentum an einem Vermögensgut, nämlich Warengold. |
|
5.63 |
Im Gegensatz zu Goldeinzelverwahrungskonten begründen Goldsammelverwahrungskonten einen Anspruch gegen den Verwalter des Kontos auf Herausgabe von Gold. Wird Gold in Sammelverwahrung als Währungsreserve gehalten, so wird es als Währungsgold und damit als Forderung klassifiziert. Goldsammelverwahrungskonten, die nicht als Währungsreserven gehalten werden, gelten als Einlagen. |
|
5.64 |
Transaktionen mit Währungsgold bestehen vorwiegend aus Käufen und Verkäufen von Währungsgold zwischen Währungsbehörden oder bestimmten internationalen Finanzorganisationen. Transaktionen mit Währungsgold sind nur zwischen den genannten institutionellen Einheiten möglich, nicht jedoch unter Beteiligung anderer. Käufe von Währungsgold werden auf den Finanzierungskonten der Währungsbehörden als Zunahme der Forderungen, Verkäufe als Abnahme der Forderungen gebucht. Die Gegenbuchungen werden bei der übrigen Welt als Abnahme der Forderungen bzw. als Zunahme der Forderungen erfasst. |
|
5.65 |
Wenn Währungsbehörden Warengold in die Währungsreserven aufnehmen (indem sie z.B. Gold auf dem Markt kaufen) oder Währungsgold für andere Zwecke verwenden (indem sie z.B. Gold auf dem Markt verkaufen), so wird dies als Monetisierung bzw. Demonetisierung von Gold bezeichnet. Die Monetisierung oder Demonetisierung hat keine Buchungen auf dem Finanzierungskonto zur Folge, sondern Buchungen auf dem Konto sonstiger Vermögensänderungen, und zwar als Änderung der Klassifikation von Aktiva und Passiva, nämlich als Umklassifizierung von Gold als Wertsache (AN.13) zu Währungsgold (AF.11) (siehe Abschnitte 6.22-6.24). Bei der Demonetisierung wird Währungsgold zu einer Wertsache umklassifiziert. |
|
5.66 |
Auf Gold lautende Einlagen, Wertpapiere und Kredite zählen nicht zum Währungsgold, sondern zu den entsprechenden Forderungsarten in Fremdwährung. "Gold swaps" (Tausch von Gold gegen Einlagen) sind eine Art von Rückkaufvereinbarung, die entweder Währungsgold oder Warengold zum Gegenstand haben. Sie beinhalten den Austausch von Gold gegen eine Einlage mit der Verabredung, die Transaktion zu einem vereinbarten künftigen Datum und zu einem vereinbarten Goldpreis rückgängig zu machen. In der Regel werden Umkehrtransaktionen so verbucht, dass der Goldnehmer das Gold nicht in seiner Bilanz erfasst, während der Goldgeber das Gold nicht aus seiner Bilanz entfernt. Goldtauschgeschäfte werden von beiden Seiten als besicherte Darlehen gebucht, wobei das Gold als Sicherheit dient. Tauschgeschäfte mit Währungsgold finden zwischen Währungsbehörden oder zwischen diesen und Dritten statt, Tauschgeschäfte mit Warengold sind ähnliche Transaktionen ohne die Beteiligung von Währungsbehörden. |
|
5.67 |
Golddarlehen bestehen aus der Lieferung von Gold für einen bestimmten Zeitraum. Wie bei anderen Umkehrtransaktionen findet ein Übergang des Eigentums an dem Gold statt, aber die Risiken und Gewinne infolge einer Änderung des Goldpreises betreffen nur den Verleiher. Die Entleiher von Gold decken mit diesen Transaktionen häufig Verkäufe an Dritte in Zeiten einer Goldknappheit ab. Für die Nutzung des Goldes erhält der ursprüngliche Eigentümer eine Gebühr, deren Höhe sich nach dem unterlegten Vermögenswert und der Dauer der Umkehrtransaktion richtet. |
|
5.68 |
Währungsgold ist ein finanzielles Vermögensgut, und die Gebühren für Golddarlehen sind folglich Zahlungen dafür, dass das finanzielle Vermögensgut einer anderen institutionellen Einheit zur Verfügung gestellt wird. Die mit Darlehen von Währungsgold verbundenen Gebühren werden als Zinsen behandelt. Im Sinne einer Vereinfachung gilt diese Regel auch für die Gebühren, die für Darlehen von Warengold bezahlt werden. |
SZR (F.12)
|
5.69 |
Definition: SZR sind ein vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschaffenes internationales Reservemedium, das den Mitgliedern des IWF zur Ergänzung der bestehenden Währungsreserven zugeteilt wird. |
|
5.70 |
Die SZR-Abteilung des IWF verwaltet die Währungsreserven, indem sie die SZR den Mitgliedstaaten des IWF und bestimmten internationalen Agenturen, den sogenannten "Teilnehmern", zuteilt. |
|
5.71 |
Die Schaffung von SZR durch ihre Zuteilung und ihre Annullierung durch ihre Einziehung sind Transaktionen. Zuteilungen von SZR werden brutto als Erwerb einer Forderung auf dem Finanzierungskonto der Währungsbehörden des jeweiligen Teilnehmers sowie als Übernahme einer Verbindlichkeit durch die übrige Welt gebucht. |
|
5.72 |
SZR werden ausschließlich von offiziellen Stellen, den Zentralbanken und bestimmten internationalen Einrichtungen, gehalten und können zwischen den Teilnehmern und anderen offiziellen Stellen übertragen werden. SZR-Guthaben garantieren ihren Inhabern das uneingeschränkte Recht, andere Währungsreserven, insbesondere Devisen, von anderen IWF-Mitgliedern zu erhalten. |
|
5.73 |
Sonderziehungsrechte sind Forderungen, denen Verbindlichkeiten gegenüberstehen; allerdings richten sich die Forderungen gegen die Teilnehmer gemeinsam und nicht gegen den IWF. Ein Teilnehmer kann seine SZR-Guthaben ganz oder teilweise an andere Teilnehmer veräußern und erhält dafür andere Reservemedien, insbesondere Devisen. |
Bargeld und Einlagen (F.2)
|
5.74 |
Definition: Bargeld und Einlagen sind das im Umlauf befindliche Bargeld sowie Einlagen, in Landeswährung und in Fremdwährung. |
|
5.75 |
Es gibt drei Unterkategorien von finanziellen Transaktionen in Bezug auf Währung und Einlagen:
|
Bargeld (F.21)
|
5.76 |
Definition: Bargeld sind Banknoten und Münzen, die eine Währungsbehörde ausgibt oder genehmigt. |
|
5.77 |
Zum Bargeld zählen:
|
|
5.78 |
Zum Bargeld zählen nicht:
|
Kasten 5.2 — Vom Eurosystem ausgegebenes Bargeld
|
B5.2.1. |
Vom Eurosystem ausgegebene Banknoten und Münzen sind die Landeswährung in den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets. Im Besitz von Gebietsansässigen der teilnehmenden Mitgliedstaaten befindliches Euro-Bargeld wird zwar als Landeswährung behandelt, stellt aber nur in der Höhe eine Verbindlichkeit der gebietsansässigen nationalen Zentralbanken dar, die ihrem nominalen Anteil am Gesamtbargeldumlauf entspricht, der sich nach ihrem Anteil am Kapital der EZB richtet. Infolgedessen stellt aus nationaler Sicht ein Teil der Landeswährung, der sich im Besitz der Gebietsansässigen befindet, u.U. eine Forderung gegen Gebietsfremde dar. |
|
B5.2.2. |
Das vom Eurosystem ausgegebene Bargeld umfasst Banknoten und Münzen. Banknoten werden vom Eurosystem ausgegeben, Münzen von den Zentralstaaten der Eurozone, obwohl sie vereinbarungsgemäß als Verbindlichkeiten der nationalen Zentralbanken behandelt werden, die dafür im Gegenzug eine nominelle Forderung gegen den Zentralstaat haben. Eurobanknoten und -münzen können sich im Besitz von Gebietsansässigen der Eurozone oder von Gebietsfremden befinden. |
Einlagen ((F.22) und (F.29))
|
5.79 |
Definition: Einlagen sind vereinheitlichte, nicht begebbare Verträge mit dem Publikum, die von Kreditinstituten und in einigen Fällen vom Zentralstaat als Schuldner angeboten werden und es dem Gläubiger ermöglichen, Geldbeträge einzuzahlen und die Einlage später wieder abzuheben. Einlagen sind in der Regel mit der vollständigen Rückzahlung der Einlage durch den Schuldner an den Anleger verbunden. |
Sichteinlagen (F.22)
|
5.80 |
Definition: Sichteinlagen sind Einlagen, die auf Verlangen zum Nennwert in Bargeld umgetauscht und unmittelbar und ohne Einschränkung oder Einbuße zur Leistung von Zahlungen mit Scheck, Wechsel, Überweisung, Lastschrift oder anderen direkten Zahlungsmitteln genutzt werden können. |
|
5.81 |
Sichteinlagen sind vorwiegend Verbindlichkeiten gebietsansässiger Kreditinstitute, in einigen Fällen solche des Zentralstaats oder gebietsfremder institutioneller Einheiten. Zu den Sichteinlagen zählen die Folgenden:
|
|
5.82 |
Sichtgeldkonten können mit der Möglichkeit zur Überziehung ausgestaltet sein. Wird ein Konto überzogen, so ist der Abzug von Mitteln bis zum Betrag null eine Abhebung der Einlage, der Überziehungsbetrag hingegen ein Kredit. |
|
5.83 |
Sichteinlagen können von allen gebietsansässigen Sektoren und von der übrigen Welt gehalten werden. |
|
5.84 |
Sichteinlagen können in auf Landeswährung oder auf Fremdwährungen lautende unterteilt werden. |
Sonstige Einlagen (F.29)
|
5.85 |
Definition: Sonstige Einlagen sind alle Einlagen außer den Sichteinlagen. Sonstige Einlagen können weder als Zahlungsmittel verwendet (außer bei Fälligkeit oder Ablauf einer vereinbarten Kündigungsfrist) noch ohne erhebliche Einschränkung oder Einbuße in Bargeld oder Sichteinlagen umgewandelt werden. |
|
5.86 |
Zu den sonstigen Einlagen zählen:
|
|
5.87 |
Nicht zur Unterkategorie der sonstigen Einlagen zählen marktfähige Einlagenzertifikate und marktfähige Sparbriefe. Sie gehören zur Kategorie Schuldverschreibungen (AF.3). |
|
5.88 |
Sonstige Einlagen können in auf Landeswährung oder auf Fremdwährungen lautende unterteilt werden. |
Schuldverschreibungen (F.3)
|
5.89 |
Definition: Schuldverschreibungen sind begebbare Finanzinstrumente, die als Schuldtitel dienen. |
Wesentliche Merkmale von Schuldverschreibungen
|
5.90 |
Schuldverschreibungen weisen folgende Merkmale auf:
Das oben unter Buchstabe c in Unterabsatz 1 genannte Fälligkeitsdatum kann mit der Umwandlung einer Schuldverschreibung in eine Aktie zusammenfallen. In diesem Zusammenhang bedeutet Umwandelbarkeit, dass der Inhaber eine Schuldverschreibung gegen Eigenkapital des Emittenten eintauschen kann. Austauschbarkeit bedeutet, dass der Inhaber die Schuldverschreibung gegen Aktien einer anderen Gesellschaft als der des Emittenten eintauschen kann. Wertpapiere, die keine Angabe der Fälligkeit aufweisen, gelten als Dauerschuldverschreibungen. |
|
5.91 |
Die in Schuldverschreibungen enthaltenen Forderungen und Verbindlichkeiten können nach verschiedenen Kriterien beschrieben werden – Fälligkeit, Sektor und Teilsektor des Inhabers und des Emittenten, Währung und Art des Zinssatzes. |
Klassifizierung nach ursprünglicher Fälligkeit und Währung
|
5.92 |
Transaktionen mit Wertpapieren werden nach der ursprünglichen Fälligkeit in zwei Unterkategorien unterteilt:
|
|
5.93 |
Wertpapiere können auf Landeswährung oder auf Fremdwährungen lauten. Unter Umständen ist eine weitere Untergliederung von Wertpapieren, die auf verschiedene Fremdwährungen lauten, sinnvoll und kann sich nach der relativen Bedeutung der jeweiligen Fremdwährung für eine Volkswirtschaft richten. |
|
5.94 |
Sind bei einem Wertpapier sowohl die Hauptforderung als auch der Kupon mit einer Fremdwährung verknüpft, so wird das Papier als auf diese Fremdwährung lautend klassifiziert. |
Klassifizierung nach Art des Zinssatzes
|
5.95 |
Schuldverschreibungen können nach der Art des Zinssatzes klassifiziert werden. Es werden drei Gruppen von Wertpapieren unterschieden:
|
Festverzinsliche Schuldverschreibungen
|
5.96 |
Festverzinsliche Schuldverschreibungen umfassen:
|
|
5.97 |
Zu den festverzinslichen Schuldverschreibungen gehören auch andere Schuldverschreibungen, z.B. Optionsschuldverschreibungen auf Aktien, nachrangige Anleihen, Vorzugsaktien ohne Beteiligung am Liquidationserlös, die ein festes Einkommen abwerfen, aber nicht zur Teilnahme bei der Verteilung des Restwerts im Fall der Liquidation des Unternehmens berechtigen, sowie Verbundaktien. |
Schuldverschreibungen mit veränderlichem Zinssatz
|
5.98 |
Bei Schuldverschreibungen mit veränderlichem Zinssatz richten sich die Zins- bzw. die Tilgungszahlungen nach:
|
|
5.99 |
Schuldverschreibungen mit veränderlichem Zinssatz gelten in der Regel als langfristige Schuldverschreibungen, sofern ihre ursprüngliche Laufzeit mindestens ein Jahr beträgt. |
|
5.100 |
Zu den Schuldverschreibungen, die an die Inflation oder ein Aktivum gebunden sind, gehören auch solche, die als inflationsgebundene oder warenpreisindexierte Anleihen ausgegeben werden. Dabei sind die Kupons bzw. der Rückzahlungskurs einer warenpreisindexierten Anleihe an den Preis einer Ware gebunden. Schuldverschreibungen, deren Zinsen an die Bonitätsbewertung eines anderen Kreditnehmers gebunden sind, werden als indexgebundene Schuldverschreibungen eingestuft, da sich Bonitätsbewertungen nicht stetig in Abhängigkeit von den Marktbedingungen ändern. |
|
5.101 |
Bei Schuldverschreibungen, die an einen Zinssatz gebunden sind, ist der vertragliche Nominalzinssatz bzw. der Rückzahlungskurs in Landeswährung veränderlich. Am Tage der Emission ist es dem Emittenten nicht möglich, den Wert der Zins- und Tilgungszahlungen zu ermitteln. |
Schuldverschreibungen mit gemischtem Zinssatz
|
5.102 |
Schuldverschreibungen mit gemischtem Zinssatz sind im Verlauf ihrer Laufzeit sowohl mit einem festen als auch mit einem veränderlichen Zinssatz ausgestattet und werden als Wertpapiere mit veränderlichem Zinssatz klassifiziert. Sie umfassen Schuldverschreibungen mit:
|
Privatplatzierungen
|
5.103 |
Zu den Schuldverschreibungen zählen auch die Privatplatzierungen. Bei Privatplatzierungen verkauft der Emittent Schuldverschreibungen unmittelbar an eine kleine Zahl von Anlegern. Die Bonität der Emittenten dieser Schuldverschreibungen wird üblicherweise nicht von Ratingagenturen bewertet, und die Wertpapiere werden in der Regel nicht weiterveräußert oder neu ausgepreist, so dass der Sekundärmarkt unbedeutend bleibt. Gleichwohl sind die meisten Privatplatzierungen begebbar und werden als Schuldverschreibungen eingestuft. |
Verbriefung
|
5.104 |
Definition: Verbriefung ist die Emission von Schuldverschreibungen, deren Kupon- oder Tilgungszahlungen mit bestimmten Vermögenswerten oder mit künftigen Einkommensströmen besichert sind. Zur Verbriefung eignen sich vielfältige Aktiva und künftige Einkommensströme, u.a. anderem auch Hypothekenkredite für Wohnbauten oder gewerbliche Bauten, Verbraucherkredite, Kredite an Unternehmen, Kredite an den Staat, Versicherungspolicen, Kreditderivate und künftige Einnahmen. |
|
5.105 |
Die Verbriefung von Aktiva und künftigen Einnahmeströmen ist eine wichtige Finanzinnovation und hat zur Schaffung und ausgiebigen Nutzung von neuen Kapitalgesellschaften geführt, um die Schaffung, den Vertrieb und die Ausgabe von Wertpapieren zu erleichtern. Auftrieb erhielt die Verbriefung durch unterschiedliche Erwägungen. Bei Kapitalgesellschaften sind diese u.a.: billigere Finanzierung als bei Banken, weniger strenge gesetzliche Kapitalanforderungen, Übertragungen verschiedener Arten von Risiken, etwa des Kreditrisikos oder des Versicherungsrisikos, und eine Auffächerung der Finanzierungsquellen. |
|
5.106 |
Verbriefungsverfahren unterscheiden sich innerhalb der Wertpapiermärkte und zwischen ihnen. Sie lassen sich grob in zwei Arten unterteilen:
|
|
5.107 |
Beim Verfahren gemäß Nummer 5.106 Buchstabe a wird eine Verbriefungsgesellschaft gegründet, um die besicherten oder andere vom ursprünglichen Inhaber besicherte Forderungen zu halten und mit diesen Forderungen besicherte Schuldverschreibungen auszugeben. |
|
5.108 |
Es ist wesentlich, dass insbesondere ermittelt wird, ob die an der Verbriefung von Forderungen beteiligte finanzielle Kapitalgesellschaft ihr Portfolio aktiv durch Emission von Schuldverschreibungen verwaltet oder ob sie lediglich als Treuhänderin agiert, die die Forderungen lediglich passiv verwaltet oder Schuldverschreibungen hält. Wenn die finanzielle Kapitalgesellschaft die rechtliche Eigentümerin eines Portfolios von Forderungen ist, Wertpapiere ausgibt, die Anteile an dem Portfolio darstellen und über ein vollständiges Rechnungswesen verfügt, so handelt sie als Finanzmittlerin der Kategorie sonstige Finanzinstitute. Mit der Verbriefung von Forderungen befasste finanzielle Kapitalgesellschaften werden von Gesellschaften unterschieden, die zu dem einzigen Zweck gegründet worden sind, bestimmte Portfolios von Forderungen und Verbindlichkeiten zu halten. Letztere werden mit ihrer Muttergesellschaft zusammengefasst, wenn sie im selben Land ansässig sind wie die Muttergesellschaft. Gebietsfremde Gesellschaften werden jedoch als eigenständige institutionelle Einheiten behandelt und als firmeneigene Finanzierungseinrichtungen klassifiziert. |
|
5.109 |
Bei dem Verfahren gemäß Nummer 5.106 Buchstabe b überträgt der ursprüngliche Eigentümer der Forderungen, der Sicherungsnehmer, mithilfe von Kreditausfallversicherungen das mit einem Bestand von diversifizierten Referenzforderungen verbundene Risiko an eine Verbriefungsgesellschaft, bleibt aber selbst Eigentümer der eigentlichen Forderungen. Die Einnahmen aus der Emission von Schuldverschreibungen werden als Einlage auf ein Konto eingezahlt oder in anderer Weise sicher angelegt, z.B. in Anleihen der Klasse AAA, und die Zinsen aus der Einlage dienen zusammen mit der Prämie aus der Kreditausfallversicherung zur Finanzierung der Zinsen der emittierten Schuldverschreibungen. Wenn ein Ausfall eintritt, verringert sich der den Inhabern der Kreditausfallversicherungen geschuldete Nennwert — wobei es nachrangige Tranchen als erste "trifft" usw. Zur Deckung ausfallbedingter Verluste werden die Kupon- und Tilgungszahlungen u.U. ebenfalls von den Schuldverschreibungsanlegern an die Inhaber der ursprünglichen Sicherungsgüter umgeleitet. |
|
5.110 |
Ein forderungsbesichertes Wertpapier ist eine Schuldverschreibung, deren Kapital und/oder Zinsen ausschließlich aus dem Cash-Flow eines Bündels von finanziellen und nicht finanziellen Forderungen bestritten wird. |
Pfandbriefe
|
5.111 |
Definition: Pfandbriefe sind Schuldverschreibungen, die von einer finanziellen Kapitalgesellschaft ausgegeben wurden oder vollständig durch eine finanzielle Kapitalgesellschaft garantiert werden. Wenn ein Ausfall eintritt, haben die Halter der Pfandbriefe neben ihrem ursprünglichen Anspruch gegen die finanzielle Kapitalgesellschaft einen vorrangigen Zugriff auf die Deckungsmasse. |
Kredite (F.4)
|
5.112 |
Definition: Kredite entstehen, wenn Gläubiger an Schuldner Mittel ausleihen. |
Wesentliche Merkmale von Krediten
|
5.113 |
Kredite weisen folgende Merkmale auf:
|
|
5.114 |
Kredite können bei allen gebietsansässigen Sektoren und der übrigen Welt als Forderungen und Verbindlichkeiten vorkommen. Kreditinstitute verbuchen kurzfristige Verbindlichkeiten in der Regel als Einlagen und nicht als Kredite. |
Klassifizierung von Krediten nach ursprünglicher Fälligkeit, Währung und Zweck des Kredites
|
5.115 |
Transaktionen mit Krediten können nach der ursprünglichen Fälligkeit in zwei Kategorien unterteilt werden:
|
|
5.116 |
Zu Analysezwecken können die Kredite wie folgt tiefer aufzugliedert werden:
Für private Haushalte ist folgende Aufgliederung sinnvoll:
|
Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten und Transaktionen mit Einlagen
|
5.117 |
Die Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten (F.4) und Transaktionen mit Einlagen (F.22) besteht darin, dass der Schuldner bei einem Kredit einen genormten, nicht begebbaren Vertrag anbietet, bei Einlagen jedoch nicht. |
|
5.118 |
Kurzfristige Kredite an Kreditinstitute werden den Sichteinlagen oder den sonstigen Einlagen zugeordnet. Dagegen werden kurzfristige Einlagen bei institutionellen Einheiten, die keine Kreditinstitute sind, zu den kurzfristigen Krediten gezählt. |
|
5.119 |
Platzierungen von Mitteln zwischen Kreditinstituten werden stets als Einlagen gebucht. |
Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten und Transaktionen mit Schuldverschreibungen
|
5.120 |
Die Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten (F.4) und Transaktionen mit Schuldverschreibungen (F.3) fußt darauf, dass Kredite nicht begebbare Finanzinstrumente sind, während Schuldverschreibungen begebbare Finanzinstrumente darstellen. |
|
5.121 |
Zumeist basiert ein Kredit nur auf einem Vertrag, und Transaktionen mit Krediten finden nur zwischen einem Gläubiger und einem Schuldner statt. Emissionen von Schuldverschreibungen bestehen dagegen aus einer großen Zahl identischer Papiere, die jeweils auf einen runden Betrag lauten und zusammen den gesamten aufgenommenen Betrag ausmachen. |
|
5.122 |
Für Kredite gibt es einen sekundären Handel. Wenn Kredite auf einem organisierten Markt handelbar werden, müssen sie von Krediten zu Schuldverschreibungen umklassifiziert werden, sofern es Hinweise für einen Handel auf Sekundärmärkten gibt. Diese umfassen u.a. das Vorhandensein von Marktpflegern und die häufige Notierung der Forderung, wie sie in der Geld-Brief-Spanne zum Ausdruck kommt. In der Regel findet in einem solchen Fall eine ausdrückliche Umwandlung des ursprünglichen Kredits statt. |
|
5.123 |
Standardkredite werden meist von Kreditinstituten angeboten und häufig privaten Haushalten gewährt. Kreditinstitute legen die Kreditbedingungen fest, während die privaten Haushalte sie lediglich annehmen oder ablehnen können. Die Bedingungen von Nichtstandardkrediten werden jedoch in der Regel zwischen Gläubiger und Schuldner ausgehandelt. Dieses wichtige Kriterium erleichtert die Unterscheidung zwischen Nichtstandardkrediten und Schuldverschreibungen. Bei öffentlichen Emissionen von Wertpapieren werden deren Bedingungen vom Schuldner, eventuell in Absprache mit seiner Bank/dem Konsortialführer, festgelegt. Bei Privatplatzierungen werden die Bedingungen der Emission allerdings zwischen Schuldner und Gläubiger ausgehandelt. |
Unterscheidung zwischen Transaktionen mit Krediten, Handelskrediten und Handelswechseln
|
5.124 |
Handelskredite werden von Lieferanten von Waren bzw. den Erbringern von Dienstleistungen unmittelbar eingeräumt. Handelskredit kommt zu Stande, wenn die Zahlung für Waren und Dienstleistungen nicht zur selben Zeit erfolgt wie der Übergang des Eigentums an der Ware oder die Erbringung der Dienstleistung. |
|
5.125 |
Handelskredite sind von Krediten zur Handelsfinanzierung zu unterscheiden, die als Kredite klassifiziert werden. Vom Lieferanten von Waren oder vom Erbringer von Dienstleistungen auf einen Kunden gezogene Handelswechsel, die der Lieferant bzw. Erbringer anschließend bei einer finanziellen Kapitalgesellschaft diskontiert, werden zu Forderungen eines Dritten gegen den Kunden. |
Lombardkredite und Wertpapierpensionsgeschäfte
|
5.126 |
Definition: Lombardkredite bestehen in der vorübergehenden Übertragung von Wertpapieren durch deren Verleiher auf den Entleiher. Der Entleiher der Wertpapiere ist u.U. gehalten, dem Wertpapierverleiher Sicherheiten in Form von Bargeld oder Wertpapieren bereitzustellen. Die Eigentumsrechte kommen beiden Transaktionspartnern zu, so dass entliehene Wertpapiere und Sicherheiten verkauft oder weiterverliehen werden können. |
|
5.127 |
Definition: Ein Wertpapierpensionsgeschäft ist eine Übereinkunft, bei der Papiere, wie Schuldverschreibungen oder Aktien gegen Bargeld oder andere Zahlungsmittel mit der Verpflichtung eingetauscht werden, dieselben oder ähnliche Wertpapiere zu einem festgesetzten Preis zurückzukaufen. Die Rückkaufverpflichtung kann sich entweder auf ein festgelegtes künftiges Datum oder auf einen "offenen" Fälligkeitstermin beziehen. |
|
5.128 |
Lombardgeschäfte mit Bargeld als Sicherheit und Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) sind unterschiedliche Begriffe für Finanzgeschäfte, die dieselben wirtschaftlichen Auswirkungen haben: Sie bestehen in der Sicherung eines Kredits, da alle die Bereitstellung von Wertpapieren als Sicherheit für einen Kredit oder eine Einlage beinhalten, wobei das Kreditinstitut die Wertpapiere im Rahmen eines solchen Finanzgeschäftes verkauft. In Tabelle 5.2 sind die unterschiedlichen Merkmale der beiden Geschäfte dargestellt. Tabelle 5.2 — Die Haupteigenschaften von Lombardkrediten und Wertpapierpensionsgeschäften
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
5.129 |
Bei den bei Lombardkrediten und Wertpapierpensionsgeschäften bereitgestellten Wertpapieren wird kein Übergang des wirtschaftlichen Eigentums angenommen, weil der Verleiher nach wie vor den Ertrag aus dem Wertpapier erhält und bei allen Schwankungen des Wertpapierpreises die Risiken trägt und die Vorteile genießt. |
|
5.130 |
Weder die Lieferung und Entgegennahme von Mitteln im Rahmen eines Wertpapierpensionsgeschäfts noch eines Lombardkredits mit Barsicherheit geht mit der Ausgabe neuer Schuldverschreibungen einher. Eine derartige Bereitstellung von Mitteln an andere institutionelle Einheiten als monetäre Finanzinstitute wird als Kredit, bei Kreditinstituten als Einlage behandelt. |
|
5.131 |
Ist eine Wertpapierleihe nicht mit der Lieferung von Bargeld verbunden, findet also ein Austausch eines Wertpapiers gegen ein anderes statt, oder liefert die eine Seite ein Wertpapier ohne Sicherheit, so liegt keine Transaktion mit Krediten, Einlagen oder Wertpapieren vor. |
|
5.132 |
Einschusszahlungen von Bargeld im Rahmen eines Wertpapierpensionsgeschäfts werden als Kredite klassifiziert. |
|
5.133 |
Goldtauschgeschäfte funktionieren ähnlich wie Wertpapierpensionsgeschäfte, allerdings wird die Sicherheit in Gold geleistet. Sie beinhalten den Austausch von Gold gegen Einlagen in Fremdwährung mit der Verabredung, die Transaktion zu einem vereinbarten künftigen Datum und zu einem vereinbarten Goldpreis rückgängig zu machen. Diese Transaktion wird als besicherter Kredit oder als Einlage gebucht. |
Finanzierungsleasing
|
5.134 |
Definition: Ein Finanzierungsleasinggeschäft ist ein Vertrag, durch den der Leasinggeber als rechtlicher Eigentümer eines Vermögenswerts alle Risiken und Vorteile aus dem Eigentum an dem Vermögenswert auf den Leasingnehmer überträgt. Bei einem Finanzierungsleasingvertrag wird unterstellt, dass der Leasinggeber dem Leasingnehmer einen Kredit gewährt, mit dem dieser den Vermögenswert erwirbt. Danach wird der geleaste Vermögenswert in der Bilanz des Leasingnehmers und nicht in der des Leasinggebers ausgewiesen; der entsprechende Kredit wird als Forderung des Leasinggebers und als Verbindlichkeit des Leasingnehmers ausgewiesen. |
|
5.135 |
Das Finanzierungsleasing lässt sich von anderen Formen des Leasings dadurch unterscheiden, dass die Risiken und Vorteile vom rechtlichen Eigentümer des Gutes auf dessen Nutzer übertragen werden. Andere Arten von Leasinggeschäften sind (i) Operating-Leasing und (ii) Ressourcen-Leasing. Nutzungsrechte, wie in Kapitel 15 definiert, können ebenfalls als Leasinggeschäfte betrachtet werden. |
Andere Arten von Krediten
|
5.136 |
Die Kategorie Kredite umfasst Folgendes:
|
|
5.137 |
Der Sonderfall notleidender Kredite wird in Kapitel 7 erörtert. |
Forderungen, die nicht zur Kategorie Kredite gehören
|
5.138 |
Nicht zur Kategorie Kredite gehören:
|
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (F.5)
|
5.139 |
Definition: Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds sind Restforderungen auf die Vermögenswerte der institutionellen Einheiten, die die Finanzinstrumente ausgegeben haben. |
|
5.140 |
Bei Anteilsrechten und Anteilen an Investmentfonds werden zwei Unterkategorien unterschieden:
|
Anteilsrechte (F.51)
|
5.141 |
Definition: Anteilsrechte sind stellen eine Forderung auf den Restwert einer Kapitalgesellschaft dar, nachdem alle anderen Forderungen befriedigt worden sind. |
|
5.142 |
Das Eigentum an Anteilsrechten an juristischen Personen wird in der Regel durch Anteile, Aktien, Hinterlegungsscheine, Beteiligungen und ähnliche Dokumente dokumentiert. Die Begriffe "Anteile" und "Aktien" sind gleichbedeutend. |
Hinterlegungsscheine
|
5.143 |
Definition: Hinterlegungsscheine verbriefen das Eigentum an Wertpapieren, die im Ausland notiert werden; das Eigentum an den Hinterlegungsscheinen wird als unmittelbares Eigentum an den betreffenden Wertpapieren behandelt. Eine Wertpapierverwahrstelle gibt an einer Börse notierte Hinterlegungsscheine aus, die für das Eigentum an Wertpapieren stehen, die an einer anderen Börse notiert werden. Hinterlegungsscheine erleichtern Transaktionen mit Wertpapieren in anderen Volkswirtschaften als der der Heimatbörse. Die unterlegten Wertpapiere können Aktien oder Schuldverschreibungen sein. |
|
5.144 |
Die Anteilsrechte werden wie folgt untergliedert:
|
|
5.145 |
Sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Aktien sind handelbar und werden als Anteilspapiere beschrieben. |
Börsennotierte Aktien (F.511)
|
5.146 |
Definition: Börsennotierte Aktien sind an einer Börse notierte Anteilspapiere. Eine solche Börse kann eine anerkannte Börse oder jede andere Form eines Sekundärmarkts sein. Börsennotierte Aktien werden auch als quotierte Aktien bezeichnet. Die jeweiligen Marktpreise sind in der Regel ohne Schwierigkeiten verfügbar, weil für an einer Börse notierte Aktien ein amtlicher Kurs besteht. |
Nicht börsennotierte Aktien (F.512)
|
5.147 |
Definition: Nicht börsennotierte Aktien sind an nicht einer Börse notierte Anteilspapiere. |
|
5.148 |
Zu den Anteilspapieren gehören folgende Aktien, die von nicht börsennotierten Aktiengesellschaften ausgegeben worden sind:
|
Börsengang, Börsennotiz, Börsenabgang und Aktienrückkauf
|
5.149 |
Ein Börsengang, auch als erstes öffentliches Zeichnungsangebot, Aktienerstemission oder Börseneinführung bezeichnet, findet statt, wenn ein Unternehmen zum ersten Mal der Öffentlichkeit Anteilspapiere anbietet. Oft sind es kleinere, jüngere Unternehmen, die sich mit solchen Anteilspapiere finanzieren möchten, oder Großunternehmen, die an der Börse gehandelt werden wollen. Bei einem Börsengang kann der Emittent die Unterstützung durch eine Emissionsbank in Anspruch nehmen, die dabei hilft festzulegen, welche Art von Anteilspapieren zum bestmöglichen Emissionspreis und zum günstigsten Zeitpunkt angeboten werden sollen. |
|
5.150 |
Börsennotierung oder Börsennotiz bezeichnet den Umstand, dass die Aktien eines Unternehmens auf der Liste der Aktien stehen, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen sind. In der Regel beantragt die emittierende Gesellschaft die Zulassung, in einigen Ländern ist es aber auch die Börse selbst, die eine Gesellschaft von sich aus zulässt, zum Beispiel, weil ihre Aktien bereits im Freiverkehr gehandelt werden. Zu den Anforderungen für eine Börsenzulassung gehört die Vorlage der Bilanzen aus den letzten Jahren, ein ausreichend hoher Betrag, der dem Publikum zur Zeichnung angeboten wird — sowohl absolut als auch als Prozentsatz der im Umlauf befindlichen Aktien — sowie ein genehmigter Börsenprospekt, der gewöhnlich Stellungnahmen unabhängiger Bewerter enthält. Die Einstellung der Börsennotiz bzw. der Börsenabgang bedeutet, dass an einer Börse der Handel mit den Aktien einer Gesellschaft eingestellt wird. Sie wird vorgenommen, wenn eine Gesellschaft die Tätigkeit einstellt, Insolvenz anmeldet, die Zulassungsbedingungen der Börse nicht mehr erfüllt oder zu einer Quasi-Kapitalgesellschaft oder einem Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geworden ist, was oft die Folge von Fusionen oder Übernahmen ist. Die Börsennotierung wird als Emission börsennotierter Aktien und Rückkauf nicht börsennotierter Aktien erfasst, die Einstellung der Börsennotierung als ein Rückkauf börsennotierter Aktien und gegebenenfalls als Emission nicht börsennotierter Aktien. |
|
5.151 |
Gesellschaften können die eigenen Anteile im Zuge eines Aktienrückkaufs zurückkaufen. Ein Aktienrückkauf wird als eine Finanztransaktionen erfasst, bei der die vorhandenen Aktionäre im Austausch für einen Teil des im Umlauf befindlichen Aktienkapitals der Gesellschaft Bargeld erhalten. Es wird also Geld für eine Verminderung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien eingetauscht. Die Gesellschaft vernichtet die Aktien oder hält sie als "eigene Aktien" für eine neue Emission bereit. |
Forderungen, die keine Anteilspapiere sind
|
5.152 |
Zu den Anteilspapieren gehören nicht:
|
Sonstige Anteilsrechte (F.519)
|
5.153 |
Definition: Die sonstigen Anteilsrechte umfassen alle Formen von Anteilsrechten außer den in die Unterkategorien börsennotierte Aktien (AF.511) und nicht börsennotierte Aktien (AF.512) eingeordneten. |
|
5.154 |
Zu den sonstigen Anteilsrechten zählen:
|
Bewertung von Kapitaltransaktionen
|
5.155 |
Neu emittierte Aktien werden zum Ausgabepreis bewertet, d.h. in der Regel zum Nennwert zuzüglich des Agios. |
|
5.156 |
Transaktionen mit umlaufenden Aktien werden zum Transaktionswert erfasst. Ist der Transaktionswert nicht bekannt, so wird er näherungsweise durch den Börsenkurs oder den Marktpreis für börsennotierte Aktien bzw. für nicht börsennotierte Aktien durch den Marktäquivalenzwert ermittelt. |
|
5.157 |
Dividendenanrechtsscheine werden zu dem sich aus dem Dividendenvorschlag des Emittenten ergebenden Preis ausgewiesen. |
|
5.158 |
Die Ausgabe von Freiaktien wird nicht erfasst. Hat die Ausgabe von Freiaktien jedoch eine Änderung des Gesamtmarktwertes der Aktien einer Kapitalgesellschaft zur Folge, wird diese Änderung im Umbewertungskonto gebucht. |
|
5.159 |
Der Transaktionswert von sonstigen Anteilsrechten (F.51) ist gleich dem Betrag der von den Eigentümern an die Kapitalgesellschaften oder Quasi-Kapitalgesellschaften übertragenen Mittel. In bestimmten Fällen kann eine Mittelübertragung durch die Übernahme von Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft oder Quasi-Kapitalgesellschaft erfolgen. |
Anteile an Investmentfonds (F.52)
|
5.160 |
Definition: Anteile an einem Investmentfonds sind Aktien des Fonds, wenn er als Kapitalgesellschaft strukturiert ist. Sie heißen "units", wenn er als Trust strukturiert ist. Investmentfonds stellen Organismen für gemeinsame Anlagen dar. In diesen stellen Investoren Mittel für Investitionen in finanzielle bzw. nichtfinanzielle Vermögensgüter ein. |
|
5.161 |
Andere Bezeichnungen für Investmentfonds sind Anlagefonds, Kapitalanlagegesellschaften und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW); sie können offen, halb offen oder geschlossen sein. |
|
5.162 |
Die Aktien von Investmentfonds können an der Börse notiert sein oder nicht. Im letztgenannten Fall sind sie in der Regel jederzeit rückzahlbar, und zwar zu einem Wert, der ihrem Anteil an den Eigenmitteln der finanziellen Kapitalgesellschaft entspricht. Diese Eigenmittel werden anhand der Marktpreise ihrer verschiedenen Geldanlagen regelmäßig neu bewertet. |
|
5.163 |
Bei den Aktien von Investmentfonds werden unterschieden:
|
Anteile an Geldmarktfonds (F.521)
|
5.164 |
Definition: Geldmarktsfonds geben Aktien oder Anteile aus. Geldmarktfondsanteile können übertragbar sein und werden häufig als Substitute für Einlagen betrachtet. |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)
|
5.165 |
Definition: Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds stellen einen Anspruch auf einen Teil des Werts eines Investmentfonds, der kein Geldmarktfonds ist, dar. Diese Arten von Anteilen werden von Investmentfonds ausgegeben. |
|
5.166 |
Sonstige nicht börsennotierte Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds sind in der Regel jederzeit rückzahlbar, und zwar zu einem Wert, der ihrem Anteil an den Eigenmitteln der finanziellen Kapitalgesellschaft entspricht. Solche Eigenmittel werden anhand der Marktpreise ihrer verschiedenen Geldanlagen regelmäßig neu bewertet. |
Bewertung von Transaktionen mit Anteilen an Investmentfonds
|
5.167 |
Der Wert von Transaktionen mit Investmentzertifikaten beinhaltet auch die reinvestierten (thesaurierten) Vermögenseinkommen. |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (F.6)
|
5.168 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme werden in sechs Unterkategorien gegliedert:
|
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen (F.61)
|
5.169 |
Definition: Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen sind Forderungen, die die Versicherungsnehmer von Nichtlebensversicherungen gegen die Rückstellungen von Nichtlebensversicherungsgesellschaften hinsichtlich von Beitragsüberträgen und Aufwendungen für Versicherungsfälle haben. |
|
5.170 |
Transaktionen mit den Rückstellungen von Nichtlebensversicherungen hinsichtlich von Beitragsüberträgen und Aufwendungen für Versicherungsfälle beziehen sich auf Risiken wie Unfälle, Krankheit und Brand sowie auf Rückversicherungen. |
|
5.171 |
Beitragsüberträge sind Versicherungsprämien, für die noch kein Gegenwert erbracht wurde. Versicherungsprämien werden gewöhnlich zu Beginn des Zeitraums bezahlt, den die Versicherungspolice abdeckt. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung fallen die Versicherungsprämien stetig im Verlauf des Versicherungszeitraums an, so dass die Zahlung an dessen Beginn eine Vorauszahlung darstellt. |
|
5.172 |
Ausstehende Ansprüche sind Ansprüche aufgrund eingetretener, aber noch nicht abgewickelter Versicherungsfälle, einschließlich solcher, bei denen der Betrag strittig oder das den Anspruch begründende Ereignis eingetreten, aber noch nicht gemeldet ist. Fällige, aber noch nicht abgewickelte Ansprüche entsprechen den Rückstellungen für ausstehende Versicherungsansprüche; diese sind die Beträge, die Versicherungsgesellschaften ermittelt haben, um die voraussichtlichen Zahlungen infolge von Ereignissen abzudecken, die zwar schon eingetreten sind, für die die Forderungen aber noch nicht abgewickelt worden sind. |
|
5.173 |
Versicherungsgesellschaften können andere versicherungstechnische Rückstellungen, z.B. Schwankungsrückstellungen, vorsehen. Jedoch werden diese nur dann als Verbindlichkeiten mit gegenüberstehenden Forderungen anerkannt, wenn ein Ereignis vorliegt, dass eine Verbindlichkeit begründet. Ansonsten sind Schwankungsrückstellungen interne Buchungen des Versicherers zur Berücksichtigung von Ersparnissen zur Abdeckung unregelmäßig eintretender Ereignisse, die jedoch keine bestehenden Ansprüche von Versicherungsnehmern darstellen. |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen (F.62)
|
5.174 |
Definition: Ansprüche auf Leistungen und Rentenzahlungen von Lebensversicherungen sind Forderungen der Versicherungsnehmer und der Bezieher von Renten gegen Lebensversicherungsgesellschaften. |
|
5.175 |
Aus den Lebensversicherungs- und Rentenansprüchen werden entweder den Versicherungsnehmern bei Fälligkeit der Police oder anderen Empfängern beim Tod des Versicherungsnehmers Leistungen gewährt; sie werden folglich von den Mitteln der Anteilseigner getrennt gehalten. Die Rückstellungen für Rentenzahlungen basieren auf der versicherungsmathematischen Berechnung des Barwerts der Verpflichtung, den Berechtigten künftig bis zu ihrem Tod ein Einkommen auszuzahlen. |
|
5.176 |
Transaktionen mit den Ansprüchen auf Leistungen und Rentenzahlungen von Lebensversicherungen bestehen aus Zugängen abzüglich Abgängen. |
|
5.177 |
Im Sinne finanzieller Transaktionen bestehen die Zugänge aus:
|
|
5.178 |
Die Abgänge umfassen:
|
|
5.179 |
Im Fall von Gruppenversicherungsverträgen, die z. B. von Kapitalgesellschaften für ihre Arbeitnehmer geschlossen werden, sind die Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber die Berechtigten, da sie als die eigentlichen Versicherungsnehmer angesehen werden. |
Ansprüche aus Altersvorsorgeeinrichtungen (F.63)
|
5.180 |
Definition: Die Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen umfassen die Forderungen gegenwärtiger und ehemaliger Arbeitnehmer gegenüber
|
|
5.181 |
Transaktionen mit den Ansprüchen der privaten Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen bestehen aus Zugängen abzüglich Abgängen, jedoch ohne die Umbewertungsgewinne bzw. -verluste aus den von den Altersvorsorgeeinrichtungen angelegten Rückstellungen. |
|
5.182 |
Die Zugänge Im Sinne finanzieller Transaktionen bestehen aus:
|
|
5.183 |
Die Abgänge umfassen:
|
Bedingte Alterssicherungsansprüche
|
5.184 |
Die Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen umfassen keine bedingten Alterssicherungsansprüche, die von institutionellen Einheiten begründet werden, die als Alterssicherungssysteme mit Leistungszusagen für Arbeitnehmer des Staates ohne spezielle Deckungsmittel oder als Altersvorsorgeeinrichtungen in der Sozialversicherung klassifiziert werden. Ihre Transaktionen werden nicht vollständig aufgezeichnet und ihre Ströme und Bestände werden nicht in den Hauptkonten abgebildet, sondern in der Ergänzungstabelle über bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufene Ansprüche an Altersvorsorgeeinrichtungen in der Sozialversicherung. Bedingte Alterssicherungsansprüche sind Eventualforderungen und damit weder Verbindlichkeiten des Zentralstaates, der Länder, der Gemeinden oder von Teilsektoren der Sozialversicherung noch Forderungen der voraussichtlichen Berechtigten. |
Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen (F.64)
|
5.185 |
Ein Arbeitgeber kann mit einem Dritten einen Vertrag schließen, in dessen Rahmen die Altersvorsorgeeinrichtungen für seine Arbeitnehmer betreut werden. Wenn der Arbeitgeber weiterhin die Bedingungen der Alterssicherungssysteme bestimmt, für eventuelle Finanzierungsdefizite haftet und berechtigt ist, eventuelle Finanzierungsüberschüsse zu vereinnahmen, wird er selbst als Träger von Alterssicherungssystemen, der Dritte wird hingegen als Verwalter der Altersvorsorgeeinrichtungen bezeichnet. Sieht die Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten hingegen vor, dass der Arbeitgeber die Risiken und die Haftung für eventuelle Finanzierungsdefizite als Ausgleich zu dem Recht, eventuelle Überschüsse zu behalten, an den Dritten überträgt, fungiert der Dritte sowohl als Träger als auch als Verwalter von Alterssicherungssystemen. |
|
5.186 |
Handelt es sich bei dem Träger und dem Verwalter eines Alterssicherungssystems um unterschiedliche Einheiten und sind die Erträge des Alterssicherungssystems niedriger als die Zunahme der Ansprüche, so wird ein Anspruch des Alterssicherungssystems gegen dessen Träger verbucht. Wenn die Erträge des Alterssicherungssystems höher sind als die Zunahme der Ansprüche, so hat die Altersvorsorgeeinrichtung seinem Träger einen entsprechenden Betrag auszuzahlen. |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen (F.65)
|
5.187 |
Der Überschuss der Nettobeiträge über die Leistungen stellt eine Erhöhung der Verbindlichkeit des Versicherungssystems gegenüber den Leistungsempfängern dar. Diese Größe wird als Korrekturposten im Einkommensverwendungskonto verbucht. Als Erhöhung der Verbindlichkeiten wird die Größe auch im Finanzierungskonto verbucht. Dieser Korrekturposten kommt nur selten vor; daher können Änderungen solcher nicht die Altersicherung betreffender Ansprüche der Einfachheit halber zusammen mit den Ansprüchen auf Alterssicherungsleistungen verbucht werden. |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien (F.66)
|
5.188 |
Definition: Rückstellungen für Forderungen im Rahmen von Standardgarantien sind Forderungen der Garantienehmer im Rahmen standardisierter Garantien gegenüber den diese Garantien stellenden institutionellen Einheiten. |
|
5.189 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien sind Vorauszahlungen der Nettogebühren und Rückstellungen zur Deckung ausstehender Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien. Wie bei Prämienüberträgen und Rückstellungen für eingetretene Versicherungsfälle umfassen Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien Beitragsüberträge (Prämien für den nächsten Rechnungszeitraum) und ausstehende Forderungen. |
|
5.190 |
Standardisierte Garantien werden in großer Zahl und gewöhnlich für kleinere Beträge nach gleichen Regeln vergeben. An solchen Vereinbarungen sind drei Parteien beteiligt: der Entleiher, der Verleiher und der Bürge oder Garant. Sowohl der Verleiher als auch der Entleiher kann mit dem Bürgen einen Vertrag abschließen, der die Rückzahlung sicherstellt, falls der Schuldner ausfällt. Beispiele hierfür sind Ausfuhrkreditgarantien und Garantien für die Darlehen Studierender. |
|
5.191 |
Es ist zwar nicht möglich, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein bestimmter Schuldner ausfällt, üblicherweise wird jedoch geschätzt, wie viele Schuldner aus einer Gruppe gleichartiger Schuldner wahrscheinlich ausfallen werden. Wie eine Nichtlebensversicherungsgesellschaft rechnet ein gewerblich tätiger Garantiegeber damit, dass die Gebühren plus das damit verdiente Vermögenseinkommen und eventuelle Rückstellungen ausreichen, die erwarteten Ausfälle und die damit zusammenhängender Kosten zu decken und einen Gewinn zu erwirtschaften. Folglich werden solche Garantien, die sogenannten standardisierten Garantien, wie Nichtlebensversicherungen behandelt. |
|
5.192 |
Standardgarantien umfassen Garantien für unterschiedliche Finanzinstrumente, beispielsweise Einlagen, Schuldverschreibungen, Kredite und Handelskredite. Im Regelfall werden sie von finanziellen Kapitalgesellschaften, u.a. auch von Versicherungsunternehmen, aber auch vom Staat bereitgestellt. |
|
5.193 |
Bietet eine institutionelle Einheit standardisierte Garantien an, so berechnet sie Gebühren und geht Verbindlichkeiten für den Fall der Inanspruchnahme der Garantie ein. Der Wert der Verbindlichkeiten auf dem Konto des Garanten entspricht dem Gegenwartswert der im Rahmen vorhandener Garantien erwarteten Forderungen abzüglich voraussichtlicher Rückzahlungen durch den ausfallenden Kreditnehmer. Diese Verbindlichkeit wird als Rückstellung für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien bezeichnet. |
|
5.194 |
Eine Garantie kann sich über eine Laufzeit von mehreren Jahren erstrecken. Die Gebühr kann in jährlichen Raten oder im Voraus zu entrichten sein. Grundsätzlich entspricht die Gebühr den in jedem Jahr der Garantielaufzeit verdienten Prämien, wobei sich die Verbindlichkeit zum Ende der Laufzeit hin verringert (bei Ratenzahlung durch den Schuldner). Entsprechend richtet sich die Erfassung an der von Renten aus, wobei die Gebühren entsprechend der Verringerung der künftigen Verbindlichkeiten zu entrichten werden. |
|
5.195 |
Ein wesentliches Merkmal eines Standardgarantie-Systems ist die Vielzahl gleichartiger Garantien, auch wenn die Laufzeit sowie deren Beginn und Ende nicht für alle vollkommen gleich sind. |
|
5.196 |
Die Nettogebühren bestimmen sich als Erträge aus Gebühren zuzüglich Gebührenzusätze (entsprechend dem Vermögenseinkommen, das auf die die Gebühr entrichtende Einheit entfällt) abzüglich der Verwaltungskosten und sonstigen Kosten. Solche Nettogebühren können von allen Wirtschaftssektoren an den Sektor entrichtet werden, dem der Garantiegeber zugeordnet ist. Forderungen an Standardgarantie-Systeme sind vom Garantiegeber an den Gläubiger des von der Garantie gedeckten Finanzinstruments zu zahlen, unabhängig davon, ob die Garantiegebühr vom Kreditgeber oder vom Kreditnehmer bezahlt wurde. Die finanziellen Transaktionen beziehen sich auf die Differenz zwischen den für neue Garantien entrichteten Gebühren und den Forderungen aus bestehenden Garantien. |
Standardisierte Garantien und einmalige Bürgschaften
|
5.197 |
Standardgarantien werden anhand der folgenden zwei Kriterien von einmaligen Bürgschaften unterschieden:
Einmalige Garantien/Bürgschaften sind individuell gestaltet, und die Bürgen sind nicht in der Lage, das Risiko der Inanspruchnahme verlässlich zu schätzen. Die Bürgschaft stellt eine Eventualverbindlichkeit dar und wird nicht verbucht. Ausnahmen sind bestimmte vom Staat gestellte Garantien, die in Kapitel 20 beschrieben sind. |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (F.7)
|
5.198 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen sind in zwei Unterkategorien unterteilt:
|
Finanzderivate (F.71)
|
5.199 |
Definition: Finanzderivate sind Finanzinstrumente, die an ein bestimmtes Finanzinstrument, einen Indikator oder eine Ware gebunden sind, wodurch bestimmte finanzielle Risiken als solche an den Finanzmärkten gehandelt werden können. Finanzderivate erfüllen die folgenden Bedingungen:
|
|
5.200 |
Finanzderivate werden für eine Vielzahl verschiedener Zwecke verwendet, darunter für Finanzrisikomanagement, Sicherung, Arbitrage zwischen Märkten, Spekulation sowie als Arbeitnehmerentgelt. Finanzderivate versetzen die Akteure in die Lage, spezifische finanzielle Risiken (z.B. Zinsrisiko, Wechselkurs-, Aktienrisiko und Risiko von Rohstoffpreisschwankungen sowie Kreditrisiko usw.) an andere Einheiten zu übertragen, die bereit sind, diese Risiken einzugehen; im Regelfall geschieht dies ohne Handel mit einem Primär-Vermögenswert. Folglich werden Finanzderivate als sekundäre Vermögenswerte bezeichnet. |
|
5.201 |
Der Wert eines Finanzderivates wird vom Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes abgeleitet — dem Referenzpreis. Der Referenzpreis kann sich auf folgende Werte beziehen: Forderungen oder Vermögensgüter, Zinssatz, Wechselkurs, auf ein anderes Derivat bzw. auf die Differenz zwischen zwei Preisen. Der Derivatvertrag kann sich ferner auf einen Index, einen Preiskorb oder auf andere Elemente, z.B. Emissionshandel oder Wetterbedingungen beziehen. |
|
5.202 |
Finanzderivate können nach dem Instrumentwie Optionen, Terminkontrakten und Kreditderivaten oder nach dem Marktrisiko wie Währungs-, Zinsswaps usw.klassifiziert werden. |
Optionen
|
5.203 |
Definition: Optionen sind Verträge, durch die der Inhaber der Option das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung erwirbt, innerhalb einer bestimmten Frist oder zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis vom Optionsverkäufer zu kaufen oder an diesen zu verkaufen. Das Kaufrecht heißt Kaufoption, das Verkaufsrecht Verkaufsoption. |
|
5.204 |
Der Optionskäufer zahlt eine Prämie (den Optionspreis) dafür, dass sich der Optionsverkäufer verpflichtet, eine bestimmte Menge eines Basiswertes zum vereinbarten Preis zu verkaufen bzw. zu kaufen. Die Prämie ist eine Forderung des Optionsinhabers und eine Verbindlichkeit des Optionsverkäufers. Konzeptionell betrachtet beinhaltet die Prämie das Dienstleistungsentgelt, welches getrennt gebucht wird. Allerdings sollten bei fehlenden detaillierten Daten Annahmen soweit möglich vermieden werden, wenn das Dienstleistungselement identifiziert wird. |
|
5.205 |
Auch Optionsscheine sind eine Form von Optionen. Ihr Inhaber erhält durch sie das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, vom Emittenten des Optionsscheins während eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Anleihen zu bestimmten Bedingungen zu kaufen. Es gibt ferner Währungsoptionsscheine, deren Wert auf dem Betrag einer Währung basiert, der erforderlich ist, um eine andere Währung zu kaufen, sowie Währungsoptionsscheine, die an Drittwährungen gekoppelt sind ("cross-currency warrants") sowie Index-, Korb- und Waren-Optionsscheine. |
|
5.206 |
Der Optionsschein kann von der Schuldverschreibung abgetrennt und gesondert gehandelt werden. Infolgedessen sollten grundsätzlich zwei gesonderte Finanzinstrumente aufgeführt werden: der Optionsschein als Finanzderivat und die Anleihe als Schuldverschreibung. Optionsscheine, die an Derivate gekoppelt sind, werden nach ihren primären Merkmalen klassifiziert. |
Terminkontrakte
|
5.207 |
Definition: Terminkontrakte sind Finanzkontrakte, bei denen zwei Parteien übereinkommen, eine bestimmte Menge eines zugrunde liegenden Vermögensgutes an einem bestimmten Datum zu einem vereinbarten Preis (dem Ausübungspreis) auszutauschen. |
|
5.208 |
Futures sind an organisierten Märkten (Terminbörsen) gehandelte Terminkontrakte. Futures und andere Terminkontrakte werden in der Regel, allerdings nicht immer, statt durch Lieferung des Basiswertes durch einen Barausgleich oder die Übergabe eines anderen finanziellen Vermögenswertes ausgeglichen, so dass sie von dem Basiswert getrennt bewertet und gehandelt werden. Zu den üblichen Termingeschäften gehören auch Swaps und Forward Rate Agreements (FRA). |
Optionen versus Terminkontrakte
|
5.209 |
Optionen unterscheiden sich von Terminkontrakten in folgenden Punkten:
|
Swaps
|
5.210 |
Definition: Swaps sind Verträge, in denen Vertragspartner vereinbaren, Zahlungen, die sich auf einen vereinbarten fiktiven Kapitalbetrag beziehen, während eines bestimmten Zeitraums zu im Voraus festgelegten Bedingungen zu leisten. Am häufigsten kommen Zins-, Devisen- und Währungsswaps vor. |
|
5.211 |
Bei Zinsswaps werden Zinszahlungen unterschiedlicher Art ausgetauscht, die sich auf einen fiktiven Kapitalbetrag beziehen, der niemals ausgetauscht wird. Beispiele für die unterschiedlichen ausgetauschten Zinsarten sind feste Zinssätze, veränderliche Zinssätze und Zinssätze, die auf eine bestimmte Währung lauten. Der Ausgleich erfolgt häufig über Nettozahlungen in Höhe der aktuellen Differenz zwischen den beiden vertraglich festgelegten Zinssätzen, die sich auf den vereinbarten fiktiven Kapitalbetrag beziehen. |
|
5.212 |
Devisenswaps sind Devisengeschäfte zu einem im Voraus vertraglich festgelegten Wechselkurs. |
|
5.213 |
Bei Devisenswaps werden von den Zinszahlungen abgeleitete Geldströme und bei Vertragsende Kapitalbeträge zu einem vereinbarten Wechselkurs ausgetauscht. |
Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward rate agreements — FRA)
|
5.214 |
Definition: FRA sind Verträge zwischen zwei Transaktionspartnern, in denen diese, um sich gegen Zinsrisiken zu schützen, einen Zinsbetrag vereinbaren, der zu einem bestimmten Erfüllungstag auf einen fiktiven Kapitalbetrag zu zahlen ist, der selbst nie ausgetauscht wird. Zinsausgleichsvereinbarungen werden ähnlich wie Zinsswaps durch Geldleistungen ausgeglichen. Die Zahlungen ergeben sich aus der Differenz zwischen dem in der Zinsausgleichsvereinbarung vereinbarten Satz und dem am Erfüllungstag geltenden Marktzinssatz. |
Kreditderivate
|
5.215 |
Definition: Kreditderivate sind Finanzderivate, die in erster Linie dazu dienen, mit Kreditrisiken zu handeln. Kreditderivate sind so konzipiert, dass das Ausfallrisiko bei Krediten und Wertpapieren gehandelt werden kann. Kreditderivate gibt es sowohl in der Form von Terminkontrakten als auch von Optionsverträgen. Wie andere Finanzderivate werden sie häufig im Rahmen von Standardverträgen erstellt, die eine Bewertung zu Marktpreisen ermöglichen. Die Übertragung des Kreditrisikos findet — in Austausch gegen eine Prämie — zwischen dem Risikoverkäufer, dem Sicherungsnehmer, und dem Risikokäufer, dem Sicherungsgeber, statt. |
|
5.216 |
Wenn ein Kredit ausfällt, leistet der Risikokäufer dem Risikoverkäufer einen Barausgleich. Ein Kreditderivat kann auch ausgeglichen werden, indem die säumige Einheit einen Schuldtitel liefert. |
|
5.217 |
Zu den Kreditderivaten gehören Kreditausfalloptionen (so genannte "Credit Default Options"), Kreditausfallswaps ("Credit Default Swaps" oder CDS) und Gesamtertragsswaps ("Total Return Swaps"). Die Entwicklung von CDS-Prämien wird von einem einschlägigen Index für gehandelte Kreditderivate abgebildet. |
Kreditausfallswaps
|
5.218 |
Definition: Kreditausfallswaps (CDS) sind vertraglich vereinbarte Kreditversicherungen. Sie sollen den Gläubiger (Käufer eines CDS) gegen Verluste absichern,
|
|
5.219 |
Tritt kein Ausfall bei der betreffenden Einheit oder dem betreffenden Schuldinstrument ein, zahlt der Risikoverkäufer die Prämien weiter bis Vertragsende. Wenn es zu einem Ausfall kommt, leistet der Risikokäufer eine Ausgleichszahlung an den Risikoverkäufer, der die Prämienzahlungen einstellt. |
Finanzinstrumente, die keine Finanzderivate sind
|
5.220 |
Zu den Finanzderivaten zählen nicht:
|
Mitarbeiteraktienoptionen (F.72)
|
5.221 |
Definition: Mitarbeiteraktienoptionen sind Vereinbarungen, die zu einem bestimmten Datum geschlossen werden und Arbeitnehmer dazu berechtigen, eine bestimmte Anzahl von Aktien des Arbeitgebers zu einem festgelegten Preis entweder zu einem festgelegten Zeitpunkt oder binnen eines bestimmten Zeitraums unmittelbar nach dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit zu erwerben. Dabei werden folgende Begriffe verwendet:
|
|
5.222 |
Transaktionen mit Mitarbeiteraktienoptionen werden im Finanzierungskonto als Gegenposition des Arbeitnehmerentgelts in Höhe des Wertes der Aktienoption ausgewiesen. Der Wert der Option wird auf den Zeitraum vom Tag der Gewährung bis zum Tag des Eigentumsübergangs umgelegt; ist dies wegen fehlender Einzelangaben nicht möglich, ist der Wert am Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit zu verbuchen. Anschließend werden die Transaktionen am Ausübungstag oder — sofern die Optionen handelbar sind und tatsächlich gehandelt werden — zwischen dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit und dem Ende des Ausübungszeitraums verbucht. |
Bewertung der Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen
|
5.223 |
Beim Sekundärhandel mit Optionen und beim vorzeitigen Glattstellen von Optionen finden finanzielle Transaktionen statt. Wird eine Option fällig, kann sie ausgeübt werden oder nicht. Wird sie ausgeübt, erfolgt u.U. eine Zahlung des Optionsverkäufers an den Optionskäufer in Höhe der Differenz zwischen dem geltenden Marktpreis des Basiswerts und dem vereinbarten Ausübungspreis, oder es findet ein Kauf oder Verkauf des Basiswerts (bei dem es sich um ein finanzielles oder um ein nichtfinanzielles Aktivum handeln kann) statt, der zum geltenden Marktpreis gebucht wird und dem eine Zahlung zwischen dem Optionskäufer und dem Optionsverkäufer in Höhe des vereinbarten Ausübungspreises gegenübersteht. Die Differenz zwischen dem geltenden Marktpreis des Basiswertes und dem vereinbarten Ausübungspreis ist in beiden Fällen gleich dem Liquidationswert der Option, d.h. dem Optionspreis bei Fälligkeit. Wird die Option nicht ausgeübt, findet keine Transaktion statt. Vielmehr erzielt der Optionsverkäufer einen Umbewertungsgewinn und der Optionskäufer einen Umbewertungsverlust (beide in Höhe der bei Vertragsabschluss gezahlten Prämie), die im Umbewertungskonto zu buchen sind. |
|
5.224 |
Bei derartigen Finanzderivaten sind sowohl der Handel mit den Kontrakten als auch der Nettowert am Abrechnungstag als Transaktionen zu buchen. Ferner müssen u.U. Transaktionen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Derivatkontrakten gebucht werden. In vielen Fällen schließen die beiden Parteien jedoch den Kontrakt ab, ohne dass eine Zahlung zwischen ihnen erfolgt. In solchen Fällen ist der Wert der Transaktion, durch die der Kontrakt abgeschlossen wird, gleich null, so dass keine Buchung im Finanzierungskonto erfolgt. |
|
5.225 |
Sämtliche Zahlungen, die an Dritte oder von Dritten ausdrücklich für die Vermittlung von Optionen, Termingeschäften, Swaps oder anderen Verträgen über Derivate geleistet werden, sind in den entsprechenden Konten als Kauf von Dienstleistungen zu behandeln. Man geht davon aus, dass die Transaktionspartner eines Swaps einander keine Dienstleistung erbringen. Allerdings sind Zahlungen an Dritte für die Vermittlung des Swaps als Dienstleistungsentgelt zu behandeln. Wenn im Rahmen von Swapvereinbarungen der Swapgegenstand selbst getauscht wird, wird diese Transaktion nachgewiesen; sonstige Zahlungsströme sind als Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (F.7) auszuweisen. Theoretisch kann man zwar davon ausgehen, dass der an den Verkäufer einer Option gezahlte Optionspreis (die "Prämie") ein Dienstleistungsentgelt einschließt, in der Praxis ist es meist jedoch nicht möglich, dieses Dienstleistungselement getrennt zu erfassen. Daher ist der gesamte Optionspreis als Erwerb einer Forderung seitens des Käufers und als eingegangene Verbindlichkeit des Verkäufers zu buchen. |
|
5.226 |
Sieht eine Swapvereinbarung keinen Austausch des Swapgegenstandes vor, wird beim Inkrafttreten des Vertrages keine Transaktion nachgewiesen. In beiden Fällen entsteht damit in diesem Zeitpunkt implizit ein Finanzderivat mit einem Anfangswert von Null. Anschließend entspricht der Wert eines Swaps:
|
|
5.227 |
Wertänderungen von Finanzderivaten im Zeitablauf werden im Umbewertungskonto ausgewiesen. |
|
5.228 |
Wenn der Swapgegenstand anschließend zurückgetauscht wird, gelten die Konditionen der Swapvereinbarung, so dass möglicherweise Forderungen zu einem Preis getauscht werden, der von ihrem jeweiligen Marktpreis abweicht. Die diesem gegenüberstehende Zahlung zwischen den Swapkontraktparteien ist die im Kontrakt angegebene. Die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Kontraktpreis entspricht dem Verkaufswert der Forderung bzw. Verbindlichkeit am Fälligkeitstag und wird als Transaktion bei Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (F.7) ausgewiesen. Sämtliche Transaktionen mit Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen entsprechen dem gesamten Umbewertungsgewinn bzw. -verlust während der Laufzeit der Swapvereinbarung. Das entspricht der Regelung für Optionen vor der Lieferung des Basiswerts. |
|
5.229 |
Ein Swap oder eine Zinsausgleichsvereinbarung (Forward Rate Agreement) wird bei einer institutionellen Einheit unter Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen auf der Aktivseite verbucht, wenn der Nettowert positiv ist. Ist der Nettowert des Swap negativ und damit eine Verbindlichkeit, wird er vereinbarungsgemäß ebenfalls auf der Aktivseite verbucht, so dass nicht ständig zwischen Aktiv- und Passivseite hin- und hergewechselt werden muss. Demnach erhöht sich der Nettowert durch per saldo negative Zahlungen. |
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (F.8)
|
5.230 |
Definition: Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten entstehen als Gegenpositionen zu Transaktionen, wenn zwischen diesen Transaktionen und den entsprechenden Zahlungen ein zeitlicher Abstand besteht. |
|
5.231 |
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten umfassen Transaktionen mit Forderungen, die durch vorzeitige oder verspätete Zahlungen für Gütertransaktionen, durch Verteilungstransaktionen oder durch finanzielle Transaktionen im Sekundärhandel entstanden sind. |
|
5.232 |
Finanzielle Transaktionen mit sonstigen Forderungen/Verbindlichkeiten umfassen:
|
Handelskredite und Anzahlungen (F.81)
|
5.233 |
Definition: Handelskredite und Anzahlungen sind Forderungen, die durch die direkte Kreditgewährung durch Lieferanten an die Käufer von Waren oder Dienstleistungen entstehen sowie durch Anzahlungen für angefangene oder geplante Arbeiten bzw. für künftige Waren- und Dienstleistungslieferungen. |
|
5.234 |
Handelskredite und Anzahlungen kommen zustande, wenn die Zahlung für Waren und Dienstleistungen nicht zur selben Zeit erfolgt wie der Übergang des Eigentums an der Ware oder die Erbringung der Dienstleistung. Wird eine Zahlung vor dem Eigentumsübergang geleistet, handelt es sich um eine Anzahlung. |
|
5.235 |
Unterstellte Bankgebühren, die fällig aber noch nicht entrichtet sind, fallen unter das jeweilige Finanzinstrument, in der Regel Zinsen, und Prämienüberträge fallen unter versicherungstechnische Rückstellungen (F.61). In beiden Fällen erfolgt keine Buchung unter Handelskredite und Anzahlungen. |
|
5.236 |
Die Unterkategorie Handelskredite und Anzahlungen umfasst:
|
|
5.237 |
Handelskredite sind von Handelsfinanzierungen in Form von Handelswechseln und der Handelsfinanzierung dienenden Krediten Dritter zu unterscheiden. |
|
5.238 |
Handelskredite und Anzahlungen umfassen keine Kredite zur Finanzierung von Handelskrediten. Sie sind den Krediten zuzurechnen. |
|
5.239 |
Handelskredite und Anzahlungen können nach ihrer ursprünglichen Laufzeit in kurzfristige und langfristige Handelskredite und Anzahlungen unterteilt werden. |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten, ohne Handelskredite und Anzahlungen (F.89)
|
5.240 |
Definition: Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten sind Forderungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen oder finanziellen Transaktionen am Sekundärmarkt und den entsprechenden Zahlungen entstehen. |
|
5.241 |
Übrige Forderungen und Verbindlichkeiten sind Forderungen, die dadurch entstehen, dass Zahlungen für Verteilungstransaktionen oder finanzielle Transaktionen zwar fällig sind, aber noch nicht geleistet wurden. Das gilt beispielsweise für folgende Zahlungsverpflichtungen:
|
|
5.242 |
Aufgelaufene Zinsen und Zinsrückstände werden mit den verzinslichen Forderungen oder Verbindlichkeiten verbucht und nicht etwa als übrige Forderungen und Verbindlichkeiten. Werden die aufgelaufenen Zinsen nicht so gebucht, als ob sie in die verzinslichen Forderungen reinvestiert würden, so sind sie den übrigen Forderungen/Verbindlichkeiten zuzurechnen. |
|
5.243 |
Die Gebühren für Lombardkredite und Darlehen von Währungsgold, die als Zinsen behandelt werden, werden nicht mit dem betreffenden Instrument verbucht, sondern mit den übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten. |
|
5.244 |
Übrige Forderungen und Verbindlichkeiten umfassen nicht:
|
ANHANG 5.1
KLASSIFIKATION DER FINANZIELLEN TRANSAKTIONEN
|
5.A1.01 |
Finanzielle Transaktionen lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren: nach der Art des Finanzinstruments, der Begebbarkeit, der Art des Einkommens, der Laufzeit, der Währung und der Zinsart. |
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach Kategorie
|
5.A1.02 |
Die finanziellen Transaktionen sind, wie in Tabelle 5.3 dargestellt, in Kategorien und Unterkategorien untergliedert. Diese Klassifikation stimmt mit der der Forderungen und Verbindlichkeiten überein. Tabelle 5.3 — Klassifikation der finanziellen Transaktionen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.A1.03 |
Die Klassifikation der finanziellen Transaktionen und der Forderungen und Verbindlichkeiten basiert in erster Linie auf der Liquidität, der Begebbarkeit und den rechtlichen Merkmalen der Finanzinstrumente. Im Allgemeinen sind die Kategorien unabhängig von der Klassifikation der institutionellen Einheiten definiert. Die Forderungen und Verbindlichkeiten können durch eine Kreuztabellierung nach den institutionellen Einheiten weiter aufgegliedert werden. So können beispielsweise Sichteinlagen als Interbankpositionen von Einlagengesellschaften (ohne die Zentralbank) kreuztabelliert werden. |
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer Handelbarkeit
|
5.A1.04 |
Forderungen lassen sich danach unterscheiden, ob sie handelbar sind oder nicht. Eine Forderung gilt als handelbar, wenn das Eigentum an ihr durch Übergabe oder Indossierung problemlos von einer Einheit auf die andere übertragen oder wenn sie wie im Fall von Finanzderivaten am Markt verrechnet werden kann. Obwohl alle Instrumente potenziell gehandelt werden können, müssen handelbare Instrumente auf einen möglichen Handel an einer organisierten Börse oder im Freiverkehr ausgelegt sein, auch wenn der Nachweis eines tatsächlichen Handels nicht erforderlich ist. Notwendige Bedingungen für die Handelbarkeit sind:
|
|
5.A1.05 |
Wertpapiere, Finanzderivate, Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7) stellen handelbare Forderungen dar. Zu den Wertpapieren gehören Schuldverschreibungen (AF.3), börsennotierte Aktien (AF.511), nicht börsennotierte Aktien (AF.512) und Investmentfondsanteile (AF.52). Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen werden nicht unter die Wertpapiere eingereiht, selbst wenn sie handelbare Finanzinstrumente sind. Sie sind an bestimmte finanzielle oder nichtfinanzielle Vermögensgüter oder Indizes gebunden, so dass mit ihnen bestimmte finanzielle Risiken eigenständig an den Finanzmärkten gehandelt werden können. |
|
5.A1.06 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (AF.1) Bargeld und Einlagen (AF.2), Kredite (AF.4), sonstige Anteilsrechte (AF.519), Versicherungs-, Alterssicherungs- und standardisierte Garantiesysteme und sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten sind nicht handelbar. |
Strukturierte Wertpapiere
|
5.A1.07 |
In strukturierten Wertpapieren sind üblicherweise ein Wertpapier oder ein Korb von Wertpapieren mit einem Finanzderivat oder einen Korb von Finanzderivaten kombiniert. Finanzinstrumente, die keine strukturierten Wertpapiere darstellen, sind beispielsweise strukturierte Einlagen, die die Merkmale von Einlagen und von Finanzderivaten verbinden. Während zu Vertragsbeginn von Schuldverschreibungen typischerweise ein zurückzuzahlender Kapitalbetrag geleistet wird, gilt dies für Finanzderivate nicht. |
Klassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Einkommens
|
5.A1.08 |
Finanzielle Transaktionen sind nach der Art des von ihnen generierten Einkommens zu klassifizieren. Die Verknüpfung des Einkommens mit den entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten erleichtert die Berechnung der Renditen. Der Tabelle 5.4 ist die detaillierte Klassifizierung nach Transaktionen und Einkommensarten zu entnehmen. Während für Währungsgold und SZR, Einlagen, Schuldverschreibungen, Kredite und sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsen anfallen, generieren Anteilsrechte überwiegend Dividenden, reinvestierte Gewinne und Gewinnentnahmen aus Quasi-Kapitalgesellschaften. Kapitalerträge entstehen den Inhabern von Investitionsfondsanteilen und versicherungstechnischen Rückstellungen. Der Ertrag aus einer Beteiligung an einem Finanzderivat wird nicht als Einkommen verbucht, weil kein Kapitalbetrag angelegt wurde. Tabelle 5.4 — Klassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Einkommens
|
Klassifikation der finanziellen Transaktionen nach Art des Zinssatzes
|
5.A1.09 |
Verzinsliche Forderungen und Verbindlichkeiten lassen sich danach untergliedern, ob ein fester, ein veränderlicher oder ein gemischter Zinssatz gilt. |
|
5.A1.10 |
Bei Finanzinstrumenten mit festem Zinssatz sind die Zahlungen des vertraglichen Nominalzinssatzes in der Nennwährung über die Laufzeit des Finanzinstruments hinweg oder während einer bestimmten Anzahl von Jahren festgelegt. Der Schuldner kennt bereits zu Beginn der Laufzeit den Zeitpunkt und den Wert der Zins- und Tilgungszahlungen. |
|
5.A1.11 |
Bei Finanzinstrumenten mit veränderlichem Zinssatz sind die Zins- und Tilgungszahlungen an einen Zinssatz, einen allgemeinen Preisindex für Waren und Dienstleistungen oder den Preis eines Vermögensgegenstands gekoppelt. Der Referenzwert schwankt in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. |
|
5.A1.12 |
Finanzinstrumente mit gemischtem Zinssatz sind im Verlauf ihrer Laufzeit sowohl mit einem festen als auch mit einem veränderlichen Zinssatz ausgestattet und werden als Finanzinstrumente mit veränderlichem Zinssatz klassifiziert. |
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer Laufzeit
|
5.A1.13 |
Für eine Analyse von Zinssätzen und von Renditen von Aktiva, der Liquidität oder der Fähigkeit zur Erfüllung des Schuldendienstes, ist u.U. eine Aufgliederung nach Laufzeiten erforderlich. |
Kurze und lange Laufzeit
|
5.A1.14 |
Definition: Eine kurzfristige Forderung oder Verbindlichkeit ist jederzeit auf Verlangen des Gläubigers beziehungsweise nach einem Jahr oder früher rückzahlbar. Eine langfristige Forderung oder Verbindlichkeit ist erst nach mindestens einem Jahr rückzahlbar, oder es ist keine Laufzeit festgelegt. |
Ursprüngliche Laufzeit und Restlaufzeit
|
5.A1.15 |
Definition: Die ursprüngliche Laufzeit von Forderungen oder Verbindlichkeiten ist als der Zeitraum vom Ausgabedatum bis zur festgelegten Abschlusszahlung definiert. Die Restlaufzeit von Forderungen oder Verbindlichkeiten ist als der Zeitraum vom Bezugsdatum bis zur festgelegten Abschlusszahlung definiert. |
|
5.A1.16 |
Der Begriff der ursprünglichen Laufzeit ist für das Verständnis der Emission von Schuldtiteln nützlich. Daher werden Schuldverschreibungen und Kredite je nach ihrer ursprünglichen Laufzeit in kurzfristige und langfristige Schuldverschreibungen und Kredite unterteilt. |
|
5.A1.17 |
Die Restlaufzeit ist für eine Analyse des Verschuldung und der Fähigkeit zur Erfüllung des Schuldendienstes von größerer Bedeutung. |
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer Währung
|
5.A1.18 |
Viele Kategorien, Unterkategorien und Unterpositionen können nach der Währung untergegliedert werden, auf die sie lauten. |
|
5.A1.19 |
Zu den Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen zählen auch solche in Korbwährungen (beispielsweise SZR) oder solche, die auf Gold lauten. Besonders sinnvoll ist die Unterscheidung zwischen Landes- und Fremdwährung bei Bargeld und Einlagen (AF.2), Schuldverschreibungen (AF.3) und Krediten (AF.4). |
|
5.A1.20 |
Die Abrechnungswährung kann sich von der Nennwährung unterscheiden. Die Abrechnungswährung bezeichnet die Währung, in die der Wert der Positionen und Ströme von Finanzinstrumenten wie Wertpapieren bei der Abrechnung jeweils umgewandelt wird. |
Geldmengenaggregate
|
5.A1.21 |
Die Analyse geldpolitischer Maßnahmen erfordert u.U. den Ausweis von Geldmengenaggregaten wie M1, M2 und M3 in den Finanzierungskonten. Im ESVG 2010 werden keine Geldmengenaggregate definiert. |
KAPITEL 6
SONSTIGE STRÖME
EINFÜHRUNG
|
6.01 |
Sonstige Ströme sind Änderungen des Wertes von Aktiva und Passiva, die nicht das Ergebnis von Transaktionen sind. Diese Ströme gelten nicht als Transaktionen, weil sie nicht alle Merkmale einer Transaktion aufweisen; dies ist beispielsweise der Fall, wenn die beteiligten institutionellen Einheiten nicht in gegenseitigem Einvernehmen handeln, etwa im Falle einer entschädigungslosen Enteignung. Die Wertänderung kann auch die Folge eines natürlichen Ereignisses wie eines Erdbebens sein, welches kein wirtschaftliches Phänomen darstellt. Es ist auch möglich, dass sich der in Fremdwährungseinheiten ausgedrückte Wert eines Aktivums infolge einer Wechselkursänderung ändert. |
SONSTIGE ÄNDERUNGEN DER AKTIVA UND PASSIVA
|
6.02 |
Definition: Sonstige Änderungen der Aktiva und Passiva sind wertändernde Wirtschaftsströme, die nicht das Ergebnis von Transaktionen sind, die im Vermögensbildungskonto und im Finanzierungskonto gebucht werden. Es werden zwei Arten sonstiger Änderungen unterschieden. Die erste umfasst Volumenänderungen der Aktiva und Passiva im Sinne realer Vermögensänderungen. Die zweite betrifft nominale Umbewertungsgewinne und -verluste. |
Sonstige reale Vermögensänderungen (K.1 bis K.6)
|
6.03 |
Im Vermögensbildungskonto können produzierte und nichtproduzierte Vermögensgüter auf verschiedenen Wegen in einen Sektor eintreten oder diesen verlassen, nämlich durch Erwerb und Veräußerung von Anlagegütern, durch Abschreibungen oder durch Zugang, Abgang und laufende Verluste bei den Vorräten. Im Finanzierungskonto kommen Forderungen und Verbindlichkeiten zu dem Zeitpunkt ins System, wenn ein Schuldner gegenüber einem Gläubiger eine künftige Zahlungsverpflichtung eingeht, und sie verlassen das System mit Erfüllung dieser Verpflichtung. |
|
6.04 |
Zu den sonstigen realen Vermögensänderungen gehören Ströme, die ohne Bindung an Transaktionen dafür sorgen, dass Aktiva und Passiva ins System gelangen oder dieses verlassen — beispielsweise Zu- und Abgänge durch Erschließung, Abbau und Schädigung natürlicher Vermögensgüter. Die sonstigen realen Vermögensänderungen enthalten ferner die Auswirkung unvorhergesehener äußerer Ausnahmeereignisse, die ihrem Wesen nach keine wirtschaftlichen sind, sowie Änderungen durch die Neuzuordnung oder Umstrukturierung institutioneller Einheiten oder bestimmter Aktiva und Passiva. |
|
6.05 |
Sonstige reale Vermögensänderungen umfassen sechs Kategorien:
|
Zubuchungen von Vermögensgütern (K.1)
|
6.06 |
Zubuchungen von Vermögensgütern entsprechen der produktionsfremden Erhöhung des Volumens produzierter und nichtproduzierter Vermögensgüter. Hierzu gehören:
|
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter (K.2)
|
6.07 |
Zu Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter gehören:
|
Katastrophenschäden (K.3)
|
6.08 |
Als sonstige reale Vermögensänderungen werden die Katastrophenschäden an Wirtschaftgütern gebucht, die das Ergebnis von unregelmäßigen, abgrenzbaren Ereignissen großer Tragweite sind. |
|
6.09 |
Zu solchen Ereignissen zählen starke Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flutkatastrophen, außergewöhnlich heftige Wirbelstürme, Dürre- und sonstige Naturkatastrophen, Kriegshandlungen, Aufruhr und sonstige politische Ereignisse, technische Unfälle wie das Austreten größerer Mengen toxischer Substanzen oder das Entweichen größerer Mengen radioaktiver Partikel in die Luft. Beispiele für solche Ereignisse sind:
|
Enteignungsgewinne/-verluste (K.4)
|
6.10 |
Enteignungsgewinne/-verluste entstehen, wenn Regierungen oder sonstige institutionelle Einheiten aus Gründen, die nichts mit der Zahlung von Steuern, Geldstrafen oder ähnlichen Abgaben zu tun haben, ohne volle Entschädigung von Vermögensgütern anderer institutioneller Einheiten einschließlich gebietsfremder Einheiten Besitz ergreifen. Die Enteignung im Zusammenhang mit Straftaten wird als Geldstrafe betrachtet. Der nicht entschädigte Teil derartiger einseitiger Beschlagnahmen wird als sonstige Volumenänderung gebucht. |
|
6.11 |
Von Gläubigern betriebene Zwangsvollstreckungen und Zwangsversteigerungen von Vermögensgütern werden nicht als Enteignungsgewinne verbucht, da sich dieser Rechtsweg entweder durch ausdrückliche Festlegung oder durch allgemeine Verständigung aus dem bestehenden Vertragsverhältnis der Parteien ergibt. |
Sonstige Volumenänderungen (K.5)
|
6.12 |
Sonstige Volumenänderungen (K.5) umfassen die Auswirkungen nicht vorhersehbarer Ereignisse auf den wirtschaftlichen Wert von Vermögensgütern sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. |
|
6.13 |
Beispiele für sonstige Volumenänderungen bei Vermögensgütern sind unter anderem:
|
|
6.14 |
Beispiele für sonstige Volumenänderungen an Forderungen und Verbindlichkeiten sind unter anderem:
|
|
6.15 |
Sonstige Volumenänderungen umfassen nicht:
|
Änderungen der Zuordnung (K.6)
|
6.16 |
Änderungen der Zuordnung umfassen Änderungen der Sektorzuordnung und der institutionellen Einheiten sowie Änderungen der Vermögensart. |
Änderung der Sektorzuordnung und der institutionellen Einheiten (K.61)
|
6.17 |
Ändert eine institutionelle Einheit ihre Sektorzugehörigkeit, so muss die gesamte Vermögensbilanz umgebucht werden. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine dem Sektor der privaten Haushalte zugeordnete Einheit eine vom Inhaber abweichende Rechtspersönlichkeit erlangt und zu einer Quasi-Kapitalgesellschaft wird, die nun dem Sektor der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften zuzuordnen ist. |
|
6.18 |
Bei Änderungen der Sektorzugehörigkeit wird die gesamte Vermögensbilanz auf einen anderen Sektor oder Teilsektor umgebucht. Die Umbuchung kann eine Konsolidierung oder Entkonsolidierung der Aktiva und Passiva mit sich bringen, die ebenso in diese Kategorie aufgenommen wird. |
|
6.19 |
Die Änderung der Sektorzuordnung institutioneller Einheiten umfasst das Entstehen und Verschwinden von bestimmten Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Unternehmen. Wenn eine Kapitalgesellschaft unter Verlust ihrer eigenen Rechtspersönlichkeit von einer oder mehreren anderen Kapitalgesellschaften übernommen wird, werden alle Forderungen und Verbindlichkeiten einschließlich Aktien und sonstiger Beteiligungen zwischen dieser Kapitalgesellschaft und den sie übernehmenden Kapitalgesellschaften aus dem Gesamtrechnungssystem herausgenommen. Der Erwerb von Aktien und sonstigen Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft im Rahmen einer Fusion ist jedoch als finanzielle Transaktion zwischen der erwerbenden Kapitalgesellschaft und dem bisherigen Inhaber zu buchen. Der Umtausch vorhandener Aktien in Aktien der übernehmenden oder neuen Kapitalgesellschaft ist als Rücknahme von Aktien und gleichzeitige Ausgabe neuer Aktien zu buchen. Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der übernommenen Kapitalgesellschaft und Dritten bleiben unverändert bestehen und gehen auf die übernehmende Kapitalgesellschaft über. |
|
6.20 |
Entsprechend wird, wenn eine Kapitalgesellschaft rechtlich in zwei oder mehr institutionelle Einheiten geteilt wird, das Entstehen von Forderungen und Verbindlichkeiten als Änderung der Sektorzuordnung gebucht. |
Änderungen der Vermögensart (K.62)
|
6.21 |
Änderungen der Vermögensart ergeben sich, wenn bestimmte Aktiva und Passiva in der Eröffnungsbilanz in einer anderen Kategorie ausgewiesen werden als in der Schlussbilanz. Beispiele dafür sind Änderungen bei der Bodennutzung oder die Umwidmung von Wohnungen zu gewerblichen Räumen oder umgekehrt. Bei Grund und Boden werden beide Buchungen (negatives Vorzeichen für die alte Kategorie, positives Vorzeichen für die neue Kategorie) mit demselben Wert vorgenommen. Die Änderung des Grundstückwertes aufgrund dieser Nutzungsänderung wird als Volumenänderung und nicht als Umbewertung und somit als Zubuchung oder Abbuchung nichtproduzierter Vermögensgüter behandelt. |
|
6.22 |
Die Zubuchung oder Abbuchung von Währungsgold, das in Form von Barrengold vorliegt, kann nicht durch eine Finanztransaktion bewirkt werden, sondern wird durch sonstige reale Vermögensänderungen systemwirksam ein- und ausgebucht. |
|
6.23 |
Ein besonderer Fall von Neuzuordnung liegt bei Barrengold vor. Barrengold kann in der Form einer Forderung als Währungsgold oder in der Form einer Wertsache als Warengold erscheinen, je nachdem, wer das Barrengold aus welchem Grunde besitzt. Monetisierung ist die Neuzuordnung des Barrengolds von Warengold zu Währungsgold. Demonetisierung ist die Neuzuordnung des Barrengolds von Währungsgold zu Warengold. |
|
6.24 |
Operationen in Bezug auf Barrengold sind wie folgt zu buchen:
Die oben auf eine Währungsbehörde bezogenen Fälle gelten auch für eine internationale Finanzorganisation. |
|
6.25 |
Die Wandlung von Schuldverschreibungen in Aktien ist keine Änderung der Vermögensart, sondern wird als zwei finanzielle Transaktionen erfasst. |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.7)
|
6.26 |
Das Umbewertungskonto verzeichnet die nominalen Umbewertungsgewinne und -verluste, die im Verlauf einer Berichtsperiode für die Vermögenseigentümer entstehen, und bildet somit die Änderungen von Höhe und Struktur der Preise ab. Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.7) umfassen neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.71) und reale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.72). |
|
6.27 |
Definition: Die nominalen Umbewertungsgewinne und -verluste (K.7) eines Aktivpostens sind die Erhöhungen und Verminderungen seines Wertes, wie sie für den wirtschaftlichen Eigentümer des Aktivpostens infolge von Preiserhöhungen bzw. Preisverminderungen entstehen. Die nominalen Umbewertungsgewinne und -verluste einer Verbindlichkeit sind die Verminderungen bzw. Erhöhungen ihres Wertes infolge von Preisverminderungen bzw. Preiserhöhungen. |
|
6.28 |
Ein Umbewertungsgewinn ergibt sich durch eine Wertsteigerung eines Aktivpostens oder durch eine Wertminderung einer Verbindlichkeit. Ein Umbewertungsverlust ergibt sich durch eine Wertminderung eines Aktivpostens oder durch eine Werterhöhung einer Verbindlichkeit. |
|
6.29 |
Im Umbewertungskonto werden die nominalen Umbewertungsgewinne und -verluste so gebucht, wie sie auf Aktiva und Passiva entstehen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich realisiert werden. Ein Umbewertungsgewinn gilt dann als realisiert, wenn der betreffende Aktivposten verkauft, getilgt, verbraucht oder anderweitig veräußert oder die Verbindlichkeit zurückgezahlt worden ist. Ein nichtrealisierter Umbewertungsgewinn ist ein Umbewertungsgewinn aus einem am Ende der Berichtsperiode noch bestehendem Aktivposten bzw. einer dann noch bestehenden Verbindlichkeit. Ein realisierter Umbewertungsgewinn bezieht sich gewöhnlich auf den gesamten Zeitraum des Bestehens des Aktivums bzw. Passivums, unabhängig davon, ob dieser Zeitraum der Berichtsperiode entspricht oder nicht. Da jedoch die Umbewertungsgewinne und -verluste periodengerecht ausgewiesen werden, wird in den Klassifikationen und Konten nicht zwischen realisierten und nichtrealisierten Gewinnen unterschieden, selbst wenn das für bestimmte Zwecke nützlich wäre. |
|
6.30 |
Umbewertungsgewinne und -verluste umfassen die Zugewinne und Verluste bei allen Arten von Aktiva und Passiva, d. h. an Vermögensgütern ebenso wie an Forderungen und Verbindlichkeiten. Auch Umbewertungsgewinne an den Vorratsbeständen bei den Produzenten, einschließlich unfertiger Erzeugnisse und angefangener Arbeiten, sind eingeschlossen. |
|
6.31 |
Nominale Umbewertungsgewinne können unabhängig davon entstehen, wie lange sich die Aktiva oder Passiva in der Berichtsperiode im Vermögensbestand befinden, so dass es nicht erforderlich ist, dass sie in der Eröffnungs- und/oder in der Schlussbilanz erscheinen. Der nominale Umbewertungsgewinn bzw. -verlust, der sich für den Eigentümer zwischen zwei Zeitpunkten aus einem bestimmten Aktivum bzw. Passivum oder einer bestimmten Menge eines speziellen Typs von Aktiva bzw. Passiva ergibt, ist definiert als der „aktuelle Wert dieses Aktivums bzw. Passivums zu dem späteren Zeitpunkt abzüglich des aktuellen Werts dieses Aktivums zu dem früheren Zeitpunkt“, wobei angenommen wird, dass sich das eigentliche Aktivum bzw. Passivum in der Zwischenzeit weder qualitativ noch quantitativ verändert. |
|
6.32 |
Der nominale Gewinn (G) aus dem Halten einer gegebenen Menge q eines Aktivums zwischen den Zeitpunkten o und t kann wie folgt ausgedrückt werden:
wobei po und pt die Preise für das Aktivum zu den Zeitpunkten o bzw. t sind. Bei Forderungen und Verbindlichkeiten mit Festwert in Landeswährung sind po und pt per Definition stets eins, so dass der nominale Umbewertungsgewinn/-verlust stets null ist. |
|
6.33 |
Bei der Berechnung der Umbewertungsgewinne bzw. -verluste müssen die Zu- und Abgänge von Aktiva so bewertet werden wie im Vermögensbildungs- und Finanzierungskonto und die Bestände an Aktiva so wie in der Vermögensbilanz. Der Anschaffungswert von Anlagegütern ist der vom Käufer an den Produzenten bzw. Verkäufer gezahlte Betrag zuzüglich der dem Käufer entstehenden Kosten der Eigentumsübertragung. Der Veräußerungswert eines bestehenden Anlageguts ist der vom Käufer erhaltene Betrag abzüglich der dem Verkäufer entstehenden Kosten der Eigentumsübertragung. |
|
6.34 |
Eine vom unter 6.33 beschriebenen Regelfall abweichende Ausnahme liegt vor, wenn der gezahlte Preis nicht mit dem Marktwert des Anlagegutes übereinstimmt. In diesem Fall wird für die Differenz zwischen Kaufpreis und Marktwert ein Vermögenstransfer unterstellt und die Anschaffung zum Marktpreis gebucht. Dies kommt insbesondere bei Transaktionen mit nichtmarktbestimmten Sektoren vor. |
|
6.35 |
Es wird zwischen vier Situationen unterschieden, die zu nominalen Umbewertungsgewinnen bzw. -verlusten führen:
|
|
6.36 |
Die nominalen Umbewertungsgewinne und -verluste werden so eingetragen, wie sie auf Aktiva und Passiva entstehen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich realisiert werden. Sie werden im Umbewertungskonto der betreffenden Sektoren, der Gesamtwirtschaft und der übrigen Welt gebucht. |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.71)
|
6.37 |
Definition: Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.71) aus einem Aktivum bzw. Passivum sind der Wert der Umbewertungsgewinne bzw. -verluste, die sich ergeben, wenn sich der Preis des Aktivums bzw. Passivums im gleichen Verhältnis ändert wie das allgemeine Preisniveau. |
|
6.38 |
Neutrale Umbewertungsgewinne und -verluste werden ermittelt, um die Ableitung realer Umbewertungsgewinne und -verluste zu ermöglichen, die eine Umverteilung der realen Kaufkraft zwischen den Sektoren bewirken. |
|
6.39 |
Bezeichnet man den allgemeinen Preisindex mit r, so kann der neutrale Umbewertungsgewinn (NG) einer Menge q eines Aktivums vom Zeitpunkt o bis zum Zeitpunkt t wie folgt ausgedrückt werden:
Dabei ist: po × q der aktuelle Wert des Aktivums zum Zeitpunkt o, und rt/ro ist der Faktor der Änderung des allgemeinen Preisindex zwischen den Zeitpunkten o und t. Der gleiche Term rt/ro wird für alle Aktiva und Passiva verwendet. |
|
6.40 |
Der anzuwendende allgemeine Preisindex für die Berechnung neutraler Umbewertungsgewinne und -verluste ist ein Preisindex für Konsumausgaben. |
|
6.41 |
Neutrale Umbewertungsgewinne und -verluste werden im Konto der neutralen Umbewertungsgewinne/-verluste gebucht, einem Unterkonto des Umbewertungskontos der Sektoren, der Gesamtwirtschaft und der übrigen Welt. |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste (K.72)
|
6.42 |
Definition: Die realen Umbewertungsgewinne/-verluste (K.72) eines Aktivums bzw. Passivums sind die Differenz zwischen den nominalen und neutralen Umbewertungsgewinnen bzw. -verlusten dieses gleichen Aktivums bzw. Passivums. |
|
6.43 |
Der reale Gewinn (RG) aus dem Halten einer gegebenen Menge q eines Aktivums zwischen den Zeitpunkten o und t errechnet sich aus folgender Formel:
|
|
6.44 |
Die Werte der realen Umbewertungsgewinne bzw. -verluste von Aktiva bzw. Passiva hängen also davon ab, wie sich, gemessen am allgemeinen Preisindex, ihre Preise im Verhältnis zur Entwicklung anderer Preise über die betrachtete Periode ändern. |
|
6.45 |
Reale Umbewertungsgewinne und -verluste werden im Konto der realen Umbewertungsgewinne/-verluste gebucht, einem Unterkonto des Umbewertungskontos. |
Umbewertungsgewinne/-verluste nach Art der Forderungen und Verbindlichkeiten
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) (AF.1)
|
6.46 |
Der Preis von Währungsgold wird in der Regel in US-Dollar angegeben und somit unterliegt der Wert des Währungsgolds nominalen Umbewertungsgewinnen und -verlusten, die durch Wechselkursschwankungen und Änderungen des eigentlichen Goldpreises entstehen. |
|
6.47 |
Da die SZR als Währungskorb angelegt sind, schwankt der Wert in der jeweiligen Landeswährung wie auch der Wert der Umbewertungsgewinne/-verluste im gleichen Maße, wie sich die Wechselkurse der einzelnen Währungen im Korb gegenüber der Landeswährung ändern. |
Bargeld und Einlagen (AF.2)
|
6.48 |
Der Nennwert von Bargeld und Einlagen in Landeswährung bei Banken ist im Zeitablauf nominell fixiert. Die Preiskomponente ist stets gleich Eins, die Volumenkomponente ist gleich dem Nominalwert der Währungseinheiten. Die nominalen Umbewertungsgewinne/-verluste sind immer Null. Abgesehen von möglichen sonstigen realen Vermögensänderungen ergibt sich deshalb die Differenz zwischen der Schluss- und der Eröffnungsbilanz vollständig aus den Werten der Transaktionen mit diesen Aktiva. In diesem seltenen Fall können die Transaktionen normalerweise aus den Bilanzzahlen abgeleitet werden. |
|
6.49 |
Zinsen auf Einlagen werden im Finanzierungskonto so gebucht, als würden sie in die Einlagen reinvestiert. |
|
6.50 |
Fremdwährungsbestände und Einlagen in Fremdwährungen ergeben nominale Umbewertungsgewinne/-verluste aufgrund von Wechselkursänderungen. |
|
6.51 |
Zur Berechnung der neutralen und realen Umbewertungsgewinne bzw. -verluste von Aktiva mit nominell fixiertem Wert werden Daten über Transaktionszeitpunkte und -werte ebenso benötigt wie die Werte aus den Eröffnungs- und Schlussbilanzen. Wenn beispielsweise innerhalb der Berichtsperiode eine Einlage geleistet und wieder abgezogen wird, während das allgemeine Preisniveau steigt, ist der neutrale Gewinn aus der Einlage positiv und der reale Gewinn negativ, wobei die Höhe von der transitorischen Laufzeit und von der Inflationsrate abhängt. Ohne Angaben über den Wert der während der Rechnungsperiode durchgeführten Transaktionen und über den Zeitpunkt ihrer Durchführung können solche realen Verluste nicht berechnet werden. |
|
6.52 |
Da bei diesen nominell fixierten Forderungen und Verbindlichkeiten die absolute Summe der Zu- und Abgänge während einer Periode im Verhältnis zu den Anfangs- und Endbeständen im Allgemeinen hoch ist, können die neutralen und realen Umbewertungsgewinne bzw. -verluste aus den Bilanzdaten allein nicht befriedigend abgeleitet werden. Aber auch Bruttoinformationen über die Werte aller finanziellen Transaktionen, d. h. die gesonderte Erfassung aller Zu- und Abgänge, abgegrenzt vom Gesamtwert der Einlagen abzüglich Entnahmen, reichen zur Berechnung der Umbewertungsgewinne nicht aus, wenn die Zeitpunkte ihrer Abwicklung nicht bekannt sind. |
Schuldverschreibungen (AF.3)
|
6.53 |
Werden langfristige Schuldverschreibungen wie Anleihen (einschließlich gering verzinster und Null-Kupon-Anleihen) mit einem Agio oder Disagio ausgegeben, so wird die Differenz zwischen dem Ausgabe- und dem Rückkaufwert als Zins gebucht, den der Emittent während der Laufzeit periodengerecht an den Käufer zahlen muss. Dieser Zinsbestandteil, der vom Emittenten der langfristigen Schuldverschreibung als geleistete und vom Inhaber der Schuldverschreibung als empfangene Vermögenseinkommen zu buchen ist, kommt zum Nominalzins der Schuldverschreibung (Kuponzins) hinzu, den der Emittent während der Laufzeit der Schuldverschreibung in entsprechenden Zeitabständen tatsächlich zahlt. |
|
6.54 |
Die anfallenden Zinsen werden vom Inhaber der Schuldverschreibung im Finanzierungskonto sofort wieder in die Schuldverschreibung reinvestiert, d.h. sie werden im Finanzierungskonto als Anschaffung gebucht, die einer bestehenden Anlage zugeschrieben wird. Die graduelle Erhöhung des Marktwertes einer langfristigen Schuldverschreibung, soweit sie auf kumulierte reinvestierte Zinsen zurückzuführen ist, zeigt eine Zunahme der ausstehenden Hauptsumme, d.h. einen Zuwachs der Anlagengröße. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Mengen- bzw. Volumenerhöhung und keine Preiserhöhung. Auf diese Mengenkomponente entfällt kein Umbewertungsgewinn für den Inhaber bzw. Umbewertungsverlust für den Emittenten der Schuldverschreibung. Die allmähliche Annäherung des Anleihewertes der Schuldverschreibung an den Rückkaufwert ist eine Mengenänderung (reinvestierte Zinsen) und nicht eine Preisänderung und geht somit nicht in die Umbewertungsgewinne ein. |
|
6.55 |
Die Kurse festverzinslicher langfristiger Schuldverschreibungen ändern sich jedoch auch, wenn sich der Marktzins ändert, und zwar in entgegengesetzter Richtung. Das Ausmaß der Kursänderung ist umso geringer je näher der Rückzahlungstermin der langfristigen Schuldverschreibung herangerückt ist. Änderungen der Schuldverschreibungskurse, die auf Änderungen der Marktzinsen zurückzuführen sind, stellen keine Mengenänderungen, sondern Preisänderungen dar. Sie führen somit für den Emittenten und den Inhaber der Schuldverschreibung zu Umbewertungsgewinnen bzw. -verlusten. Steigende Marktzinsen führen zu Umbewertungsgewinnen beim Emittenten und zu Umbewertungsverlusten beim Inhaber der Schuldverschreibung und umgekehrt bei sinkenden Zinssätzen. |
|
6.56 |
Bei variabel verzinsten Schuldverschreibungen sind die Kuponzins- oder Hauptsummenzahlungen an einen allgemeinen Preisindex für Waren und Dienstleistungen, etwa den Verbraucherpreisindex, an einen Zinssatz wie EURIBOR, LIBOR oder an eine Anleiherendite oder an einen Anlagekurs gebunden. Wenn die Kuponzinsen und/oder der ausstehende Kapitalbetrag an einen allgemeinen oder breit angelegten Preisindex gebunden sind, wird die Änderung, die der ausstehende Kapitalbetrag zwischen Anfang und Ende einer bestimmten Berichtsperiode infolge der Änderung des entsprechenden Index erfährt, als anfallender Zins behandelt und kommt zu fälligen Zinszahlungen der gleichen Periode hinzu. Wenn die Indexbindung der periodengerecht zu zahlenden Beträge auch auf Umbewertungsgewinne abzielt, typischerweise bei Indexierung basierend auf einem eng definierten Einzelposten, führen Abweichungen des zugrunde gelegten Index von der ursprünglich erwarteten Entwicklung zu Umbewertungsgewinnen oder -verlusten, die sich über die Laufzeit des Instruments normalerweise nicht gegenseitig aufheben. |
|
6.57 |
Nominale Umbewertungsgewinne und -verluste sind bei kurzfristigen Schuldverschreibungen ebenso möglich wie bei langfristigen. Bei kurzfristigen Schuldverschreibungen sind jedoch aufgrund der kürzeren Laufzeiten die Umbewertungsgewinne aus Zinsänderungen viel kleiner als bei langfristigen Schuldverschreibungen mit gleichem Nennwert. |
Kredite (AF.4)
|
6.58 |
Was für Bargeld und Einlagen gilt, trifft auch für nicht gehandelte Kredite zu. Wird jedoch ein bestehender Kredit an eine andere institutionelle Einheit verkauft, so wird die Kreditwertberichtigung, d. h. die Differenz zwischen dem Rückkaufpreis und dem Transaktionspreis, zum Zeitpunkt der Transaktion im Umbewertungskonto des Verkäufers und des Käufers gebucht. |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5)
|
6.59 |
Bonus- bzw. Gratisaktien erhöhen zwar die Zahl und den Nominalwert der Aktien, verändern aber den Marktwert aller Aktien nicht. Dies gilt auch für Dividenden, die in Form von Aktien ausgeschüttet werden, also eine anteilige Ausgabe zusätzlicher Aktien an Stammaktieninhaber. Daher werden Bonus- bzw. Gratisaktien und Dividenden in Form von Aktien im Kontensystem nicht nachgewiesen. Da mit ihrer Ausgabe jedoch die Handelbarkeit an der Börse verbessert werden soll, kann sich ihr Marktwert insgesamt doch ändern. Dieser Effekt wird als nominaler Umbewertungsgewinn gebucht. |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6)
|
6.60 |
Werden Rückstellungen und Ansprüche aus Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systemen in Landeswährung angegeben, so ergeben sich dadurch ebenso wenig nominale Umbewertungsgewinne und -verluste wie bei Bargeld, Einlagen und Krediten. Die von den Kreditinstituten zur Erfüllung der Verpflichtungen eingesetzten Aktiva unterliegen Umbewertungsgewinnen und -verlusten. |
|
6.61 |
Die Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern und Begünstigten von Versicherungsverträgen ändern sich infolge von Transaktionen, sonstigen realen Vermögensänderungen und Umbewertungen. Umbewertungen ergeben sich aus Änderungen bei den wesentlichen Modellannahmen in den versicherungsmathematischen Berechnungen. Solche Grundannahmen sind Diskontsatz, Höhe der Löhne und Gehälter sowie Inflationsrate. |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7)
|
6.62 |
Der Wert von Finanzderivaten kann sich ändern, weil sich der Wert oder der Kurs des zugrundeliegenden Instruments ändert oder weil der Erfüllungstermin näher rückt. Solche Wertänderungen bei Finanzderivaten und Mitarbeiteraktienoptionen gelten als preisbedingt und sind als Umbewertungen zu buchen. |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8)
|
6.63 |
Was für einheimische Barmittel, Einlagen und Kredite gilt, trifft auch für nicht gehandelte übrige Forderungen/Verbindlichkeiten zu. Wird jedoch ein bestehender Handelskredit an eine andere institutionelle Einheit verkauft, so wird die Differenz zwischen dem Rückkaufpreis und dem Transaktionspreis zum Zeitpunkt der Transaktion als Umbewertung gebucht. Da Handelskredite in der Regel jedoch kurzfristig sind, könnte der Verkauf eines Handelskredits zur Schaffung eines neuen Finanzinstruments führen. |
Aktiva in Fremdwährung
|
6.64 |
Der Wert von auf Fremdwährung lautenden Aktiva und Passiva wird durch Konvertierung des jeweiligen Marktwertes zum aktuellen Wechselkurs bestimmt. Zu Umbewertungsgewinnen bzw. -verlusten kann es daher sowohl infolge von Preisänderungen als auch durch Wechselkursänderungen kommen. Umbewertungsgewinne bzw. -verluste innerhalb einer Periode werden ermittelt, indem der Transaktionswert und sonstige Volumenänderungen von der Bestandsänderung aus Eröffnungs- und Schlussbilanz abgezogen werden. Hierfür werden die auf Fremdwährung lautenden aktivischen und passivischen Transaktionen mit den am Transaktionstag geltenden Wechselkursen und die Bestände mit den am Anfang bzw. Ende der Periode geltenden Wechselkursen in die Landeswährung umgerechnet. Das bedeutet, dass die Gesamtheit der Transaktionen, nämlich die Zugänge abzüglich der Abgänge, in ausländischer Währung mit einem gewichteten durchschnittlichen Wechselkurs umgerechnet werden, wobei die Wichtung durch die Werte der einzelnen Transaktionen zu den entsprechenden Terminen erfolgt. |
KAPITEL 7
VERMÖGENSBILANZEN
|
7.01 |
Definition: Eine Vermögensbilanz ist eine Aufstellung der wirtschaftlichen Vermögenswerte (Aktiva) und der ausstehenden Verbindlichkeiten (Passiva) einer institutionellen Einheit oder einer Gruppe von Einheiten zu einem bestimmten Zeitpunkt. |
|
7.02 |
Der Saldo einer Vermögensbilanz ist das Reinvermögen (B.90). Die Aktiva und Passiva in der Vermögensbilanz sind zu adäquaten Preisen — in der Regel zu den am Bilanzstichtag geltenden Marktpreisen, bei einigen Kategorien jedoch zum Nominalwert — zu bewerten. Vermögensbilanzen werden für die gebietsansässigen institutionellen Sektoren und Teilsektoren, die Volkswirtschaft und die übrige Welt aufgestellt. |
|
7.03 |
Die Vermögensbilanz schließt das Kontensystem ab. Sie zeigt den endgültigen Effekt der Buchungen im Produktionskonto, in den Einkommensverteilungskonten, im Einkommensverwendungskonto und in den Vermögensänderungskonten auf den Vermögensbestand einer Volkswirtschaft. |
|
7.04 |
In der Vermögensbilanz der institutionellen Sektoren ist der Saldo das Reinvermögen. |
|
7.05 |
Der Saldo der Vermögensbilanz der gesamten Volkswirtschaft wird auch als Volksvermögen bezeichnet und umfasst den Gesamtwert der Vermögensgüter sowie die Nettoforderungen gegenüber der übrigen Welt. |
|
7.06 |
Die Vermögensbilanz der übrigen Welt wird erstellt wie die der gebietsansässigen institutionellen Sektoren und Teilsektoren. Sie enthält ausschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten Gebietsfremder gegenüber Gebietsansässigen. In der 6. Auflage des Zahlungsbilanz-Handbuchs des IWF (Balance of Payments Manual — BPM-6) wird die aus der Sicht der Gebietsansässigen gegenüber den Gebietsfremden erstellte Vermögensbilanz als „international investment position (IIP)“ (Auslandsvermögensstatus) bezeichnet. |
|
7.07 |
Das Eigenkapital ist definiert als die Summe des Reinvermögens (B.90) zuzüglich des Werts der als Verbindlichkeiten in der Vermögensbilanz ausgewiesenen Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5). |
|
7.08 |
Für die Sektoren nichtfinanzielle und finanzielle Kapitalgesellschaften sowie ihre Teilsektoren stellt das Eigenkapital einen ähnlich aussagekräftigen analytischen Indikator wie das Reinvermögen dar. |
|
7.09 |
Das Reinvermögen von Kapitalgesellschaften weicht in der Regel vom Wert der ausgegebenen Aktien und sonstigen Anteilsrechte ab. Das Reinvermögen von Quasi-Kapitalgesellschaften ist gleich null, da man davon ausgeht, dass der Wert des Eigenkapitals ihres Eigentümers dem Wert der Aktiva dieses Eigentümers abzüglich seiner nicht das Eigenkapital berührenden Verbindlichkeiten entspricht. Das Reinvermögen von gebietsansässigen Zweigniederlassungen gebietsfremder Unternehmen, die Gegenstand einer Direktinvestition sind und daher als Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt werden, ist also ebenfalls gleich null. |
|
7.10 |
Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten wird als finanzielles Reinvermögen (BF.90) bezeichnet. |
|
7.11 |
Die Vermögensbilanz zeigt den Wert der Aktiva und Passiva zu einem bestimmten Zeitpunkt. Vermögensbilanzen sind am Anfang und am Ende des Rechnungszeitraums zu erstellen, wobei die Eröffnungsbilanz der Schlussbilanz der vorherigen Periode entspricht. |
|
7.12 |
Der Wert des Bestandes an einem bestimmten Aktivum am Anfang und am Ende einer Periode sind durch folgende Buchungsregeln miteinander verknüpft:
Es kann auch eine Tabelle erstellt werden, welche den Wert des Bestandes an einem bestimmten Passivum am Anfang und am Ende einer Periode miteinander verknüpft. |
|||||||||||||||||||||||
|
7.13 |
Wie die Vermögenseröffnungs- und die Vermögensschlussbilanz über Transaktionen, sonstige Vermögensänderungen und Umbewertungsgewinne bzw. -verluste buchungstechnisch miteinander verknüpft sind, ist schematisch in Anhang 7.2 dargestellt. |
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVA
Definition eines Aktivums
|
7.14 |
Die Vermögensbilanz erfasst nur wirtschaftliche Vermögenswerte. |
|
7.15 |
Definition: Ein wirtschaftlicher Vermögenswert ist ein Wertaufbewahrungsmittel und steht für Erträge, die der wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die Einheit eine Zeitlang hält oder nutzt. Er ist ein Mittel, um Wert von einem Rechnungszeitraum auf den nächsten zu übertragen. |
|
7.16 |
Der wirtschaftliche Nutzen besteht in Primäreinkommen wie zum Beispiel Betriebsüberschuss, wenn der wirtschaftliche Eigentümer den Vermögenswert nutzt, oder Vermögenseinkommen, wenn der wirtschaftliche Eigentümer anderen gestattet, diesen zu nutzen. Die wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich aus der Nutzung des Vermögenswerts und dem Wert (einschließlich Umbewertungsgewinne/-verluste), der bei der Veräußerung oder Auflösung des Vermögenswerts realisiert wird. |
|
7.17 |
Der wirtschaftliche Eigentümer eines Vermögenswertes ist nicht zwangsläufig auch der rechtliche Eigentümer. Der wirtschaftliche Eigentümer ist die institutionelle Einheit, die Anspruch auf die mit der Nutzung des Vermögenswerts verbundenen Vorteile hat, weil sie die ebenfalls damit verbundenen Risiken übernimmt. |
|
7.18 |
Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über die Gliederung und die Abgrenzung der wirtschaftlichen Vermögenswerte. Die genaue Definition der verschiedenen Aktiva enthält Anhang 7.1. |
ABGRENZUNG AUS DEN AKTIVA UND PASSIVA
|
7.19 |
In der Vermögensbilanz nicht erfasst werden
|
GRUPPEN VON AKTIVA UND PASSIVA
|
7.20 |
Bei den Einträgen in die Vermögensbilanz werden zwei Hauptgruppen unterschieden: mit AN bezeichnete Vermögensgüter und mit AF bezeichnete Forderungen und Verbindlichkeiten. |
|
7.21 |
Vermögensgüter werden in produzierte Vermögensgüter (AN.1) und nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2) aufgegliedert. |
Produzierte Vermögensgüter (AN.1)
|
7.22 |
Definition: Produzierte Vermögensgüter (AN.1) sind Ergebnisse von Produktionsprozessen. |
|
7.23 |
Die produzierten Vermögensgüter (AN.1) werden nach ihrer Rolle im Produktionsprozess gegliedert. Dazu zählen Anlagegüter, die länger als ein Jahr wiederholt oder dauerhaft im Produktionsprozess eingesetzt werden, Vorräte, die als Vorleistungen im Produktionsprozess verbraucht, verkauft oder anderweitig verwendet werden, sowie Wertsachen, die nicht in erster Linie für die Zwecke der Produktion oder des Konsums verwendet, sondern primär als Wertaufbewahrungsmittel erworben werden. |
Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2)
|
7.24 |
Definition: Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2) sind wirtschaftliche Vermögenswerte, die nicht durch einen Produktionsprozess entstanden sind. Dazu zählen Naturvermögen, Nutzungsrechte, Genehmigungen, Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte. |
|
7.25 |
Die nichtproduzierten Vermögensgüter werden nach der Art ihrer Entstehung gegliedert. Einige von ihnen kommen in der Natur vor, andere, die man als „gesellschaftliche Konstrukte“ bezeichnet, entstehen durch rechtliche oder buchhalterische Regelungen. |
|
7.26 |
Naturvermögen wird nur dann als nichtproduziertes Sachvermögen ausgewiesen, wenn es die Definition für wirtschaftliche Vermögensgüter erfüllt. Das sind diejenigen Güter, an denen effektiv ein Eigentumsrecht besteht und die beim gegenwärtigen Stand der Technik und des Wissens, der gegebenen wirtschaftlichen Möglichkeiten, der vorhandenen Ressourcen und der Preisrelationen ihrem Eigentümer einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen können. Diejenigen Bestandteile des Naturvermögens, an denen keine Eigentumsrechte bestehen, wie die offenen Meere oder die Luft, zählen nicht dazu. |
|
7.27 |
Nutzungsrechte und Genehmigungen werden nur dann als Vermögensgüter betrachtet, wenn eine rechtliche Vereinbarung dem Inhaber über die vereinbarungsgemäß zu zahlenden Beträge hinausgehende wirtschaftliche Vorteile verschafft und der Inhaber solche Vorteile durch Übertragung auf andere auch rechtlich und praktisch nutzen kann. |
Forderungen und Verbindlichkeiten (AF)
|
7.28 |
Definition: Forderungen (AF) sind Vermögenswerte, die finanzielle Ansprüche, Anteilsrechte und den aus Barrengold bestehenden Teil des Währungsgoldes umfassen (siehe 5.03). Verbindlichkeiten entstehen, wenn Schuldner verpflichtet sind, eine Zahlung oder eine Reihe von Zahlungen an Gläubiger zu leisten (siehe 5.06). |
|
7.29 |
Forderungen sind Wertaufbewahrungsmittel und stehen für Erträge oder Reihen von Erträgen, die der wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die Vermögenswerte eine Zeitlang hält oder nutzt. Mit ihnen werden Werte von einem Rechnungszeitraum auf den nächsten übertragen. Der Austausch von Erträgen erfolgt durch Zahlungen (siehe 5.04). |
|
7.30 |
Mit Ausnahme des Teils des Währungsgoldes, der aus Barrengold besteht und der Position Währungsgold und Sonderziehungsrechte (AF.1) zugeordnet wird, steht jeder Forderung eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe gegenüber. |
|
7.31 |
Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten sind Verträge, die eine Seite nur dann zu einer Zahlung oder einer Reihe von Zahlungen an eine andere Einheit verpflichtet, wenn bestimmte festgelegte Bedingungen erfüllt sind (siehe 5.08). Dabei handelt es sich nicht um Forderungen und Verbindlichkeiten. |
|
7.32 |
Die Gliederung der Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht der Gliederung der finanziellen Transaktionen (siehe 5.14). Die Positionen, Unterpositionen und Teilpositionen der Forderungen und Verbindlichkeiten sind im Kapitel 5 definiert und erläutert und hier nicht wiederholt. Anhang 7.1 dieses Kapitels gibt jedoch eine Übersicht über sämtliche im ESVG definierten Aktiva und Passiva. Tabelle 7.1 — Klassifikation der Aktiva und Passiva
|
BEWERTUNG DER AKTIVA UND PASSIVA
Allgemeine Bewertungsgrundsätze
|
7.33 |
Jede Bestandsgröße in der Vermögensbilanz wird so bewertet, als ob sie am Bilanzstichtag erworben wäre. Aktiva und Passiva werden zu den am Bilanzstichtag geltenden Marktpreisen bewertet. |
|
7.34 |
Die erfassten Werte sollten die am Bilanzstichtag zu beobachtenden Marktpreise widerspiegeln. Sind keine Marktpreise zu beobachten, z. B. wenn zwar ein Markt besteht, aber auf ihm in der jüngsten Vergangenheit keine Vermögenswerte verkauft wurden, so ist zu schätzen, wie hoch der Preis der Vermögensposition wäre, wenn sie am Bilanzstichtag am Markt gekauft worden wäre. |
|
7.35 |
Marktpreise sind in der Regel für viele Forderungen und Verbindlichkeiten, Immobilien (Gebäude und sonstige Bauwerke einschließlich des Grund und Bodens, auf dem sie sich befinden), vorhandene Fahrzeuge, Feldfrüchte und Viehbestände sowie für neu produzierte Anlagegüter und Vorräte verfügbar. |
|
7.36 |
Selbsterstellte Vermögensgüter sollten zu Herstellungspreisen bzw. zu den Herstellungspreisen vergleichbarer Güter oder, wenn keine Herstellungspreise verfügbar sind, mit der Summe ihrer Kosten bewertet werden. |
|
7.37 |
Neben am Markt beobachteten oder anhand von beobachteten Preisen oder entstandenen Kosten geschätzten Preisen können zur Bewertung der Vermögensgüter Schätzwerte herangezogen werden, z. B.
|
|
7.38 |
Die Bewertung zu Marktpreisen ist das Grundprinzip für die Bewertung von Positionen (und Transaktionen) bei Finanzinstrumenten. Finanzinstrumente sind das Gleiche wie finanzielle Forderungen. Sie sind finanzielle Vermögenswerte, denen Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Der Marktwert ist der Preis, zu dem vertragswillige Parteien finanzielle Vermögensgüter aus rein kommerziellen Gründen untereinander erwerben oder veräußern, ohne Provisionen, Gebühren und Steuern. Bei der Ermittlung der Marktwerte berücksichtigen die Handelspartner auch die aufgelaufenen Zinsen. |
|
7.39 |
In die Bewertung zum Nominalwert geht die Summe der ursprünglich gezahlten Mittel zuzüglich weiterer Zahlungen, abzüglich Rückzahlungen, zuzüglich aufgelaufener Zinsen ein. Der Nominalwert ist nicht dasselbe wie der Nennwert.
|
|
7.40 |
Bei einigen Vermögensgütern verringert sich ihr umbewerteter ursprünglicher Anschaffungspreis über die erwartete Nutzungsdauer hinweg auf null. Der Wert dieser Vermögensgüter zu einem bestimmten Zeitpunkt ergibt sich aus dem umbewerteten Anschaffungspreis abzüglich solcher kumulierter Abzüge. |
|
7.41 |
Nach dieser Methode können die meisten Anlagegüter zu jeweiligen Kaufpreisen (Wiederbeschaffungspreisen) abzüglich Abschreibungen bewertet werden. Dies wird als Restwert bezeichnet. Die Summe der Restwerte aller noch genutzten Anlagegüter wird als Nettoanlagevermögen bezeichnet. Das Bruttoanlagevermögen versteht sich einschließlich der kumulierten Abschreibungen. |
VERMÖGENSGÜTER (AN)
Produzierte Vermögensgüter (AN.1)
Anlagegüter (AN.11)
|
7.42 |
Anlagegüter sind, sofern möglich, zu Marktpreisen (bzw. zu Herstellungspreisen im Fall von selbsterstellten neuen Anlagen) auszuweisen, andernfalls zu Anschaffungspreisen vermindert um die kumulierten Abschreibungen. Der in der Vermögensbilanz zu buchende Wert enthält auch die Eigentumsübertragungskosten dieser Sachanlagen, vermindert um die Abschreibungen über die erwartete Nutzungsdauer hinweg. |
Geistiges Eigentum (AN.117)
|
7.43 |
Suchbohrungen (Position AN.1172) sind entweder anhand der Beträge zu bewerten, die an andere institutionelle Einheiten für die Erschließung der Bodenschätze gezahlt wurden oder auf der Basis der durch eigene Exploration entstandenen Kosten. Der noch nicht voll abgeschriebene Teil von in der Vergangenheit erfolgten Explorationsarbeiten ist zu den Preisen bzw. Kosten des jeweiligen Rechnungszeitraums umzubewerten. |
|
7.44 |
Geistiges Eigentum (Software sowie Originale der Unterhaltungsindustrie, literarische und künstlerische Originale) ist zu Anschaffungspreisen zu bewerten, wenn es am Markt gehandelt wird. Der ursprüngliche Wert wird anhand der Herstellungskosten geschätzt und adäquat auf das Preisniveau der Berichtsperiode umbewertet. Andernfalls wird der Gegenwartswert der erwarteten künftigen Erträge aus diesen Aktiva geschätzt. |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter (AN.116)
|
7.45 |
Die Eigentumsübertragungskosten nichtproduzierter Vermögensgüter (außer Grund und Boden) werden separat im Vermögensbildungskonto ausgewiesen und als Bruttoanlageinvestitionen behandelt; in der Vermögensbilanz werden solche Kosten jedoch dem Wert des Aktivums hinzugerechnet, auf das sie sich beziehen, selbst wenn dieses Aktivum zu den nichtproduzierten Vermögensgütern gehört. Somit werden in den Vermögensbilanzen Eigentumsübertragungskosten nicht eigens ausgewiesen. Die Eigentumsübertragungskosten finanzieller Vermögenswerte werden als Vorleistungen behandelt, wenn diese Vermögenswerte von Unternehmen oder vom Staat erworben werden, als Konsum, wenn sie von privaten Haushalten und als Dienstleistungsexporte, wenn sie von Gebietsfremden erworben werden. |
Vorräte (AN.12)
|
7.46 |
Vorräte sind zu den am Bilanzstichtag geltenden Preisen zu bewerten und nicht zu den Preisen, mit denen sie auf Lager genommen wurden. |
|
7.47 |
Vorräte an Vorleistungsgütern werden zu Anschaffungspreisen, Vorräte an Fertigerzeugnissen und an unfertigen Erzeugnissen bzw. angefangenen Arbeiten werden zu Herstellungspreisen bewertet. Die Bewertung von Vorräten an Handelsware erfolgt zu den am Bilanzstichtag geltenden Preisen ohne die den Groß- oder Einzelhändlern entstandenen Transportkosten. Zur Bewertung von Vorräten an unfertigen Erzeugnissen bzw. von angefangenen Arbeiten in der Vermögensschlussbilanz wird der zum Ende des Rechnungszeitraums angefallene Anteil der gesamten Produktionskosten an die Herstellungskosten eines vergleichbaren Fertigerzeugnisses zu Preisen am Bilanzstichtag angelegt. Ist der Herstellungspreis des Fertigerzeugnisses nicht verfügbar, wird er anhand der Produktionskosten zuzüglich eines Aufschlags für den erwarteten Nettobetriebsüberschuss bzw. für das Selbständigeneinkommen geschätzt. |
|
7.48 |
Zur Bewertung von noch im Wachstum befindlichen Pflanzungen, die lediglich einmalig Erzeugnisse liefern (außer Forsten), und von Schlachtvieh können die Marktpreise entsprechender Güter herangezogen werden. Zur Bewertung des Holzes auf dem Stamm werden die künftigen Erträge aus dem Verkauf des Holzes abzüglich der Ausgaben für die Pflege des Forstes bis zur Einschlagsreife und für den Holzeinschlag usw. auf jeweilige Preise abgezinst. |
Wertsachen (AN.13)
|
7.49 |
Wertsachen wie Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck, Edelsteine, Nichtwährungsgold und andere Metalle werden zu jeweiligen Preisen bewertet. Sofern organisierte Märkte für diese Aktiva existieren, sind sie zu dem tatsächlichen oder geschätzten Preis zu bewerten, der für sie gezahlt würde, wenn sie am Bilanzstichtag am Markt gekauft würden, abzüglich sämtlicher Gebühren oder Provisionen. Andernfalls sind zur Bewertung auf das jeweilige Preisniveau umbewertete Anschaffungspreise heranzuziehen. |
Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2)
Natürliche Ressourcen (AN.21)
Grund und Boden (AN.211)
|
7.50 |
In der Vermögensbilanz wird Grund und Boden zu jeweiligen Marktpreisen bewertet. Ausgaben für die Bodenverbesserung werden als Bruttoanlageinvestitionen erfasst; der dabei erzielte Mehrwert wird nicht dem in der Vermögensbilanz ausgewiesenen Wert des Grund und Bodens zugeordnet, sondern in einer separaten Position für Bodenverbesserung gebucht (AN.1123). |
|
7.51 |
Grund und Boden wird zu dem Preis bewertet, der schätzungsweise bei einem Verkauf am Markt erzielt würde, ausgenommen die Grundstücksübertragungskosten bei einem künftigen Verkauf. Eine Übertragung wird vereinbarungsgemäß als Bruttoanlageinvestition erfasst; die Kosten werden nicht unter AN.211 (Grund und Boden) in der Vermögensbilanz berücksichtigt, sondern als Aktivum unter AN.1123 ausgewiesen. Dieser Posten wird über den vom neuen Eigentümer erwarteten Zeitraum der Nutzung des Grundstücks auf null abgeschrieben. |
|
7.52 |
Kann der Wert von Grund und Boden nicht getrennt vom Wert der auf ihm befindlichen Gebäude oder sonstigen Bauten ermittelt werden, wird das gesamte Aktivum derjenigen Kategorie zugeordnet, auf die der größere Teil seines Wertes entfällt. |
Bodenschätze (AN.212)
|
7.53 |
Ober- und unterirdische Mineralvorkommen, die aufgrund des Stands der Technik und der relativen Preise wirtschaftlich abbaubar sind, werden zum Gegenwartswert der erwarteten Nettoerträge aus ihrem kommerziellen Abbau bewertet. |
Sonstiges Naturvermögen (AN.213, AN.214 und AN.215)
|
7.54 |
Da es kaum möglich sein dürfte, Marktpreise für freie Tier- und Pflanzenbestände AN.213), Wasserreserven (AN.214) und sonstige natürliche Ressourcen (AN.215) zu beobachten, werden sie in der Regel zum Gegenwartswert der aus ihnen erwarteten künftigen Erträge bewertet. |
Nutzungsrechte (AN.22)
|
7.55 |
Definition: Nutzungsrechte werden als Vermögenswerte erfasst, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Die Nutzungsrechte lassen sich anhand von Marktinformationen bewerten, die sich aus den Dokumenten zur Übertragung der Rechte ergeben, oder sie können als der Gegenwartswert der zum Bilanzstichtag erwarteten künftigen Erträge im Vergleich zur Situation zu Vertragsbeginn geschätzt werden. |
|
7.56 |
Die Position umfasst Aktiva, die sich aus Nutzungsrechten an produzierten Vermögensgütern, Lizenzen zur Nutzung natürlicher Ressourcen, Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten und Exklusivrechten auf künftige Waren und Dienstleistungen ergeben. |
|
7.57 |
Der Wert des Aktivums entspricht dem Nettogegenwartswert des Überschusses des geltenden Preises über den in der Vereinbarung festgelegten Preis. Unter sonst gleichen Umständen sinkt der geltende Preis über die Vertragslaufzeit hinweg. Wertänderungen des Aktivums aufgrund von Veränderungen des geltenden Preises werden als nominale Umbewertungsgewinne/-verluste erfasst. |
|
7.58 |
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern werden nur erfasst, wenn der Leasingnehmer sein Recht zur Realisierung des Preisunterschieds wahrnimmt. |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte (AN.23)
|
7.59 |
Der Bilanzausweis des Firmenwerts und der einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerte beläuft sich auf den Betrag, um den der beim Verkauf einer institutionellen Einheit gezahlte Preis den für deren Eigenkapital erfassten Wert, berichtigt um alle späteren Verminderungen dieses Betrags im Ergebnis der Abschreibung des ursprünglichen Wertes als Abbuchung nichtproduzierter Vermögensgüter (K.2), übersteigt. Der Abschreibungssatz entspricht kaufmännischen Rechnungslegungsstandards. |
|
7.60 |
Einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte sind z. B. Markennamen, Drucktitel, Warenzeichen, Logos und Domänennamen. |
FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN (AF)
|
7.61 |
Forderungen und Verbindlichkeiten als begebbare Finanzinstrumente wie Schuldverschreibungen, Dividendenwerte, Investmentfondsanteile und Finanzderivate werden zum Marktwert erfasst. Nicht begebbare Finanzinstrumente werden zum Nominalwert erfasst (siehe 7.38 und 7.39). Die ihnen gegenüberstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit demselben Wert ausgewiesen. Die Werte sollte ohne Provisionen, Gebühren und Steuern erfasst werden. Provisionen, Gebühren und Steuern werden als Dienstleistungen bei der Durchführung der Transaktionen verbucht. |
Währungsgold und SZR (AF.1)
|
7.62 |
Währungsgold (AF.11) ist zu dem Preis zu bewerten, der sich an organisierten Goldmärkten bildet. |
|
7.63 |
Der Wert der SZR (AF.12) wird täglich vom Internationalen Währungsfonds festgelegt, so dass ihr Wert in Landeswährung anhand von Informationen an den Devisenmärkten festgestellt werden kann. |
Bargeld und Einlagen (AF.2)
|
7.64 |
Bargeld (Banknoten und Münzen — AF.21) ist zum Nominalwert zu bewerten. |
|
7.65 |
Einlagen (AF.22, AF.29) werden in der Vermögensbilanz zum Nominalwert erfasst. |
|
7.66 |
Bargeld und Einlagen in Fremdwährung werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Mittel aus dem An- und dem Verkaufskassakurs für Devisentransaktionen in Landeswährung umgerechnet. |
Schuldverschreibungen (AF.3)
|
7.67 |
Schuldverschreibungen werden zum Marktwert erfasst. |
|
7.68 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen (AF.31) werden zum Marktwert erfasst. Stehen keine Marktwerte zur Verfügung, werden sie — sofern keine hohe Inflation oder hohe Nominalzinssätze gegeben sind — anhand des Nominalwertes näherungsweise geschätzt, und zwar in folgenden Fällen:
|
|
7.69 |
Langfristige Schuldverschreibungen (AF.32) werden zum Marktwert bewertet, unabhängig davon, ob es sich um Papiere mit regelmäßiger Zinszahlung, um Anleihen mit niedriger Nominalverzinsung und hohem Rückzahlungskurs („Deep discount bonds“) oder um Null-Kupon-Anleihen handelt, auf die nur sehr geringe oder keine Zinsen gezahlt werden. |
Kredite (AF.4)
|
7.70 |
In der Vermögensbilanz des Gläubigers und in der des Schuldners ist jeweils der Nominalwert auszuweisen, unabhängig davon, ob die Kredite notleidend sind oder nicht. |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5)
|
7.71 |
Börsennotierte Aktien (AF.511) werden zum Marktwert bewertet. Auf beiden Seiten der Vermögensbilanz, der Aktivseite und der Passivseite, ist derselbe Wert anzusetzen, obwohl es sich bei Anteilsrechten rechtlich gesehen nicht um Verbindlichkeiten des Emittenten handelt, sondern um ein Eigentumsrecht an einem Anteil am Liquidationswert der Kapitalgesellschaft, dessen Höhe im Voraus nicht bekannt ist. |
|
7.72 |
Börsennotierte Aktien werden zu einem an der Börse oder anderen organisierten Finanzmärkten festgestellten repräsentativen Mittelkurs bewertet. |
|
7.73 |
Der Wert nicht börsennotierter Aktien (AF.512), die nicht an organisierten Märkten gehandelt werden, ist auf folgende Weise zu schätzen:
Dabei werden allerdings Unterschiede zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten Aktien, insbesondere hinsichtlich deren Liquidität, sowie das von der Kapitalgesellschaft angesammelte Reinvermögen und der Wirtschaftszweig der Kapitalgesellschaft berücksichtigt. |
|
7.74 |
Welches Schätzverfahren angewendet wird, richtet sich nach den verfügbaren Basisdaten. In das Verfahren können z. B. Angaben über Unternehmenszusammenschlüsse einbezogen werden, bei denen nicht börsennotierte Aktien eine Rolle spielen. Verändert sich der Wert des Eigenkapitals nicht börsennotierter Kapitalgesellschaften im Durchschnitt und im Verhältnis zum Gesellschaftskapital ähnlich wie bei vergleichbaren Kapitalgesellschaften mit börsennotierten Aktien, kann der in der Vermögensbilanz zu buchende Wert mittels einer Quote berechnet werden. In dieser Quote wird der Wert des Eigenkapitals nicht börsennotierter Unternehmen mit dem börsennotierter Unternehmen verglichen. Wert der nicht börsennotierten Aktien = Kurs vergleichbarer börsennotierter Aktien × (Eigenkapital nicht börsennotierter Kapitalgesellschaften) / (Eigenkapital vergleichbarer börsennotierter Kapitalgesellschaften) |
|
7.75 |
Das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Eigenkapital kann je nach Wirtschaftszweig unterschiedlich sein. Der jeweilige Preis nicht börsennotierter Aktien sollte für jeden Wirtschaftszweig einzeln berechnet werden. Unter Umständen bestehen noch weitere Unterschiede zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, die sich auf das Schätzverfahren auswirken könnten. |
|
7.76 |
Sonstige Anteilsrechte (AF.519) sind Beteiligungen, die nicht in Form von Wertpapieren dargestellt werden. Dazu können gehören: Anteilsrechte an Quasi-Kapitalgesellschaften (wie Zweigniederlassungen, Trusts, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und anderen Gesellschaften), öffentlich kontrollierten Kapitalgesellschaften, Fonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit und fiktiven Einheiten (einschließlich fiktiver gebietsansässiger Einheiten, die gegründet wurden, um gebietsfremdes Eigentum an Immobilien und natürlichen Ressourcen widerzuspiegeln). Das nicht in Form von Anteilsrechten bestehende Eigentum an internationalen Organisationen wird als sonstige Anteilsrechte klassifiziert. |
|
7.77 |
Die sonstigen Anteilsrechte an Quasi-Kapitalgesellschaften werden gemäß deren Eigenkapital bewertet, da ihr Reinvermögen vereinbarungsgemäß gleich null ist. Bei anderen Einheiten sollte unter den Methoden für nicht börsennotierte Aktien die geeignetste gewählt werden. |
|
7.78 |
Kapitalgesellschaften, die Aktien oder Anteile ausgeben, können darüber hinaus über weiteres Eigenkapital verfügen. |
|
7.79 |
Anteile an Investmentfonds (AF.52) werden, sofern sie börsennotiert sind, zum Marktpreis erfasst. Sind sie nicht börsennotiert, wird der Marktwert wie für nicht börsennotierte Aktien beschrieben geschätzt. Werden sie vom Investmentfonds selbst zurückgenommen, werden sie zum jeweiligen Rücknahmepreis erfasst. |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6)
|
7.80 |
Die für Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen (AF.61) verbuchten Beträge umfassen gezahlte, aber nicht verbrauchte Prämien zuzüglich der Rückstellungen für eingetretene Versicherungsfälle. Letztere repräsentieren den Gegenwartswert der für die Abwicklung von Schadensfällen, einschließlich strittiger Schadensfälle, zurückgestellten Beträge sowie einen Betrag zur Deckung von Ansprüchen aus Ereignissen, die geschehen sind, aber noch nicht gemeldet wurden. |
|
7.81 |
Bei den Beträgen, die für Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen (AF.62) verbucht werden, handelt es sich um die zur Deckung aller erwarteten künftigen Ansprüche benötigten Rückstellungen. |
|
7.82 |
Die für Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen (AF.63) erfassten Beträge hängen von der Art des Alterssicherungssystems ab. |
|
7.83 |
In einem System mit Leistungszusagen richtet sich die Höhe der den teilnehmenden Arbeitnehmern zugesicherten Alterssicherungsleistungen nach einer im Voraus vereinbarten Formel. Die Verbindlichkeit eines Alterssicherungssystems mit Leistungszusagen ist gleich dem Gegenwartswert der zugesagten Leistungen. |
|
7.84 |
In einem System mit Beitragszusagen hängen die ausgezahlten Leistungen von der Entwicklung der durch die Pensionseinrichtung erworbenen Vermögenswerte ab. Die Verbindlichkeit eines Systems, das auf den eingezahlten Beiträgen basiert, ist gleich dem jeweiligen Marktwert der Aktiva des Alterssicherungssystems. Das Reinvermögen des Alterssicherungssystems ist grundsätzlich gleich null. |
|
7.85 |
Der für Rückstellungen für Forderungen im Rahmen von Standardgarantien (AF.66) erfasste Wert entspricht der erwarteten Höhe der Ansprüche abzüglich des Werts erwarteter Rückflüsse. |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7)
|
7.86 |
Finanzderivate (AF.71) sind in der Vermögensbilanz zum Marktpreis auszuweisen. Stehen keine Angaben zum Marktpreis zur Verfügung, z. B. bei Freiverkehrsoptionen (OTC-Optionen), so ist entweder der Betrag anzusetzen, der erforderlich ist, um den Kontrakt zurückzukaufen oder zu verrechnen, oder der gezahlte Optionspreis. |
|
7.87 |
Bei Optionen gilt, dass der Optionsverkäufer eine Verbindlichkeit in Höhe der Kosten eingegangen ist, die beim Rückkauf der Rechte des Optionskäufers entstehen. |
|
7.88 |
Der Marktwert von Optionen und Terminkontrakten kann je nach den Preisänderungen der zugrundeliegenden Titel zwischen positiven (Aktiva) und negativen (Passiva) Positionen wechseln, d. h. diese Wertpapiere können bei Verkäufern und Käufern von Forderungen zu Verbindlichkeiten werden und umgekehrt. Einige Optionen und Terminkontrakte funktionieren mit Ausgleichszahlungen; hier werden Gewinne oder Verluste täglich festgestellt, und in diesen Fällen ist der Bilanzausweis gleich null. |
|
7.89 |
Mitarbeiteraktienoptionen (AF.72) werden mit dem üblicher Marktpreis (fair value) des gewährten Anteilsrechts bewertet. Der übliche Marktpreis wird am Tag der Gewährung anhand des Marktwerts entsprechender gehandelter Optionen oder, wenn solche Daten nicht vorliegen, mithilfe eines Optionspreismodells gemessen. |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8)
|
7.90 |
Handelskredite und Anzahlungen (AF.81) und übrige Forderungen/Verbindlichkeiten ohne Handelskredite und Vorschüsse (AF.89), die aufgrund eines zeitlichen Abstands zwischen Verteilungstransaktionen wie Steuern, Sozialbeiträgen, Dividenden, Mieten, Löhnen und Gehältern und finanziellen Transaktionen entstehen, werden in der Vermögensbilanz des Gläubigers und in der des Schuldners zum Nominalwert bewertet. Unter AF.89 als Verbindlichkeiten ausgewiesene Beträge an Steuern und Sozialbeiträgen sollten ohne die Beträge aufgeführt sein, deren Einziehung unwahrscheinlich ist, da Letztere eine staatliche Forderung ohne Wert darstellen. |
FINANZIELLE VERMÖGENSBILANZEN
|
7.91 |
In der finanziellen Vermögensbilanz werden auf der linken Seite die Forderungen und auf der rechten Seite die Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Saldo der finanziellen Vermögensbilanz ist das finanzielle Reinvermögen (BF.90). |
|
7.92 |
Die finanzielle Vermögensbilanz eines gebietsansässigen Sektors oder Teilsektors kann konsolidiert sein oder nicht. Die unkonsolidierte finanzielle Vermögensbilanz enthält alle Forderungen und Verbindlichkeiten der dem betreffenden Sektor oder Teilsektor angehörenden institutionellen Einheiten, einschließlich der Fälle, in denen die entsprechende Forderung oder Verbindlichkeit in diesem Sektor oder Teilsektor gehalten wird. In der konsolidierten finanziellen Vermögensbilanz sind diejenigen Forderungen und Verbindlichkeiten, die zwischen den Einheiten des Sektors oder Teilsektors bestehen, nicht berücksichtigt. Die finanzielle Vermögensbilanz der übrigen Welt ist stets konsolidiert. In der Regel sind die Buchungen im System nicht konsolidiert. Deshalb ist die finanzielle Vermögensbilanz eines gebietsansässigen Sektors oder Teilsektors nicht konsolidiert darzustellen. |
|
7.93 |
Bei der nach Schuldnern/Gläubigern aufgegliederten finanziellen Vermögensbilanz (die die Frage „Von wem zu wem?“ beantwortet) handelt es sich um eine erweiterte Fassung der finanziellen Vermögensbilanz, die zusätzlich eine Aufgliederung der Forderungen nach Schuldnersektoren und der Verbindlichkeiten nach Gläubigersektoren enthält. Sie liefert daher Informationen über die Schuldner-Gläubiger-Beziehungen und ist konsistent mit dem Finanzierungskonto nach Schuldnern/Gläubigern. |
NACHRICHTLICHER AUSWEIS
|
7.94 |
In der Vermögensbilanz sind drei Arten von Positionen nachrichtlich auszuweisen, die im Fall einiger Sektoren für bestimmte Untersuchungen relevant sind:
|
|
7.95 |
Definition: Langlebige Konsumgüter sind dauerhafte Güter, die von privaten Haushalten während eines Zeitraums von mehr als einem Jahr wiederholt für Zwecke des Konsums verwendet werden. Sie werden in der Vermögensbilanz nachrichtlich ausgewiesen. Sie sind in der Vermögensbilanz selbst nicht enthalten, weil diese Güter im Einkommensverwendungskonto der privaten Haushalte auf der Verwendungsseite verbucht werden, und zwar als im Rechnungszeitraum und nicht erst nach und nach verbraucht. |
|
7.96 |
Die Bestände an langlebigen Konsumgütern, über die die privaten Haushalte als Endverbraucher verfügen — Fahrzeuge (AN.1131) und sonstige Ausrüstungen (AN.1139) —, werden im nachrichtlichen Ausweis zu Marktpreisen vermindert um die kumulierten Abschreibungen bewertet. Eine vollständige Liste der Untergruppen und Positionen der langlebigen Konsumgüter findet sich in Kapitel 23. |
|
7.97 |
Langlebige Güter wie Kraftfahrzeuge können je nach Sektorzuordnung des Eigentümers und Verwendungszweck Anlagegüter oder langlebige Konsumgüter sein. Beispielsweise kann ein Kraftfahrzeug zum Teil von einer Quasi-Kapitalgesellschaft für Produktionszwecke und zum Teil von einem privaten Haushalt als Endverbraucher verwendet werden. Die in der Vermögensbilanz des Sektors nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11) ausgewiesenen Ausrüstungen sollten den auf die Quasi-Kapitalgesellschaft entfallenden Teil der Verwendung widerspiegeln. Ähnliches gilt für die Teilsektoren Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142). Der dem Sektor private Haushalte (S.14) als Endverbraucher zugerechnete Anteil sollte nachrichtlich ausgewiesen werden, vermindert um die kumulierten Abschreibungen. |
Ausländische Direktinvestitionen (AF.m1)
|
7.98 |
Forderungen und Verbindlichkeiten in Form von Direktinvestitionen werden nach der Art der Investition als Kredite (AF.4), Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5) oder sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8) erfasst. Der Teil der Anteilsrechte, der Kredite oder der sonstigen Forderungen/Verbindlichkeiten, der zu den Direktinvestitionen zählt, wird nachrichtlich unter diesen Kategorien als Direktinvestition ausgewiesen. |
Notleidende Kredite (AF.m2)
|
7.99 |
Kredite werden in der Vermögensbilanz zum Nominalwert erfasst. |
|
7.100 |
Kredite, die seit einiger Zeit nicht mehr bedient wurden, werden nachrichtlich in der Vermögensbilanz des Gläubigers ausgewiesen. Solche Kredite werden als notleidend bezeichnet. |
|
7.101 |
Definition: Ein Kredit wird als notleidend bezeichnet, wenn a) für Zins- oder Tilgungszahlungen der Fälligkeitstermin seit mindestens 90 Tagen verstrichen ist, b) Zinszahlungen, die seit mindestens 90 Tagen fällig sind, aufgrund einer Vereinbarung kapitalisiert, refinanziert oder verschoben wurden, oder c) Zahlungen seit weniger als 90 Tagen überfällig sind, jedoch andere gute Gründe (z. B. der Konkursantrag eines Schuldners) bezweifeln lassen, dass die Zahlungen vollständig geleistet werden. |
|
7.102 |
Diese Definition eines notleidenden Kredits ist so auszulegen, dass länderspezifische Vereinbarungen über den Zeitpunkt, ab dem ein Kredit als notleidend betrachtet wird, berücksichtigt werden. Ist ein Kredit als notleidend eingestuft, sollte es (auch für Ersatzkredite) bei dieser Klassifizierung bleiben, bis Zahlungen eingehen oder der Kapitalbetrag dieses Kredits oder nachfolgender Ersatzkredite abgeschrieben ist. |
|
7.103 |
Bei notleidenden Krediten sind zwei Positionen nachrichtlich auszuweisen:
|
|
7.104 |
Der beste Näherungswert für das Marktwertäquivalent ist der übliche Marktpreis (fair value), der definiert ist als „der geschätzte Wert, der sich bei einer Markttransaktion zwischen zwei Parteien ergeben würde“. Der übliche Marktpreis kann anhand von Transaktionen mit vergleichbaren Instrumenten oder anhand des abgezinsten Gegenwartswerts von Cashflows ermittelt werden; solche Daten liegen möglicherweise in der Vermögensbilanz des Gläubigers vor. Existieren keine Angaben zum üblichen Marktpreis, ist für den nachrichtlichen Ausweis der zweitbeste Ansatz zu wählen und der Nominalwert abzüglich der erwarteten Verluste aus Kreditgewährung zu erfassen. |
Erfassung notleidender Kredite
|
7.105 |
Die notleidenden Kredite der Sektoren Staat und finanzielle Kapitalgesellschaften müssen nachrichtlich erfasst werden, ebenso wie bedeutende Beträge, die bei anderen Sektoren anfallen. Sofern die an die übrige Welt oder aus der übrigen Welt gewährten Kredite nennenswert sind, werden diese ebenfalls nachrichtlich ausgewiesen. |
|
7.106 |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Positionen und Ströme, die bei notleidenden Krediten erfasst werden, um einen vollständigeren Überblick über Bestände, Transaktionen, Umbuchungen und Abschreibungen zu vermitteln. |
|
7.107 |
In dem Beispiel geht es um einen Betrag ausstehender Kredite zum Nominalwert von 1 000 zum Zeitpunkt t-1; von diesem Betrag werden 500 bedient, 500 sind notleidend. Die Mehrheit der notleidenden Kredite, nämlich 400, wird durch Rückstellungen für Verluste aus Kreditgewährung gedeckt, 100 jedoch nicht. Aus dem zweiten Teil der Tabelle gehen weitere detaillierte Angaben zum Marktwertäquivalent der notleidenden Kredite hervor. Dieser Wert ergibt sich als Differenz zwischen dem Nominalwert und den Rückstellungen für Verluste aus Kreditgewährung. Zum Zeitpunkt t-1 wird er mit 375 angesetzt. Im Zeitraum von t-1 bis t werden die Kredite teilweise umgebucht (von bedient oder noch nicht gedeckt zu notleidend oder umgekehrt) oder abgeschrieben. Die Ströme werden in den entsprechenden Spalten der Tabelle ausgewiesen. Bei den Rückstellungen für Verluste aus Kreditgewährung werden ebenfalls die Nominalwerte und die Marktwertäquivalente aufgeführt. |
|
7.108 |
Die Bewertung der Rückstellungen für Verluste aus Kreditgewährung muss nach Maßgabe der Rechnungslegungsstandards, der Rechtspersönlichkeit der Einheiten und der auf diese anzuwendenden steuerlichen Vorschriften erfolgen; dadurch kann es zu recht unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Höhe und der Dauer der Rückstellungen für Verluste aus Kreditgewährung kommen. Dies erschwert die Erfassung notleidender Kredite in den Hauptkonten und führt zu ihrem nachrichtlichen Ausweis. Vorzugsweise sollten zusätzlich zu den Nominalwerten für bediente und notleidende Kredite hinaus auch die Marktwertäquivalente nachrichtlich ausgewiesen werden. Erfassung notleidender Kredite
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHANG 7.1
BESCHREIBUNG DER AKTIVA UND PASSIVA
|
Klassifikation der Aktiva und Passiva |
Beschreibung |
|
Vermögensgüter (AN) |
Vermögensgüter sind nichtfinanzielle Werte, an denen institutionelle Einheiten individuelle oder kollektive Eigentumsrechte haben und aus deren Besitz, Nutzung oder Überlassung zur Nutzung während eines bestimmten Zeitraums die Eigentümer wirtschaftliche Vorteile erzielen können. Sie umfassen Anlagegüter, Vorräte, Wertsachen, gesellschaftliche Konstrukte und geistiges Eigentum. |
|
Produzierte Vermögensgüter (AN.1) |
Nichtfinanzielle Vermögensgüter sind Ergebnisse von Produktionsprozessen. Sie umfassen Anlagegüter, Vorräte und Wertsachen, wie im Folgenden definiert. |
|
Anlagegüter (AN.11) |
Produzierte Vermögensgüter, die länger als ein Jahr im Produktionsprozess wiederholt oder dauerhaft eingesetzt werden. Anlagegüter umfassen Wohnbauten, Nichtwohnbauten, Ausrüstungen, militärische Waffensysteme, Nutztiere und Nutzpflanzungen sowie geistiges Eigentum, wie im Folgenden definiert. |
|
Wohnbauten (AN.111) |
Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten, wie etwa Garagen, und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnräumen installiert sind. Hausboote, Binnenschiffe, Wohnwagen und Caravans, die von privaten Haushalten als Hauptwohnsitz genutzt werden, gehören ebenso zu den Wohnbauten; auch öffentliche Denkmäler (siehe AN.1121), die im Wesentlichen als Wohnungen genutzt werden, sind eingeschlossen. Die Position umfasst auch die Erschließungskosten. Zu den Wohnbauten gehören z. B. Wohngebäude mit einer oder zwei Wohnungen und sonstige Wohngebäude, die dauerhaft für Wohnzwecke bestimmt sind. Unfertige Wohnbauten fallen insoweit darunter, wie der Endverwender feststeht, sei es, dass die Wohnung für die Eigennutzung gebaut wird oder dass sie vertraglich in das Eigentum des Endverwenders übergegangen ist. Für Angehörige der Streitkräfte erworbene Wohnungen fallen unter die Position, da sie ebenso wie von zivilen Einheiten erworbene Wohnungen für die Produktion von Wohndienstleistungen genutzt werden. Der Wert der Wohnbauten wird ohne den Grund und Boden erfasst, auf dem sie stehen; der Wert dieser Grundstücke wird, sofern er separat erfasst wird, unter Grund und Boden (AN.211) verbucht. |
|
Nichtwohnbauten (AN.112) |
Nichtwohnbauten umfassen nicht zu Wohnzwecken gedachte Gebäude sowie sonstige Bauten und Bodenverbesserungen, wie im Folgenden definiert. Unfertige Bauten werden einbezogen, wenn sie für die Eigennutzung errichtet werden oder wenn laut Kaufvertrag der Endverwender feststeht. Die Position umfasst auch zu militärischen Zwecken erworbene Bauten. Der Wert der Nichtwohnbauten wird ohne den Grund und Boden erfasst, auf dem sie stehen; der Wert dieser Grundstücke wird, sofern er separat erfasst wird, unter Grund und Boden (AN.211) verbucht. |
|
Nichtwohngebäude (AN.1121) |
Gebäude, bei denen es sich nicht um Wohnbauten handelt, einschließlich fest verbundener Installationen, Einrichtungen und Ausrüstungen und einschließlich der Erschließungskosten. Öffentliche Denkmäler (siehe AN.1122), die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt werden, fallen ebenfalls unter die Position. Öffentliche Denkmäler sind an ihrer besonderen historischen, nationalen, regionalen oder lokalen religiösen oder symbolischen Bedeutung zu erkennen. Sie werden als öffentlich bezeichnet, weil sie der Öffentlichkeit zugänglich sind, nicht weil sie sich im Eigentum des öffentlichen Sektors befinden. Besucher müssen häufig Eintritt zahlen. Abschreibungen neuer Denkmäler oder bedeutende Verbesserungen bestehender Denkmäler sollten unter der Annahme einer angemessen langen Lebensdauer berechnet werden. Zu den Nichtwohngebäuden gehören z. B. Lagerhäuser, Fabrikgebäude, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude sowie Gebäude für öffentliche Veranstaltungen, Hotels, Gaststätten, Schulgebäude und Krankenhäuser. |
|
Sonstige Bauten (AN.1122) |
Nichtwohnbauten, bei denen es sich nicht um Gebäude handelt. Eingeschlossen sind Kosten für Straßen, Kanalisation und die Erschließung. Hinzu kommen: öffentliche Denkmäler, die nicht als Wohnbauten oder Nichtwohngebäude klassifiziert werden; Schächte, Tunnel und sonstige im Zusammenhang mit dem Abbau von Bodenschätzen stehende Bauten; sowie Dämme, Deiche, Hochwassersperren, die errichtet wurden, um den umliegenden Grund und Boden, der jedoch nicht Bestandteil dieser Bauten ist, zu verbessern. Zu den sonstigen Bauten gehören z. B. Straßen und Wege, Schienenstrecken und Rollbahnen, Brücken, Hochstraßen, Tunnel und U-Bahn-Bauten, Wasserstraßen, Häfen, Dämme und sonstige Wasserbauten, Fernrohrleitungen, Fernmelde- und Energieübertragungsleitungen, städtische Rohrleitungs- und Kabelnetze einschließlich zugehöriger Bauten, industrielle bauliche Anlagen sowie Sport- und Freizeitanlagen. |
|
Bodenverbesserungen (AN.1123) |
Der Wert von Maßnahmen, die zu bedeutenden Verbesserungen der Menge, der Qualität oder der Produktivität des Bodens führen oder dessen Verschlechterung verhindern. Dazu gehört z. B. die Werterhöhung, die sich aus der Bodenerschließung, Geländemodellierung sowie der Bohrung von Brunnen und Wasserlöchern ergibt. Eingeschlossen sind ferner die noch nicht abgeschriebenen Grundstücksübertragungskosten. |
|
Ausrüstungen (AN.113) |
Fahrzeuge, Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) sowie sonstige bewegliche Anlagegüter, wie im Folgenden definiert, sofern sie nicht von privaten Haushalten für den Konsum erworben werden. Relativ geringwertige Werkzeuge, die mehr oder weniger regelmäßig gekauft werden, wie etwa Handwerkzeuge, können unberücksichtigt bleiben. Nicht zu der Position gehören ferner Ausrüstungen, die Bestandteil von Gebäuden sind. Sie fallen unter die Positionen „Wohnbauten“ bzw. „Nichtwohngebäude“. Noch nicht fertig gestellte Ausrüstungsgüter fallen nur dann unter die Position, wenn sie für den Eigenbedarf produziert werden. Im Übrigen wird angenommen, dass die Ausrüstungen erst bei Lieferung in das Eigentum des Endbenutzers übergehen. Für militärische Zwecke erworbene Ausrüstungen (ohne militärische Waffensysteme) sind eingeschlossen. Von privaten Haushalten für den Konsum erworbene Ausrüstungen wie Fahrzeuge, Möbel, Kücheneinrichtungen, Computer, Telekommunikationsgeräte usw. werden nicht als Vermögensgüter behandelt. Sie sind vielmehr nachrichtlich in der Vermögensbilanz der privaten Haushalte als langlebige Konsumgüter auszuweisen. Hausboote, Binnenschiffe, Wohnmobile und Caravans, die von privaten Haushalten als Erstwohnsitz genutzt werden, gehören zu den Wohnbauten. |
|
Fahrzeuge (AN.1131) |
Sie dienen der Beförderung von Personen und Waren. Hierzu zählen z. B. die vom Fahrzeugbau hergestellten Erzeugnisse (ohne Ersatzteile), die in der Statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (CPA 2008) in der Abteilung 29 „Kraftwagen und Kraftwagenteile“ und in der Abteilung 30 „sonstige Fahrzeuge“ ausgewiesen werden. |
|
Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik (AN.1132) |
Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT): Geräte, die elektronisch gesteuert werden, und die in ihnen verwendeten elektronischen Komponenten. Hierzu zählen z. B. die Erzeugnisse der CPA-Gruppen 261 „elektronische Bauelemente und Leiterplatten“ und 262 „Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte“. |
|
Sonstige Ausrüstungen (AN.1139) |
Anderweitig nicht genannte Ausrüstungen. Hierzu zählen insbesondere die in folgenden CPA-Gruppen ausgewiesenen Erzeugnisse (jedoch ohne Ersatzteile und ohne Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsleistungen): Abteilung 26 „Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse“ (ohne die Gruppen 261 und 262), Abteilung 27 „elektrische Ausrüstungen“, Abteilung 28 „Maschinen“, Abteilung 31: „Möbel“ und Abteilung 32 „Waren, a. n. g.“. |
|
Militärische Waffensysteme (AN.114) |
Fahrzeuge und sonstige Ausrüstungen wie Kriegsschiffe, Unterseeboote, Militärflugzeuge, Panzer, Raketenträger und Abschussgeräte usw. Die meiste nicht wieder verwendbare Munition wird den militärischen Vorräten zugerechnet (siehe AN.124). Andere Munition hingegen, wie ballistische Flugkörper mit hohem Zerstörungspotenzial, die als dauernde Abschreckung gegen Angreifer eingestuft werden, werden als Anlagegüter verbucht. |
|
Nutztiere und Nutzpflanzungen (AN.115) |
Zucht- und Milchvieh, Zugtiere usw., Obst- und Rebanlagen sowie sonstige Baumbestände und Sträucher, die wiederholt Erzeugnisse liefern und die der direkten Kontrolle, Verantwortung und Verwaltung institutioneller Einheiten unterliegen, wie im Folgenden definiert. Heranwachsende Nutztiere und Nutzpflanzungen werden nur einbezogen, wenn sie für die eigene Nutzung bestimmt sind. |
|
Nutztiere (AN.1151) |
Tiere, deren natürliches Wachstum bzw. Nachwachsen unter der direkten Kontrolle, Verantwortung und Verwaltung institutioneller Einheiten erfolgt. Hierzu gehören Zuchttiere (einschließlich Fische und Geflügel), Milchvieh, Zugtiere, Schafe und andere zur Wollerzeugung genutzte Tiere sowie Tiere, die für Transport-, Unterhaltungs- oder Rennzwecke gehalten werden. |
|
Nutzpflanzungen, die wegen der Erzeugnisse angelegt werden, die sie Jahr für Jahr liefern (AN.1152) |
Baumbestände (einschließlich Reben und Sträucher), die wegen der Erzeugnisse angelegt werden, die sie Jahr für Jahr liefern; hierzu gehören diejenigen Baumbestände, die zur Gewinnung von Früchten oder Nüssen, Saft oder Harz oder von Rinden- oder Blatterzeugnissen kultiviert werden und deren natürliches Wachstum bzw. Nachwachsen unter der direkten Kontrolle, Verantwortung und Verwaltung institutioneller Einheiten erfolgt. |
|
Geistiges Eigentum (AN.117) |
Hierzu zählen Anlagegüter in Form von Ergebnissen von Forschung und Entwicklung, Suchbohrungen, Computerprogrammen/Software und Datenbanken, Urheberrechten und sonstigem geistigen Eigentum, die länger als ein Jahr genutzt werden und wie im Folgenden definiert sind. |
|
Forschung und Entwicklung (AN.1171) |
Die Position besteht aus dem Wert der Ausgaben für systematische schöpferische Arbeit zur Erweiterung des Kenntnisstandes, einschließlich der Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die Gesellschaft, sowie deren Verwendung mit dem Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Der Wert richtet sich nach den erwarteten künftigen Erträgen. Wenn der Wert nicht hinreichend verlässlich geschätzt werden kann, wird er vereinbarungsgemäß als Summe der Kosten (einschließlich der für erfolglose Forschung und Entwicklung) erfasst. Forschung und Entwicklung, die dem Eigentümer keine Vorteile bringt, wird nicht als Vermögensgut, sondern als Vorleistungen ausgewiesen. |
|
Suchbohrungen (AN.1172) |
Summe der Ausgaben für die Erschließung von Vorkommen an Erdöl, Erdgas und anderen Bodenschätzen sowie der nachfolgenden Auswertung der Entdeckungen. Hierzu zählen auch die Ausgaben vor der Lizenzerteilung, Lizenzkosten und Kosten, die beim Erwerb und bei der Bewertung der Bohrrechte anfallen, die Kosten der eigentlichen Versuchsbohrungen, die Kosten von Luftbild- und anderen Vermessungen sowie Transportkosten und ähnliche Kosten, die entstehen, damit die Versuchsbohrungen möglich werden. |
|
Software (AN.11731) |
Computerprogramme, Programmbeschreibungen und Begleitmaterial zu System- und Anwendungssoftware. Hierzu zählen die ursprüngliche Entwicklung und nachfolgende Weiterentwicklung von Software sowie der Erwerb von Kopien, die als Vermögensgüter unter AN.11731 erfasst werden. |
|
Datenbanken (AN.11732) |
Dateien, die so organisiert sind, dass sie einen ressourceneffizienten Zugriff und eine entsprechende Nutzung der Daten gestatten. Bei ausschließlich für eigene Zwecke erstellten Datenbanken erfolgt die Bewertung anhand einer Kostenschätzung, die die Kosten für das Datenbankmanagementsystem und für den Erwerb der Daten nicht berücksichtigt. |
|
Urheberrechte (AN.1174) |
Originale von Filmen, Tonaufzeichnungen, Manuskripten, Bändern, Modellen usw., auf denen schauspielerische Darbietungen, Radio- und Fernsehprogramme, musikalische Darbietungen, Sportveranstaltungen, literarische oder künstlerische Produktionen usw. aufgezeichnet oder anderweitig festgehalten sind. Eingeschlossen sind selbsterstellte Urheberrechte. In einigen Fällen, etwa bei Filmen, gibt es u.U. mehrere Originale. |
|
Sonstiges geistiges Eigentum (AN.1179) |
Andere Kenntnisse und Spezialwissen, deren Nutzung auf die Eigentümer begrenzt ist oder die nur gegen Lizenz von Dritten genutzt werden können. |
|
Vorräte (AN.12) |
In dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse, Fertigerzeugnisse und Handelsware, wie im Folgenden definiert. Eingeschlossen sind sämtliche Vorräte des Staates, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Vorräte an strategisch wichtigen Gütern, an Getreide und an Rohstoffen, die für die Nation von besonderer Bedeutung sind. |
|
Vorleistungsgüter (AN.121) |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht wiederverkauft, sondern von ihren Eigentümern als Vorleistungen in deren Produktionsprozess verbraucht werden sollen. |
|
Unfertige Erzeugnisse (AN.122) |
Noch nicht fertiggestellte Waren, angefangene Arbeiten und lebende Tier- und Pflanzenvorräte, die üblicherweise nicht in diesem Zustand an Dritte geliefert werden, sondern später von den Produzenten weiter bearbeitet bzw. aufgezogen werden. Nicht dazu zählen angefangene Bauten, die einen Käufer gefunden haben bzw. die für die Eigennutzung errichtet werden. Unterschieden werden lebende Tier- und Pflanzenvorräte sowie sonstige unfertige Erzeugnisse, wie im Folgenden definiert. |
|
Lebende Tier- und Pflanzenvorräte (AN.1221) |
Schlachtviehbestände einschließlich Geflügel- und Fischbestände sowie Baumbestände zur Holzgewinnung und andere Pflanzungen, die lediglich einmalige Erzeugnisse liefern, sowie heranwachsende Nutztiere und Nutzpflanzungen, soweit sie nicht für die eigene Nutzung bestimmt sind. |
|
Sonstige unfertige Erzeugnisse (AN.1222) |
Unfertige Waren und angefangene Arbeiten, die normalerweise nicht in diesem Zustand an Dritte geliefert werden, sondern erst nach Weiterbearbeitung durch den Produzenten. |
|
Fertigerzeugnisse (AN.123) |
Produzierte Waren, die zum Verkauf oder zum Versand durch den Produzenten bereitstehen. |
|
Militärische Vorräte (AN.124) |
Munition, Granaten, Raketen, Bomben und sonstige zum einmaligen Gebrauch bestimmte Militärgüter, die zur Bestückung von Waffen oder Waffensystemen dienen, ohne bestimmte Arten von Flugkörpern, die ein hohes Zerstörungspotenzial besitzen (siehe AN.114). |
|
Handelsware (AN.125) |
Waren, die von Unternehmen, insbesondere Groß- und Einzelhändlern, zum Zweck des Wiederverkaufs ohne weitere Verarbeitung (abgesehen von einer für den Kunden attraktiven Präsentation) erworben werden. |
|
Wertsachen (AN.13) |
Produzierte Gegenstände, die nicht primär als Produktionsmittel oder für den Verbrauch erworben werden, sondern als Wertaufbewahrungsmittel dienen. Von ihnen wird erwartet, dass ihr realer Wert steigt bzw. zumindest nicht fällt und dass sie sich im Laufe der Zeit normalerweise nicht verschlechtern. Hierzu zählen Edelmetalle und Edelsteine, Antiquitäten und Kunstgegenstände sowie sonstige Wertsachen, wie im Folgenden definiert. |
|
Edelmetalle und Edelsteine (AN.131) |
Edelmetalle und Edelsteine, jedoch ohne diejenigen, die von Unternehmen zum Zweck der Verwendung als Vorleistungen im Produktionsprozess auf Lager gehalten werden. |
|
Antiquitäten und Kunstgegenstände (AN.132) |
Gemälde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind, und Antiquitäten. |
|
Sonstige Wertsachen (AN.133) |
Anderweitig nicht genannte Wertgegenstände, wie etwa Sammlungen und aus Edelsteinen oder Edelmetallen gefertigter Schmuck von bedeutendem Wert. |
|
Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2) |
Nichtfinanzielle Aktiva, die nicht im Rahmen eines Produktionsprozesses entstanden sind. Nichtproduzierte Vermögensgüter bestehen aus natürlichen Ressourcen, Nutzungsrechten sowie Firmenwert und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten, wie im Folgenden definiert. |
|
Natürliche Ressourcen (AN.21) |
Nichtproduzierte Aktiva, die in der Natur vorkommen und an denen Eigentumsrechte bestehen und übertragen werden können. Nicht dazu zählen Bestandteile des Naturvermögens, an denen keine Eigentumsrechte bestehen oder bestehen können, wie die offenen Meere oder die Luft. Die Position untergliedert sich in Grund und Boden, Bodenschätze, freie Tier- und Pflanzenbestände, Wasserreserven und sonstige natürliche Ressourcen, wie im Folgenden definiert. |
|
Grund und Boden (AN.211) |
Im Eigentum befindliche bebaute und unbebaute Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer. Nicht dazu gehören auf dem Boden befindliche Gebäude und andere Bauwerke, Anbaukulturen, Baum- und Viehbestände, Bodenschätze, freie Tier- und Pflanzenbestände sowie unterirdische Wasservorkommen. |
|
Bodenschätze (AN.212) |
Nachgewiesene ober- und unterirdische Mineralvorkommen, die beim gegenwärtigen Stand der Technik und der relativen Preise wirtschaftlich abbaubar sind. Eigentumsrechte an Bodenschätzen können in der Regel von den Eigentumsrechten an dem betreffenden Grund und Boden unterschieden werden. Die Position untergliedert sich in bekannte Lagerstätten von Kohle, Erdöl und Erdgas oder anderen Brennstoffen, Erzlager und nichtmetallische Mineralvorkommen. |
|
Freie Tier- und Pflanzenbestände (AN.213) |
Bestände an Tieren, Bäumen, und sonstigen Pflanzen, die einmalig oder wiederholt Erzeugnisse liefern und an denen Eigentumsrechte bestehen, deren natürliches Wachstum bzw. Nachwachsen jedoch nicht unter der direkten Kontrolle, Verantwortung und Verwaltung institutioneller Einheiten erfolgt. Hierzu gehören z. B. Urwälder und Fischvorkommen im Hoheitsgebiet des Landes. Unter die Position fallen lediglich diejenigen Ressourcen, die gegenwärtig wirtschaftlich nutzbar sind oder dies in Kürze sein dürften. |
|
Wasserreserven (AN.214) |
Förderbare wasserführende Schichten und sonstige Grundwasservorkommen, wenn aufgrund ihrer Knappheit Eigentumsrechte bestehen und/oder ihre Nutzung etwas kostet, Erträge erzielt werden können und so eine gewisse wirtschaftliche Kontrolle vorliegt. |
|
Sonstige natürliche Ressourcen (AN.215) |
Diese Position umfasst das elektromagnetische Funkspektrum (AN.2151) und die übrigen, anderweitig nicht genannten natürlichen Ressourcen (AN.2159). |
|
Funkspektren (AN.2151) |
Das elektromagnetische Spektrum. Die Rechte zur Nutzung des Spektrums sind anderweitig klassifiziert (AN.222), sofern sie der Definition eines Vermögensguts entsprechen. |
|
Übrige (AN.2159) |
Übrige, anderweitig nicht genannte natürliche Ressourcen. |
|
Nutzungsrechte (AN.22) |
Vertragliche Vereinbarungen zur Durchführung von Tätigkeiten, durch die dem Inhaber über die zu zahlenden Gebühren hinausgehende wirtschaftliche Vorteile zukommen, die er auch rechtlich und praktisch nutzen kann. Das unter dieser Position erfasste Aktivum stellt den realisierbaren potenziellen Wert des Umbewertungsgewinns dar, der erzielt wird, wenn der Marktpreis für die Nutzung eines Vermögensguts oder die Erbringung einer Dienstleistung den im Nutzungsrecht vorgegebenen Preis oder den Preis, der ohne vertraglich geregelte Nutzungsrechte erzielt worden wäre, übersteigt. Die Position umfasst Aktiva, die sich aus Nutzungsrechten an produzierten Vermögensgütern, Nutzungsrechten an natürlichen Ressourcen, Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten und Exklusivrechten auf künftige Waren und Dienstleistungen ergeben. |
|
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern (AN.221) |
Eigentumsrechte Dritter, die sich auf Vermögensgüter (ohne natürliche Ressourcen) beziehen, wobei durch das Nutzungsrecht dem Inhaber über die zu zahlenden Gebühren hinausgehende wirtschaftliche Vorteile zukommen, die er durch Übertragung auch rechtlich und praktisch nutzen kann. Das unter der Position (AN.221) erfasste Aktivum ist der Wert, der sich für den Inhaber aus der Übertragung der Rechte zur Nutzung des zugrunde liegenden Vermögensguts ergibt, d. h. der Betrag, um den der realisierbare Übertragungspreis den an den Lizenzgeber zu zahlenden Betrag übersteigt. Beispielsweise zahlt der Mieter eines Gebäudes eine feste Miete, der Marktwert des Mietverhältnisses liegt aber über diesem Betrag. Kann der Mieter den Preisunterschied durch Untervermietung realisieren, stellt das Recht zur Realisierung dieses Werts ein Nutzungsrecht an einem produzierten Vermögensgut dar. |
|
Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen (AN.222) |
Zeitlich begrenzte Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen, durch die der wirtschaftliche Wert des Vermögensguts nicht vollständig aufgebraucht wird und wobei durch das Nutzungsrecht dem Inhaber über die zu zahlenden Gebühren hinausgehende wirtschaftliche Vorteile zukommen, die er z. B. durch Übertragung auch rechtlich und praktisch nutzen kann. Die natürliche Ressource wird weiterhin in der Vermögensbilanz des Eigentümers erfasst; getrennt davon stellt ein weiteres Aktivum den Wert dar, den die Übertragung der Rechte zur Ressourcennutzung für den Inhaber hat, und wird als Nutzungsrecht an natürlichen Ressourcen ausgewiesen. Das ausgewiesene Aktivum ist der Wert, der sich für den Inhaber aus der Übertragung der Nutzungsrechte ergibt, d.h. der Betrag, um den der realisierbare Übertragungspreis den an den Lizenzgeber zu zahlenden Betrag übersteigt. Beispielsweise zahlt der Mieter eines Grundstücks eine feste Miete, der Marktwert des Mietverhältnisses liegt aber über diesem Betrag. Kann der Mieter den Preisunterschied durch Untervermietung realisieren, stellt das Recht zur Realisierung dieses Werts ein Vermögensgut dar. |
|
Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten (AN.223) |
Übertragbare Genehmigungen, ohne Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen oder Nutzungsrechte an einem Vermögensgut, das dem Lizenzgeber gehört und bei dem die Zahl der Einheiten, die eine bestimmte Tätigkeit durchführen, beschränkt ist, sodass die Inhaber monopolähnliche Gewinne erzielen können. Das ausgewiesene Aktivum ist der Wert, der sich für den Inhaber aus der Übertragung der Nutzungsrechte ergibt, d.h. der Betrag, um den der realisierbare Übertragungspreis den an den Lizenzgeber zu zahlenden Betrag übersteigt. Der Lizenznehmer muss rechtlich und praktisch in der Lage sein, die Lizenzrechte einem Dritten zu übertragen. |
|
Exklusivrechte auf künftige Waren und Dienstleistungen (AN.224) |
Übertragbare vertragliche Rechte auf die exklusive Nutzung von Waren oder Dienstleistungen. Eine Partei verfügt über einen Vertrag zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen zu einem Festpreis von einer zweiten Partei und ist rechtlich und praktisch in der Lage, die Verpflichtung der zweiten Partei an eine dritte zu übertragen. Dazu zählen der übertragbare Wert eines Fußballspielers, der bei einem Fußballclub unter Vertrag steht, und der übertragbare Wert von Exklusivrechten zur Veröffentlichung literarischer Werke oder musikalischer Darbietungen. Das unter dieser Position erfasste Aktivum ist der Wert, den die Übertragung des Rechts für den Inhaber hat. |
|
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte (AN.23) |
Differenz zwischen dem für eine institutionelle Einheit als Ganzes effektiv gezahlten Betrag und der Summe der Aktiva abzüglich der Summe der Passiva der institutionellen Einheit, die durch getrennte Bewertung jedes Aktiv- und Passivposten ermittelt wurde. Der Firmenwert ergibt sich daher aus sämtlichen Elementen, die langfristig von Vorteil sind und nicht als eigene Aktiva ausgewiesen wurden, sowie aus der Tatsache, dass die Aktiva als Ganzes eingesetzt werden und es sich bei ihnen nicht einfach nur um eine Ansammlung von einzelnen Aktiva handelt. Darüber hinaus erfasst diese Position einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte wie Markennamen, Drucktitel, Warenzeichen, Logos und Domänennamen, sofern sie einzeln und getrennt von einem Unternehmen als Ganzes verkauft werden. |
|
Forderungen und Verbindlichkeiten (AF) |
Finanzielle Vermögenswerte bestehen aus Forderungen, aus Anteilsrechten und dem Teil des Währungsgoldes, der aus Barrengold besteht. Diese Forderungen sind Wertaufbewahrungsmittel und stehen für Erträge, die der wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die Vermögenswerte eine Zeitlang hält. Sie dienen dazu, Werte von einem Rechnungszeitraum auf den nächsten zu übertragen. Der Austausch von Erträgen oder Reihen von Erträgen erfolgt durch Zahlungen. Zahlungsmittel sind Währungsgold, Sonderziehungsrechte, Bargeld und übertragbare Einlagen bei Banken. Forderungen, auch Finanzinstrumente genannt, sind finanzielle Vermögenswerte, denen Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Verbindlichkeiten entstehen, wenn Schuldner verpflichtet sind, Zahlungen oder Reihen von Zahlungen an Gläubiger zu leisten. |
|
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (AF.1) |
Den Forderungen unter dieser Position stehen im ESVG — mit Ausnahme des aus Barrengold bestehenden Teils des Währungsgoldes — Verbindlichkeiten gegenüber. |
|
Währungsgold (AF.11) |
Gold, auf das die Währungsbehörden oder andere, ihnen unterstellte Behörden Anspruch haben und das sie als Währungsreserven halten. Dazu gehört Barrengold (einschließlich Währungsgold, das auf Einzelverwahrungskonten gehalten wird) sowie bei Gebietsfremden gehaltene Goldsammelverwahrungskonten, die den Anspruch auf Herausgabe von Gold begründen. |
|
Sonderziehungsrechte (AF.12) |
Ein vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschaffenes internationales Reservemedium, das den Mitgliedern des IWF zur Ergänzung der bestehenden Währungsreserven zugeteilt wird. |
|
Bargeld und Einlagen (AF.2) |
Das im Umlauf befindliche Bargeld sowie Einlagen bei Banken, in Landeswährung und in Fremdwährung. |
|
Bargeld (AF.21) |
Bargeld sind Banknoten und Münzen, die eine Währungsbehörde ausgibt oder genehmigt. |
|
Sichteinlagen (AF.22) |
Einlagen, die auf Verlangen zum Nennwert in Bargeld umgetauscht und unmittelbar und ohne Einschränkung oder Einbuße zur Leistung von Zahlungen mit Scheck, Wechsel, Überweisung, Lastschrift oder anderen Direktzahlungsmitteln genutzt werden können. |
|
Interbankpositionen (AF.221) |
Übertragbare Einlagen bei Banken. |
|
Sonstige Sichteinlagen (AF.229) |
Sichteinlagen ohne Interbankpositionen. |
|
Sonstige Einlagen (AF.29) |
Sonstige Einlagen sind alle Einlagen außer den Sichteinlagen. Sonstige Einlagen können weder als Zahlungsmittel verwendet (außer bei Fälligkeit oder Ablauf einer vereinbarten Kündigungsfrist) noch ohne erhebliche Einschränkung oder Einbuße in Bargeld oder Sichteinlagen umgewandelt werden. |
|
Schuldverschreibungen (AF.3) |
Begebbare, also umlauffähige Finanzinstrumente, die als Schuldtitel dienen. Die Umlauffähigkeit bezieht sich auf das Eigentum, das durch Übergabe oder Indossierung problemlos von einem auf den anderen Eigentümer übertragen werden kann. Um als umlauffähig zu gelten, muss eine Schuldverschreibung für einen möglichen Handel an einer organisierten Börse oder im Freiverkehr ausgestaltet sein; der Nachweis eines tatsächlichen Handels ist allerdings nicht erforderlich. |
|
Kurzfristige Schuldverschreibungen (AF.31) |
Schuldverschreibungen mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr und jederzeit auf Verlangen des Gläubigers rückzahlbare Schuldverschreibungen. |
|
Langfristige Schuldverschreibungen (AF.32) |
Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit ein Jahr überschreitet oder die keinen Fälligkeitstermin aufweisen. |
|
Kredite (AF.4) |
Forderungen, die entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner entweder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers ausleihen, und die entweder in einem nicht begebbaren Titel oder gar nicht verbrieft sind. |
|
Kurzfristige Kredite (AF.41) |
Kredite mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr und jederzeit auf Verlangen des Gläubigers rückzahlbare Kredite. |
|
Langfristige Kredite (AF.42) |
Kredite, deren Ursprungslaufzeit ein Jahr überschreitet oder die keinen Fälligkeitstermin aufweisen. |
|
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5) |
Forderungen, in denen Eigentumsrechte an Kapitalgesellschaften oder Quasi-Kapitalgesellschaften verbrieft sind. Mit solchen finanziellen Aktiva ist in der Regel ein Anspruch auf einen Anteil am Gewinn dieser Kapital- oder Quasi-Kapitalgesellschaften und auf einen Anteil an ihrem Nettovermögen im Fall der Liquidation verbunden. |
|
Eigenkapital (AF.51) |
Mit diesen finanziellen Aktiva werden Forderungen bezüglich des Restwerts einer Kapitalgesellschaft oder Quasi-Kapitalgesellschaft anerkannt, nachdem die Forderungen aller Gläubiger befriedigt wurden. |
|
Börsennotierte Aktien (AF.511) |
An einer Börse notierte Anteilsrechte in Form von Aktien. Eine solche Börse kann eine anerkannte Börse oder jede andere Form eines Sekundärmarkts sein. Börsennotierte Aktien werden auch als quotierte Aktien bezeichnet. Aus der Tatsache, dass für an einer Börse notierte Aktien ein offizieller Kurs besteht, ergibt sich, dass jeweilige Marktpreise in der Regel ohne Schwierigkeiten verfügbar sind. |
|
Nicht börsennotierte Aktien (AF.512) |
Anteilspapiere mit Preisen, die nicht an einer anerkannten Börse oder an einem sonstigen Sekundärmarkt notiert sind. |
|
Sonstige Anteilsrechte (AF.519) |
Alle Anteilsrechte ohne die in AF.511 und AF.512 genannten Wertpapiere. |
|
Anteile an Investmentfonds (AF.52) |
Investmentfondsanteile sind Anteile an Kapitalgesellschaften oder Trusts. Diese Anteile werden von Investmentfonds ausgegeben, die Organismen für gemeinsame Anlagen darstellen. In diesen legen Investoren Mittel für Investitionen in finanzielle bzw. nichtfinanzielle Vermögensgüter zusammen. |
|
Anteile an Geldmarktfonds (AF.521) |
Geldmarktfondsanteile werden von Geldmarktfonds ausgegeben. Bei diesen handelt es sich um Investmentfonds, die ausschließlich oder in erster Linie in kurzfristige Schuldverschreibungen wie Schatzwechsel, Einlagenzertifikate und Commercial Paper sowie in langfristige Schuldverschreibungen mit einer geringen Restlaufzeit investieren. Geldmarktfondsanteile können übertragbar sein und werden häufig als Substitute für Einlagen betrachtet. |
|
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (AF.522) |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds stellen einen Anspruch auf einen Teil des Werts eines Investmentfonds (der kein Geldmarktfonds ist) dar. Diese Anteile werden von Investmentfonds ausgegeben, die in eine Reihe von Vermögenswerten investieren, darunter Schuldverschreibungen, Anteilsrechte, rohstoffgebundene Investitionen, Immobilien, Anteile an anderen Investmentfonds und strukturierte Vermögenswerte. |
|
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6) |
Forderungen von Versicherungsnehmern oder Leistungsempfängern und Verbindlichkeiten von Versicherern, Altersvorsorgeeinrichtungen oder Emittenten standardisierter Garantien. |
|
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen (AF.61) |
Forderungen, die die Ansprüche von Versicherungsnehmern gegenüber Nichtlebensversicherungen in Form von Beitragsüberträgen und Aufwendungen für eingetretene Versicherungsfälle darstellen. |
|
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen (AF.62) |
Forderungen, die die Ansprüche von Versicherungsnehmern gegenüber den technischen Rückstellungen von Lebensversicherungsgesellschaften darstellen. |
|
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen (AF.63) |
Forderungen, die aktuelle und künftige Rentner entweder gegenüber dem Träger ihres Alterssicherungssystems, d.h. ihrem Arbeitgeber, gegenüber einem vom Arbeitgeber oder von Arbeitgebern benannten System zur Zahlung von Renten im Rahmen einer Vergütungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder gegenüber einem Lebens- (oder Nichtlebens-)versicherer besitzen. |
|
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Verwalter von Pensionseinrichtungen (AF.64) |
Forderungen, die die Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an deren Träger bei etwaigen Defiziten darstellen, und Forderungen, die sich auf gegen die Pensionseinrichtungen gerichtete Ansprüche des Trägers auf Überschüsse beziehen; dies gilt beispielsweise, wenn die Kapitalerträge höher sind als die Erhöhung der Ansprüche und die Differenz dem Verwalter der Pensionseinrichtungen auszuzahlen ist. |
|
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen (AF.65) |
Der Überschuss der Nettobeiträge über die Leistungen in Form einer Erhöhung der Verbindlichkeit des Versicherungssystems gegenüber den Leistungsempfängern. |
|
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien (AF.66) |
Forderungen, die Garantienehmer im Rahmen standardisierter Garantien gegenüber den diese Garantien bietenden Kapitalgesellschaften haben. |
|
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7) |
Forderungen, die an einen finanziellen oder nichtfinanziellen Vermögenswert oder einen Index gebunden sind; durch diese Forderungen können bestimmte finanzielle Risiken als solche an den Finanzmärkten gehandelt werden. |
|
Finanzderivate (AF.71) |
Forderungen wie Optionen, Terminkontrakte und Kreditderivate. Optionen (AF.711) (sowohl handelbare Optionen als auch Freiverkehrsoptionen (OTC-Optionen)) sind Eventualforderungen, durch die der Käufer der Option das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung erwirbt, innerhalb einer bestimmten Frist (amerikanische Option) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (europäische Option) finanzielle oder nichtfinanzielle Aktiva (das Basisinstrument) zu einem festgelegten Preis (dem Basis- oder Ausübungspreis) vom Optionsverkäufer zu kaufen (Call = Kaufoption) oder an diesen zu verkaufen (Put = Verkaufsoption). Ausgehend von diesen grundlegenden Strategien wurden zahlreiche kombinierte Strategien entwickelt, z. B. Bear-Call/Put-Spreads, Bull-Call/Put-Spreads oder Butterfly-Options-Spreads. Aus diesen Optionsarten wurden exotische Optionen mit komplexen Zahlungsstrukturen abgeleitet. Terminkontrakte sind unbedingte Finanzverträge, bei denen zwei Parteien übereinkommen, eine bestimmte Menge eines zugrunde liegenden (finanziellen oder nichtfinanziellen) Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis (dem Ausübungspreis) auszutauschen. Kreditderivate — in der Form von Terminkontrakten und Optionsverträgen — dienen in erster Linie dazu, Kreditrisiken handelbar zu machen. Sie sind so konzipiert, dass das Ausfallrisiko bei Krediten und Wertpapieren gehandelt werden kann. Wie andere Finanzderivate basieren Kreditderivate häufig auf Standard-Rahmenverträgen und beinhalten Einschuss- und andere Sicherheitsleistungen, wodurch eine Bewertung zu Marktpreisen möglich ist. Die Übertragung von Kreditrisiken findet — auf Basis einer Prämie — zwischen dem Risikoverkäufer (Sicherungsnehmer) und dem Risikokäufer (Sicherungsgeber) statt. Wenn ein Kredit ausfällt, zahlt der Risikokäufer den Risikoverkäufer bar aus. |
|
Mitarbeiteraktienoptionen (AF.72) |
Forderungen in der Form von Vereinbarungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (dem Gewährungszeitpunkt) geschlossen werden. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann ein Arbeitnehmer eine bestimmte Anzahl von Aktien des Arbeitgebers zu einem festgelegten Preis (dem Ausübungspreis) entweder zu einem festgelegten Zeitpunkt (dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit) oder binnen eines bestimmten Zeitraums (des Ausübungszeitraums) unmittelbar nach dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit erwerben. |
|
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8) |
Forderungen, die durch eine finanzielle oder nichtfinanzielle Transaktion entstehen, bei der ein zeitlicher Abstand zwischen der betreffenden Transaktion und der entsprechenden Zahlung besteht. |
|
Handelskredite und Anzahlungen (AF.81) |
Forderungen, die durch die direkte Kreditgewährung durch Lieferanten an die Käufer von Waren oder Dienstleistungen und durch Anzahlungen für angefangene oder geplante Arbeiten bzw. für Waren- und Dienstleistungslieferungen entstehen. |
|
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) (AF.89) |
Forderungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen oder finanziellen Transaktionen am Sekundärmarkt und den entsprechenden Zahlungen entstehen. |
|
Nachrichtlicher Ausweis |
Im ESVG werden drei Positionen nachrichtlich ausgewiesen, die für bestimmte Untersuchungen von Interesse sind und im Kontensystem nicht als solche erscheinen. |
|
Langlebige Konsumgüter (AN.m) |
Dauerhafte Güter, die von privaten Haushalten für den Konsum erworben werden, die also weder als Wertsache dienen noch von Unternehmen im Sektor private Haushalte für Produktionszwecke eingesetzt werden. |
|
Ausländische Direktinvestitionen (AF.m1) |
Langfristige Geldanlagen, durch die gebietsansässige institutionelle Einheiten (die „Direktinvestoren“) langfristige Ansprüche (Anteilsrechte oder sonstige Forderungen) an gebietsfremde institutionelle Einheiten einer anderen Volkswirtschaft erwerben. Mit dieser Geldanlage (Direktinvestitionen) will der Anleger (Direktinvestor) einen maßgeblichen Einfluss auf die Leitung des Unternehmens, in das er investiert hat, erlangen. |
|
Notleidende Kredite (AF.m2) |
Ein Kredit gilt als notleidend, wenn Zins- oder Tilgungszahlungen seit mindestens 90 Tagen fällig sind, aufgrund einer Vereinbarung kapitalisiert, refinanziert oder verschoben wurden, oder Zahlungen seit weniger als 90 Tagen überfällig sind, jedoch andere gute Gründe (z. B. der Konkursantrag eines Schuldners) bezweifeln lassen, dass die Zahlungen vollständig geleistet werden. |
ANHANG 7.2
ÜBERBLICK ÜBER DIE BUCHUNGEN VON DER VERMÖGENSERÖFFNUNGSBILANZ BIS ZUR VERMÖGENSSCHLUSSBILANZ
Anhang 7.2 bietet einen Überblick über die Buchungen von der Vermögenseröffnungsbilanz bis zur Vermögensschlussbilanz, aus dem für jede Art von Aktiva im Einzelnen hervorgeht, wie sich der Bilanzausweis jeweils verändert: durch Transaktionen, sonstige reale Vermögensänderungen sowie Umbewertungsgewinne und -verluste.
|
Art der Bilanzpositionen |
IV.1 Bilanz am Jahresanfang |
III.1 and III.2 Transaktionen |
III.3.1 Sonstige reale Vermögensänderungen |
III.3.2 Umbewertungsgewinne/-verluste |
IV.3 Bilanz am Jahresende |
|
|
III.3.2.1 Neutrale Umbewertunggewinne/-verluste |
III.3.2.2 Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|||||
|
Vermögensgüter |
AN. |
P.5, NP |
K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62. |
K.71 |
K.72 |
AN. |
|
Produzierte Vermögensgüter |
AN.1 |
P.5 |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.1 |
|
Anlagegüter (3) |
AN.11 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.11 |
|
Wohnbauten |
AN.111 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.111 |
|
Nichtwohnbauten |
AN.112 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.112 |
|
Ausrüstungen |
AN.113 |
P.51g, P.51c |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.113 |
|
Militärische Waffensysteme |
AN.114 |
P.51g, P.51c |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.114 |
|
Nutztiere und Nutzpflanzungen |
AN.115 |
P.51g, P.51c |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.115 |
|
Geistiges Eigentum |
AN.117 |
P.51g, P.51c |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.117 |
|
Vorräte nach Art des Vorrats |
AN.12 |
P.52 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.12 |
|
Wertsachen |
AN.13 |
P.53 |
K.1, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.13 |
|
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
AN.2 |
NP |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.2 |
|
Natürliche Ressourcen |
AN.21 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.21 |
|
Grund und Boden |
AN.211 |
NP.1 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.211 |
|
Bodenschätze |
AN.212 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.212 |
|
Freie Tier- und Pflanzenbestände |
AN.213 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.213 |
|
Wasserreserven |
AN.214 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.214 |
|
Sonstige natürliche Ressourcen |
AN.215 |
NP.1 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.215 |
|
Funkspektren |
AN.2151 |
NP.1 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.2151 |
|
Übrige |
AN.2159 |
NP.1 |
K.1, K.21, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.2159 |
|
Nutzungsrechte |
AN.22 |
NP.2 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.22 |
|
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
AN.23 |
NP.3 |
K.1, K.22, K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AN.23 |
|
Forderungen und Verbindlichkeiten (4) |
AF |
F |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF. |
|
Währungsgold und Sonderziehungsrechte |
AF.1 |
F.1 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.1 |
|
Bargeld und Einlagen |
AF.2 |
F.2 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.2 |
|
Schuldverschreibungen |
AF.3 |
F.3 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.3 |
|
Kredite |
AF.4 |
F.4 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.4 |
|
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
AF.5 |
F.5 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.5 |
|
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantiesysteme |
AF.6 |
F.6 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.6 |
|
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
AF.7 |
F.7 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.7 |
|
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten |
AF.8 |
F.8 |
K.3, K.4, K.5, K.61, K.62 |
K.71 |
K.72 |
AF.8 |
|
Reinvermögen |
B.90 |
B.101 |
B.102 |
B.1031 |
B.1032 |
B.90 |
|
Kontensalden |
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
B.90 |
Reinvermögen |
|
Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten |
|
|
F. |
Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten |
|
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
|
F.4 |
Kredite |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
Gütertransaktionen |
|
|
P.5 |
Bruttoinvestitionen |
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
|
P.51c |
Abschreibungen (–) |
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
|
Sonstige Vermögensänderungen |
|
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
(1) Nachrichtlicher Ausweis: AN.m: Langlebige Konsumgüter.
(2) Nachrichtliche Ausweise: AF.m1: Ausländische Direktinvestitionen; AF.m2: Notleidende Kredite.
(3) Nachrichtlicher Ausweis: AN.m: Langlebige Konsumgüter.
(4) Nachrichtliche Ausweise: AF.m1: Ausländische Direktinvestitionen; AF.m2: Notleidende Kredite.
KAPITEL 8
DIE KONTENABFOLGE
EINLEITUNG
|
8.01 |
In diesem Kapitel werden die Konten und Bilanzen der Kontenabfolge der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Einzelnen dargelegt. Außerdem werden in derselben Abfolge die Wechselwirkungen zwischen der heimischen Wirtschaft und der übrigen Welt aufgezeigt. Darüber hinaus wird das Güterkonto beschrieben, das die dem Aufkommen und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen zugrunde liegende Bilanzgleichung widerspiegelt. Schließlich wird in diesem Kapitel das zusammengefasste Kontensystem dargestellt, in dem jeder Sektor mit aggregierten Buchungseinträgen erscheint. |
Die Kontenabfolge
|
8.02 |
Das ESVG erfasst Strom- und Bestandsgrößen in einem geordneten Kontensystem, durch das der Wirtschaftskreislauf von der Produktion und der Entstehung von Einkommen über dessen Verteilung und Umverteilung bis hin zum Konsum dargestellt wird. Schließlich erfasst das ESVG die Verwendung dessen, was übrig bleibt, als Ersparnis; damit wird die Ansammlung nichtfinanzieller und finanzieller Vermögensgüter berücksichtigt. |
|
8.03 |
In jedem Konto sind das Aufkommen und die Verwendung aufgeführt, die durch einen Saldo ausgeglichen werden, der in der Regel auf der Verwendungsseite des Kontos vermerkt ist. Der Saldo wird auf das nächste Konto übertragen und erscheint dort als erster Eintrag auf der Aufkommensseite. Auf der Grundlage einer logischen Analyse des Wirtschaftsgeschehens werden die Transaktionen so gruppiert und dargestellt, dass aussagekräftige volkswirtschaftliche Gesamtgrößen entstehen, die zur Untersuchung eines institutionellen Sektors oder Teilsektors oder der gesamten Volkswirtschaft erforderlich sind. Die Konten sind so untergliedert, dass sie die bedeutsamsten wirtschaftlichen Informationen liefern; dabei spielt jeweils der Kontensaldo eine Schlüsselrolle. |
|
8.04 |
Es werden drei Gruppen von Konten unterschieden:
|
|
8.05 |
Die Kontenabfolge gilt für die institutionellen Einheiten, die institutionellen Sektoren und Teilsektoren sowie die gesamte Volkswirtschaft. |
|
8.06 |
Die Kontensalden werden sowohl brutto als auch netto ausgewiesen. Brutto bedeutet vor und netto nach Abzug der Abschreibungen. Einkommensbegriffe sind netto aussagekräftiger, da Abschreibungen als ein Abruf verfügbaren Einkommens zu betrachten sind, dem nachzukommen ist, wenn das Anlagevermögen der Volkswirtschaft bewahrt werden soll. |
|
8.07 |
Die Konten werden auf zweierlei Weise dargestellt:
|
|
8.08 |
Tabelle 8.1 bietet einen Überblick über die Konten, Kontensalden und die Hauptaggregate: Die Codierung der Hauptaggregate geht aus der Tabelle nicht hervor, lautet aber wie die Codierung der Salden, der noch ein Sternchen hinzugefügt wird. So ist das Primäreinkommen mit dem Code B.5g versehen; die entsprechende Codierung des Hauptaggregats Bruttonationaleinkommen lautet B.5*g. |
|
8.09 |
Die Salden werden in der Tabelle brutto ausgewiesen, wie aus der Verwendung des Buchstabens „g“ („gross“) in der Codierung hervorgeht. Zu jedem dieser Codes gibt es eine Nettoangabe, bei der die Abschreibungen abgezogen wurden. Die Bruttowertschöpfung wird beispielsweise mit B.1g codiert, der entsprechende Wert für die Nettowertschöpfung, bei der die Abschreibungen abgezogen wurden, mit B.1n. Tabelle 8.1 — Überblick über die Konten, Kontensalden und die Hauptaggregate
Tabelle 8.1 — Überblick über die Konten, Kontensalden und die Hauptaggregate (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KONTENABFOLGE
Transaktionskonten
Produktionskonto (I)
|
8.10 |
Das Produktionskonto (I) enthält die Transaktionen, die den Produktionsprozess abbilden. Es wird für die institutionellen Sektoren und für die Wirtschaftsbereiche erstellt. Es enthält auf der Aufkommensseite den Produktionswert und auf der Verwendungsseite die Vorleistungen. |
|
8.11 |
Das Produktionskonto erschließt einen der wichtigsten Salden des Systems — die Wertschöpfung, d.h., den Wert, der von sämtlichen Einheiten, die eine Produktionstätigkeit ausüben, geschaffen wird — ebenso wie eine bedeutende volkswirtschaftliche Gesamtgröße: das Bruttoinlandsprodukt. Die Wertschöpfung ist ökonomisches Kennzeichen sowohl für die institutionellen Sektoren als auch für die Wirtschaftsbereiche. |
|
8.12 |
Die Wertschöpfung (der Saldo des Produktionskontos) kann vor oder nach Abzug der Abschreibungen, d.h. brutto oder netto, ausgewiesen werden. Da der Produktionswert zu Herstellungspreisen und die Vorleistungen zu Anschaffungspreisen bewertet werden, enthält die Wertschöpfung nicht die Gütersteuern abzüglich der Gütersubventionen. |
|
8.13 |
Im Produktionskonto für die gesamte Volkswirtschaft werden auf der Aufkommenseite außer dem Produktionswert von Waren und Dienstleistungen auch die Gütersteuern abzüglich der Gütersubventionen gebucht. Damit wird als Saldo dieses Kontos das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nachgewiesen. Der Code für diesen wichtigen Gesamtsaldo, die mithilfe der Anpassungen zu Marktpreisen ermittelte Wertschöpfung der Volkswirtschaft, lautet B.1*g und stellt das BIP zu Marktpreisen dar. Das Nettoinlandsprodukt wird mit B.1*n codiert. |
|
8.14 |
Die unterstellten Bankdienstleistungen (FISIM) werden den Nutzern als Kosten zugerechnet. Daraus ergibt sich, dass ein Teil der Zinszahlungen an Finanzinstitute als Entgelt für Dienstleistungen umgebucht und den Finanzmittlern als Produktion zugeordnet werden muss. Ein entsprechender Wert wird als Konsum der Nutzer ermittelt. Der BIP-Wert wird von dem FISIM-Betrag beeinflusst, der dem Konsum, den Exporten und den Importen zugeordnet wird. Tabelle 8.2 — Konto I: Produktionskonto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verteilungs- und Verwendungskonten (II)
|
8.15 |
Es werden vier Phasen der Einkommensverteilung und -verwendung unterschieden: die primäre Einkommensverteilung, die sekundäre Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept), die sekundäre Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) und die Einkommensverwendung. Phase eins betrifft die Entstehung des unmittelbar aus dem Produktionsprozess resultierenden Einkommens und seine Verteilung auf die Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital) und den Staat (über Produktions- und Importabgaben und Subventionen). Sie ermöglicht die Ermittlung des Betriebsüberschusses (bzw. des Selbständigeneinkommens im Fall der privaten Haushalte) und des Primäreinkommens. In Phase zwei wird die Einkommensumverteilung durch Transfers (außer soziale Sachleistungen und Vermögenstransfers) untersucht. Daraus ergibt sich als Saldo das verfügbare Einkommen. In Phase drei werden die vom Staat und von den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck der Gesellschaft erbrachten individuell zurechenbaren Dienstleistungen als Teil des Konsums der privaten Haushalte behandelt und diesen Letzteren als entsprechendes Einkommen unterstellt. Dies wird über zwei Konten mit angepassten Salden bewerkstelligt. Es wird ein Konto mit der Bezeichnung sekundäre Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) eingeführt, das beim Aufkommen für die privaten Haushalte das unterstellte zusätzliche Einkommen und entsprechend bei der Verwendung für den Staat und die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck die unterstellten Transfers aus diesen Sektoren ausweist. Daraus ergibt sich ein als „verfügbares Einkommen (Verbrauchskonzept)“ bezeichneter Saldo, der mit dem verfügbaren Einkommen auf Volkswirtschaftsebene identisch ist, aber für die Sektoren private Haushalte, Staat und private Organisationen ohne Erwerbszweck unterschiedlich ist. In Phase vier wird das verfügbare Einkommen auf das nächste Konto, das Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept), übertragen; aus diesem Konto geht hervor, wie das Einkommen verbraucht wird; der verbleibende Saldo ist das Sparen. Wenn individualisierbare Dienstleistungen als Konsum der privaten Haushalte im Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) verbucht werden, weist das Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) aus, wie das verfügbare Einkommen (Verbrauchskonzept) von den Haushalten für die vom Staat und von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck empfangenen sozialen Sachleistungen ausgegeben wird, indem der Wert dieser sozialen Sachleistungen zum Konsum der privaten Haushalte addiert wird; daraus ergibt sich der Konsum (Verbrauchskonzept). Der Konsum des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck wird entsprechend um den gleichen Betrag verringert, so dass bei der Ermittlung des Sparens für die Sektoren Staat, private Organisationen ohne Erwerbszweck und private Haushalte die Betrachtung nach dem Verbrauchskonzept für die einzelnen Sektoren denselben Saldo wie nach dem Standardverfahren ergibt. |
Konten der primären Einkommensverteilung (II.1)
Einkommensentstehungskonto (II.1.1)
Das Einkommensentstehungskonto nach institutionellen Sektoren wird in Tabelle 8.3 gezeigt.
|
8.16 |
Das Einkommensentstehungskonto wird auch nach Wirtschaftsbereichen dargestellt, nämlich in den Spalten der Aufkommens- und Verwendungstabellen. |
|
8.17 |
Im Einkommensentstehungskonto wird dargestellt, von welchen Sektoren die Primäreinkommenstransaktionen ausgehen, nicht welchen Sektoren sie zufließen. |
|
8.18 |
Aus dem Konto geht hervor, in welchem Maße die Wertschöpfung das Arbeitnehmerentgelt und die sonstigen Produktionsabgaben abzüglich sonstiger Subventionen deckt. Es weist als Saldo den Betriebsüberschuss aus, d. h. den Überschuss (oder das Defizit) aus den Produktionstätigkeiten vor Zinsen, Pachten und sonstigen Zahlungen, die die Produktionseinheit
|
|
8.19 |
Im Fall der dem Sektor private Haushalte angehörenden Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit enthält der Saldo des Einkommensentstehungskontos implizit einen Bestandteil, bei dem es sich um die Vergütung für die vom Eigentümer oder von Mitgliedern seiner Familie geleistete Arbeit handelt. Dieses Einkommen aus selbständiger Tätigkeit weist Merkmale von Löhnen und Gehältern, aber auch von Gewinnen aus Unternehmertätigkeit auf. Es handelt sich weder ausschließlich um Löhne noch ausschließlich um Gewinne und wird als Selbständigeneinkommen bezeichnet. |
|
8.20 |
Im Fall der Produktion von Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohnungsbesitz durch private Haushalte handelt es sich bei dem Saldo des Einkommensentstehungskontos um einen Betriebsüberschuss (nicht um Selbständigeneinkommen). Tabelle 8.3 — Konto II.1.1: Einkommensentstehungskonto
Tabelle 8.3 — Konto II.1.1: Einkommensentstehungskonto (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primäres Einkommensverteilungskonto (II.1.2)
|
8.21 |
Anders als im Einkommensentstehungskonto werden bei der Zuordnung des Primäreinkommens die gebietsansässigen Einheiten und institutionellen Sektoren in ihrer Eigenschaft als Empfangende von Primäreinkommen behandelt und nicht als Leistende, durch deren Tätigkeit Primäreinkommen entsteht. |
|
8.22 |
„Primäreinkommen“ ist das Einkommen, das gebietsansässige Einheiten aufgrund ihrer unmittelbaren Teilnahme am Produktionsprozess erhalten, sowie das Einkommen, das der Eigentümer eines Vermögenswertes oder einer natürlichen Ressource als Gegenleistung dafür erhält, dass er einer anderen institutionellen Einheit finanzielle Mittel oder die natürliche Ressource zur Verfügung stellt. |
|
8.23 |
Für den Sektor der privaten Haushalte ist das Arbeitnehmerentgelt (D.1) als Aufkommen im primären Einkommensverteilungskonto nicht dasselbe wie der D.1-Eintrag als Verwendung im Einkommensentstehungskonto. Im Einkommensentstehungskonto der privaten Haushalte zeigt der Verwendungseintrag, wie viel Lohn Beschäftigten im Gewerbe der privaten Haushalte gezahlt wird. Im primären Einkommensverteilungskonto der privaten Haushalte gibt der Eintrag auf der Aufkommensseite Auskunft über sämtliche Arbeitsentgelte der Haushalte, die diese als Beschäftigte in Unternehmen oder beim Staat usw. erzielen. Daher ist der Eintrag im Verteilungskonto für die privaten Haushalte erheblich größer als der im Einkommensentstehungskonto dieses Sektors. |
|
8.24 |
Das primäre Einkommensverteilungskonto (II.1.2) kann lediglich für die institutionellen Sektoren und Teilsektoren erstellt werden, da im Fall der Wirtschaftsbereiche bestimmte Stromgrößen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung (langfristige Kredite und Anleihen) und dem Vermögen stehen, nicht aufgegliedert werden können. |
|
8.25 |
Das primäre Einkommensverteilungskonto ist weiter untergliedert in das Unternehmensgewinnkonto (II.1.2.1) und in das Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen (II.1.2.2). Tabelle 8.4 — Konto II.1.2: Primäres Einkommensverteilungskonto
Tabelle 8.4 — Konto II.1.2: Primäres Einkommensverteilungskonto (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unternehmensgewinnkonto (II.1.2.1)
|
8.26 |
Das Unternehmensgewinnkonto dient der Ermittlung eines Saldos, der dem in der betrieblichen Buchführung üblicherweise verwendeten Konzept des laufenden Gewinns vor Verwendung und Einkommensteuern entspricht. |
|
8.27 |
Im Fall des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck betrifft dieses Konto lediglich die marktbestimmten Tätigkeiten dieser Sektoren. |
|
8.28 |
Der Unternehmensgewinn ist gleich dem Betriebsüberschuss bzw. dem Selbständigeneinkommen (auf der Aufkommensseite),
Geleistete Vermögenseinkommen in Form von Dividenden, Gewinnentnahmen oder reinvestierten Gewinnen aus ausländischen Direktinvestitionen werden vom Unternehmensgewinn nicht abgezogen. |
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen (II.1.2.2)
|
8.29 |
Das Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen dient dem Übergang vom Unternehmensgewinnkonzept auf das Primäreinkommenkonzept. Daher enthält dieses Konto die Bestandteile des Primäreinkommens, die im Unternehmensgewinnkonto nicht einbezogen werden:
Tabelle 8.5 — Konto II.1.2.1: Unternehmensgewinn
Tabelle 8.5 — Konto II.1.2.1: Unternehmensgewinn (Fortsetzung)
Tabelle 8.5 — Konto II.1.2.2: Verteilung sonstiger Primäreinkommen
Tabelle 8.5 — Konto II.1.2.2: Verteilung sonstiger Primäreinkommen (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (II.2)
|
8.30 |
Das Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) zeigt, wie das von einem institutionellen Sektor per saldo empfangene Primäreinkommen durch Umverteilungsvorgänge, wie Einkommen- und Vermögensteuern usw., Sozialbeiträge und -leistungen (außer sozialen Sachleistungen) und sonstige laufende Transfers, gebildet wird. |
|
8.31 |
Der Saldo des Kontos bildet das verfügbare Einkommen, das die laufenden Transaktionen widerspiegelt und den für Konsum oder Spartätigkeit verfügbaren Betrag darstellt. |
|
8.32 |
Die Buchung der Sozialbeiträge erfolgt auf der Verwendungsseite des Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) der privaten Haushalte und auf der Aufkommensseite des Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) der für die Verwaltung von Systemen der sozialen Sicherung zuständigen institutionellen Einheiten. Sozialbeiträge, die von den Arbeitgebern für ihre Arbeitnehmer zu leisten sind, werden zunächst als Arbeitnehmerentgelt auf der Verwendungsseite des Einkommensentstehungskontos der Arbeitgeber ausgewiesen, da sie Teil der Lohnkosten sind. Darüber hinaus werden sie als Arbeitnehmerentgelt auf der Aufkommensseite des primären Einkommensverteilungskontos der privaten Haushalte ausgewiesen, da sie Leistungen für die privaten Haushalte darstellen. Die auf der Verwendungsseite des sekundären Einkommensverteilungskontos der privaten Haushalte ausgewiesenen Sozialbeiträge schließen das Dienstleistungsentgelt von Altersvorsorgeeinrichtungen und anderen Versicherungsgesellschaften, deren Mittel ausschließlich oder teilweise aus tatsächlichen Sozialbeiträgen bestehen, nicht ein. In der Tabelle erscheint eine entsprechende Berichtigungsposition für die Dienstleistungsentgelte dieser Versicherungsträger. Die Nettosozialbeiträge (D.61) werden ohne diese Entgelte ausgewiesen. Da Letztere jedoch nur schwer auf die Bestandteile von D.61 aufzuteilen sind, werden diese Bestandteile in der Tabelle brutto (also mit den Entgelten) ausgewiesen. Somit stellt D.61 die Summe seiner Komponenten abzüglich dieser Berichtigungsposition dar. |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3)
|
8.33 |
Das Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) vermittelt einen umfassenderen Eindruck vom Einkommen der privaten Haushalte, da in ihm die Stromgrößen berücksichtigt werden, die der Verwendung individuell zurechenbarer Waren und Dienstleistungen entsprechen, die privaten Haushalten kostenlos vom Staat und von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck zur Verfügung gestellt werden. Bei diesen Stromgrößen handelt es sich um soziale Sachleistungen. Die Berücksichtigung dieser Stromgrößen erleichtert zeitliche Vergleiche bei unterschiedlichen oder sich ändernden wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, und sie vervollständigt die Untersuchung der Rolle des Staates bei der Einkommensumverteilung. |
|
8.34 |
Die sozialen Sachleistungen werden auf der Aufkommensseite des Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) der privaten Haushalte und auf der Verwendungsseite des Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck gebucht. |
|
8.35 |
Der Saldo des Kontos der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) ist das verfügbare Einkommen nach dem Verbrauchskonzept, und dieses stellt den ersten Eintrag auf der Aufkommensseite des Einkommensverwendungskontos (Verbrauchskonzept) (II.4.2) dar. Tabelle 8.6 — Konto II.2: Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)
Tabelle 8.6 — Konto II.2: Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (Fortsetzung)
Tabelle 8.7 — Konto II.3: Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommensverwendungskonto (II.4)
|
8.36 |
Das Einkommensverwendungskonto zeigt für die institutionellen Sektoren, die Letztverbraucher sind, wie das verfügbare Einkommen nach dem Ausgabenkonzept (bzw. das verfügbare Einkommen nach dem Verbrauchskonzept) auf den Konsum nach dem Ausgabenkonzept (bzw. den Konsum nach dem Verbrauchskonzept) und das Sparen aufgeteilt wird. |
|
8.37 |
Im ESVG wird lediglich beim Sektor Staat, den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und den privaten Haushalten die Position Konsum gebucht. Zusätzlich wird im Einkommensverwendungskonto der privaten Haushalte und der Altersvorsorgeeinrichtungen eine Berichtigungsposition ausgewiesen (D.8 — Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), die durch die Art und Weise bedingt ist, wie die Transaktionen zwischen privaten Haushalten und diesen Systemen gebucht werden. Dies wird im Kapitel über Verteilungstransaktionen erläutert (siehe 4.141). |
Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) (II.4.1)
|
8.38 |
Das Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) zeigt, wie die Konsumausgaben von den betreffenden Sektoren (private Haushalte, Staat und private Organisationen ohne Erwerbszweck) finanziert werden. |
|
8.39 |
Der Saldo des Einkommensverwendungskontos (Ausgabenkonzept) ist das Sparen. |
Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) (II.4.2)
|
8.40 |
Dieses Konto steht mit dem Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3) in Verbindung. Im Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) wird der Konsum nach dem Verbrauchskonzept nachgewiesen; er entspricht dem Wert der Waren und Dienstleistungen, die den privaten Haushalten tatsächlich für den Konsum zur Verfügung stehen, selbst wenn der Erwerb dieser Waren und Dienstleistungen vom Staat oder von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck finanziert wird. Der Konsum (Verbrauchskonzept) des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck) entspricht daher lediglich dem Kollektivkonsum. |
|
8.41 |
Auf der Ebene der gesamten Volkswirtschaft sind die Ausgaben für den Konsum nach dem Ausgabenkonzept gleich dem Konsum nach dem Verbrauchskonzept; lediglich die Verteilung auf die institutionellen Sektoren ist unterschiedlich. Das gleiche gilt für das verfügbare Einkommen nach dem Ausgabenkonzept und für das verfügbare Einkommen nach dem Verbrauchskonzept. |
|
8.42 |
Das Sparen ist der Saldo beider Versionen des Einkommensverwendungskontos. Sein Wert ist im Fall aller Sektoren der gleiche, unabhängig davon, ob er durch Abzug des Konsums (Ausgabenkonzept) vom verfügbaren Einkommen (Ausgabenkonzept) oder durch Abzug des Konsums (Verbrauchskonzept) vom verfügbaren Einkommen (Verbrauchskonzept) ermittelt wird. |
|
8.43 |
Das Sparen ist der sich aus den laufenden Transaktionen ergebende (positive oder negative) Betrag, der die Verbindung zur Vermögensbildung herstellt. Ist das Sparen positiv, wird das nicht ausgegebene Einkommen zum Erwerb von Vermögenswerten oder zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet. Ist das Sparen negativ, werden entweder Vermögenswerte verkauft, oder die Verbindlichkeiten erhöhen sich. Tabelle 8.8 — Konto II.4.1: Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept)
Tabelle 8.9 — Konto II.4.2: Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermögensänderungskonten (III)
|
8.44 |
Die Vermögensänderungskonten sind Stromkonten. In ihnen werden die verschiedenen Ursachen für die Veränderung der Aktiva und der Veränderung der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens dargestellt. |
|
8.45 |
Veränderungen der Aktiva werden auf der linken Kontenseite (mit positivem oder negativem Vorzeichen), Veränderungen der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens werden auf der rechten Kontenseite (mit positivem oder negativem Vorzeichen) ausgewiesen. |
Vermögensbildungskonto (III.1)
|
8.46 |
Das Vermögensbildungskonto zeigt den Nettozugang an Vermögensgütern; es misst die Reinvermögensänderung durch Sparen (abschließender Saldo der Transaktionskonten) und Vermögenstransfers. |
|
8.47 |
Das Vermögensbildungskonto ermöglicht festzustellen, inwieweit der Nettozugang an Vermögensgütern durch Sparen und durch Vermögenstransfers finanziert wurde. Es zeigt einen Finanzierungsüberschuss, welcher dem Betrag entspricht, der direkt oder indirekt zur Finanzierung der Vermögensbildung anderer Einheiten oder Sektoren beiträgt, oder ein Finanzierungsdefizit, welches zeigt, um wie viel sich eine Einheit oder ein Sektor bei anderen Einheiten oder Sektoren zusätzlich verschulden musste. |
Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (III.1.1)
|
8.48 |
Aus diesem Konto lässt sich die Veränderung des Reinvermögens aufgrund von Sparen und Vermögenstransfers ablesen, die dem Sparen (netto) zuzüglich empfangener und abzüglich geleisteter Vermögenstransfers entspricht. |
Sachvermögensbildungskonto (III.1.2)
|
8.49 |
In diesem Konto wird der Nettozugang an Vermögensgütern erfasst, was den Übergang von der Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers zum Finanzierungssaldo ermöglicht. |
Finanzierungskonto (III.2)
|
8.50 |
Das Finanzierungskonto zeigt, aufgegliedert nach Finanzierungsinstrumenten, die Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten, aus denen sich der Finanzierungssaldo zusammensetzt. Da diese dem Finanzierungssaldo des Vermögensbildungskontos entsprechen sollten, der als erster Eintrag in diesem Konto auf die Seite der Veränderungen der Verbindlichkeiten und des Reinvermögens übertragen wird, gibt es in diesem Konto keinen Saldo. |
|
8.51 |
Im Finanzierungskonto wird dieselbe Systematik der Aktiva und Verbindlichkeiten verwendet wie in den Vermögensbilanzen. Tabelle 8.10 — Konto III.1.1: Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers
Tabelle 8.11 Konto III.1.2: Sachvermögensbildungskonto
Tabelle 8.11 — Konto III.1.2: Sachvermögensbildungskonto (Fortsetzung)
Tabelle 8.12 — Konto III.2: Finanzierungskonto
Tabelle 8.12 — Konto III.2: Finanzierungskonto (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konto sonstiger Vermögensänderungen (III.3)
|
8.52 |
Im Konto sonstiger Vermögensänderungen werden Veränderungen der Aktiva und Verbindlichkeiten der Einheiten erfasst, die nicht mit dem Sparen oder freiwilligen Vermögenstransfers zusammenhängen, da die letztgenannte Art von Veränderungen in den Vermögensbildungs- und Finanzierungskonten gebucht wird. Das Konto sonstiger Vermögensänderungen untergliedert sich in das Konto sonstiger realer Vermögensänderungen (III.3.1) und in das Umbewertungskonto (III.3.2). |
Konto sonstiger realer Vermögensänderungen (III.3.1)
|
8.53 |
Die im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen ausgewiesenen Vorgänge führen zu einer Veränderung des in den Vermögensbilanzen der betreffenden Einheiten, Sektoren und Teilsektoren ausgewiesenen Reinvermögens, die als Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen bezeichnet wird; sie ist der Saldo des Kontos sonstiger realer Vermögensänderungen. |
Umbewertungskonto (III.3.2)
|
8.54 |
Im Umbewertungskonto werden Veränderungen des Wertes der Aktiva und Verbindlichkeiten erfasst, die auf Preisänderungen zurückzuführen sind. Für einen bestimmten Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit wird diese Veränderung wie folgt ermittelt:
Diese Differenz wird als nominaler Umbewertungsgewinn/-verlust bezeichnet. Ein nominaler Umbewertungsgewinn entspricht der positiven Umbewertung eines Aktivums oder der negativen Umbewertung einer (finanziellen) Verbindlichkeit. Ein nominaler Umbewertungsverlust entspricht der negativen Umbewertung eines Aktivums oder der positiven Umbewertung einer (finanziellen) Verbindlichkeit. |
|
8.55 |
Durch die im Umbewertungskonto verbuchten Stromgrößen ändert sich das in den Vermögensbilanzen der betreffenden Einheiten ausgewiesene Reinvermögen. Diese als Reinvermögensänderung durch Umbewertung bezeichnete Änderung ist der Saldo des Umbewertungskontos. Er wird auf der rechten Kontenseite (Veränderung der Passiva) ausgewiesen. |
|
8.56 |
Das Umbewertungskonto wird in zwei Teilkonten untergliedert: in das Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.1) und in das Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.2). |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.1)
|
8.57 |
Im Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste werden die Veränderungen des Wertes der Aktiva bzw. Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Veränderung des allgemeinen Preisniveaus erfasst. Diese Veränderungen entsprechen der Umbewertung, die zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Kaufkraft der Aktiva bzw. Verbindlichkeiten erforderlich ist. Als Preisindex ist bei diesen Berechnungen der Preisindex für die letzte inländische Verwendung ohne die Vorratsveränderung zugrunde zu legen. |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.2)
|
8.58 |
Die realen Umbewertungsgewinne/-verluste ergeben sich aus der Differenz zwischen nominalen und neutralen Umbewertungsgewinnen/-verlusten. |
|
8.59 |
Sind die nominalen Gewinne aus dem Halten eines Aktivums abzüglich der nominalen Verluste aus dem Halten dieses Aktivums höher als die neutralen Gewinne abzüglich der neutralen Verluste aus dem Halten des Aktivums, so ergibt sich für die Einheit, die das Aktivum hält, ein realer Gewinn aus dem Halten des Aktivums. Er ist darauf zurückzuführen, dass der tatsächliche Preis des Aktivums im Durchschnitt stärker gestiegen ist als das allgemeine Preisniveau. Umgekehrt hat ein Rückgang des relativen Preises des Aktivums für die Einheit, die das Aktivum hält, einen realen Verlust aus dem Halten des Aktivums zur Folge. Entsprechend ergibt sich bei einem Anstieg des relativen Preises einer Verbindlichkeit ein realer Verlust aus dem Halten der Verbindlichkeit und bei einem Rückgang des relativen Preises einer Verbindlichkeit ein realer Gewinn aus dem Halten der Verbindlichkeit. Tabelle 8.13 — Konto III.3.1: Konto sonstiger realer Vermögensänderungen
Tabelle 8.13 — Konto III.3.1: Konto sonstiger realer Vermögensänderungen (Fortsetzung)
Tabelle 8.14 — Konto III.3.2: Umbewertungskonto
Tabelle 8.14 — Konto III.3.2: Umbewertungskonto (Fortsetzung)
Tabelle 8.14 — Konto III.3.2.1: Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste
Tabelle 8.14 — Konto III.3.2.1: Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (Fortsetzung)
Tabelle 8.14 — Konto III.3.2.2: Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste
Tabelle 8.14 — Konto III.3.2.2: Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermögensbilanzen (IV)
|
8.60 |
Die Vermögensbilanzen sollen einen Überblick über die Aktiva, die Verbindlichkeiten und das Reinvermögen der Einheiten am Anfang und am Ende des Rechnungszeitraums sowie über die Veränderung der Vermögensbestände zwischen diesen beiden Zeitpunkten geben. Die Vermögensbilanzen untergliedern sich in
|
Bilanz am Jahresanfang (IV.1)
|
8.61 |
Die Bilanz am Jahresanfang zeigt den Wert der Aktiva und Verbindlichkeiten der Einheiten am Anfang des Rechnungszeitraums. Die Positionen der Bilanz am Jahresanfang basieren auf der Systematik der Aktiva und Verbindlichkeiten. Sie werden zu den am Anfang des Rechnungszeitraums jeweils geltenden Preisen bewertet. Die Differenz zwischen Aktiva und Verbindlichkeiten — der Saldo der Bilanz am Jahresanfang — ist das Reinvermögen am Anfang des Rechnungszeitraums. |
Änderung der Bilanz (IV.2)
|
8.62 |
In der Änderung der Bilanz werden die im Rechnungszeitraum eintretenden Änderungen des Wertes der Aktiva und Verbindlichkeiten gebucht und die in den Vermögensänderungskonten ausgewiesenen Beträge (die Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers, die Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen und die Reinvermögensänderung durch Umbewertung) aggregiert. |
Bilanz am Jahresende (IV.3)
|
8.63 |
Die Bilanz am Jahresende zeigt den Wert der Aktiva und Verbindlichkeiten der Einheiten am Ende des Rechnungszeitraums. Die Positionen der Bilanz am Jahresende basieren auf derselben Systematik wie die Positionen der Bilanz am Jahresanfang; sie werden zu den am Ende des Rechnungszeitraums jeweils geltenden Preisen bewertet. Die Differenz zwischen Aktiva und Verbindlichkeiten ist das Reinvermögen am Ende des Rechnungszeitraums. |
|
8.64 |
Der in der Bilanz am Jahresende ausgewiesene Wert eines Aktivums oder einer Verbindlichkeit ist gleich der Summe seines in der Bilanz am Jahresanfang ausgewiesenen Wertes und des Betrages, der für dieses Aktivum bzw. für diese Verbindlichkeit in der Änderung der Bilanz gebucht ist. Tabelle 8.15 — Konto IV.1: Vermögensbilanzen — Bilanz am Jahresanfang
Tabelle 8.15 — Konto IV.1: Vermögensbilanzen — Bilanz am Jahresanfang (Fortsetzung)
Tabelle 8.15 — Konto IV.2: Vermögensbilanzen — Änderung der Bilanz
Tabelle 8.15 — Konto IV.2: Vermögensbilanzen — Änderung der Bilanz (Fortsetzung)
Tabelle 8.15 — Konto IV.3: Vermögensbilanzen — Bilanz am Jahresende
Tabelle 8.15 — Konto IV.3: Vermögensbilanzen — Bilanz am Jahresende (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSENKONTO (V)
|
8.65 |
Im Außenkonto werden die Transaktionen zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden Einheiten ausgewiesen. Die übrige Welt als solche ist kein institutioneller Sektor, spielt jedoch innerhalb des Systems eine vergleichbare Rolle. |
|
8.66 |
Die Kontenfolge für die übrige Welt ist im Wesentlichen dieselbe wie die für die institutionellen Sektoren, d.h. sie umfasst
|
|
8.67 |
Die in Nummer 8.66 Buchstaben a bis c aufgeführten Konten werden aus der Sicht der übrigen Welt erstellt. Was für die übrige Welt zum Aufkommen gehört, gehört für die gesamte Volkswirtschaft zur Verwendung und umgekehrt. Entsprechend ist ein Vermögenswert der übrigen Welt eine Verbindlichkeit für die gesamte Volkswirtschaft und umgekehrt, außer im Fall des als Währungsreserve gehaltenen Barrengolds, dem zwar keine Verbindlichkeit gegenübersteht, das aber wegen seiner Rolle im internationalen Zahlungsverkehr dennoch im Außenkonto der Finanzierungsströme erfasst wird. |
Leistungsbilanzen
Außenkonto der Waren und Diensteistungen (V.I)
|
8.68 |
Importe werden auf der Aufkommensseite, Exporte auf der Verwendungsseite des Kontos gebucht. Die Differenz zwischen Aufkommen und Verwendung ist der Kontensaldo, der als „Zahlungsbilanz der Waren und Dienstleistungen“ bezeichnet wird. Ein positiver Saldo bedeutet für die übrige Welt einen Überschuss und für die gesamte Volkswirtschaft ein Defizit; im Fall eines negativen Saldos ist es umgekehrt. |
|
8.69 |
Sowohl Importe als auch Exporte werden an der Zollgrenze des Ausfuhrlandes bewertet. Bei den Exporten wird der Wert zu Preisen frei an Bord („free on board“ — FOB) erhoben. Die Importe werden zu cif-Preisen („carriage, insurance and freight“), d. h. einschließlich der zwischen dem Ursprungs- und dem Einfuhrland entstehenden Transport-, Versicherungs- und Verladekosten bewertet. Um den Importwert auf eine FOB-Basis zu reduzieren, die den Wert an der Grenze des Ursprungslandes widerspiegelt, ist das CIF-Element vom am Grenzübergang des Einfuhrlandes gemessenen Warenwert abzuziehen. Das CIF-Element wird dann den entsprechenden Dienstleistungen zugeordnet, entweder — im Falle gebietsfremder Einheiten — als Importe, oder — falls gebietsansässige Einheiten diese Dienste erbringen — als Inlandsproduktion. Werden die im FOB-Wert der Warenimporte enthaltenen Verkehrs- und Versicherungsdienstleistungen (d. h. die Leistungen für den Transport zwischen der Fabrik und der Grenze des Exportlandes) von gebietsansässigen Einheiten erbracht, sind sie in den Wert des Dienstleistungsexports der die Waren importierenden Volkswirtschaft einzubeziehen. Umgekehrt gilt: Werden die im FOB-Wert des Warenexports enthaltenen Verkehrs- und Versicherungsdienstleistungen von gebietsfremden Einheiten erbracht, sind sie in den Wert des Dienstleistungsimports der die Waren exportierenden Volkswirtschaft einzubeziehen. |
Außenkonto der Primäreinkommen und Transfers (V.II)
|
8.70 |
Das Außenkonto der Primäreinkommen und Transfers dient der Ermittlung des Saldos der laufenden Außentransaktionen, der innerhalb des Systems dem Sparen der institutionellen Sektoren entspricht. Das Außenkonto der Primäreinkommen und Transfers ist eine komprimierte Version der Kontenfolge, die für einen institutionellen Sektor die Konten vom primären Einkommensverteilungskonto bis hin zum Einkommensverwendungskonto umfasst. |
|
8.71 |
Auf der Aufkommensseite des Außenkontos der Primäreinkommen und Transfers erscheint der Außenbeitrag. Ferner werden auf der Aufkommens- bzw. der Verwendungsseite des Kontos sämtliche Verteilungstransaktionen außer Vermögenstransfers erfasst, an denen die übrige Welt beteiligt ist. |
Außenkonten der Vermögensänderungen (V.III)
Außenkonto der Vermögensbildung (V.III.1)
|
8.72 |
Im Außenkonto der Vermögensbildung wird der Erwerb abzüglich Veräußerungen nichtproduzierter Vermögensgüter durch gebietsfremde Einheiten gebucht; das Konto weist ferner die Reinvermögensänderung aufgrund des Saldos der laufenden Außentransaktionen und aufgrund von Vermögenstransfers aus. |
|
8.73 |
Der Saldo des Außenkontos der Vermögensbildung ist der Finanzierungssaldo der übrigen Welt. Er ist dem Betrag nach gleich der Summe der Finanzierungsüberschüsse bzw. -defizite der gebietsansässigen institutionellen Sektoren, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. |
Außenkonto der Finanzierungsströme (V.III.2)
|
8.74 |
Das Außenkonto der Finanzierungsströme ist genauso aufgebaut wie das Finanzierungskonto der institutionellen Sektoren. |
Außenkonto sonstiger Vermögensänderungen (V.III.3)
|
8.75 |
Wie bei den institutionellen Sektoren werden nacheinander die Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen und die Reinvermögensänderung durch Umbewertung ermittelt, wobei bei Letzterer zwischen der Reinvermögensänderung durch neutrale und der Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste unterschieden wird. |
|
8.76 |
Das Fehlen produzierter Vermögensgüter in den Vermögensänderungskonten und den Vermögensbilanzen der übrigen Welt ist dadurch zu erklären, dass vereinbarungsgemäß eine fiktive institutionelle Einheit geschaffen wird und dass man davon ausgeht, dass die übrige Welt eine Forderung erworben hat — das Umgekehrte gilt für Vermögensgüter, die von gebietsansässigen Einheiten in anderen Volkswirtschaften gehalten werden. |
Außenkonto für Vermögen und Verbindlichkeiten (V.IV)
|
8.77 |
Im Außenkonto für Vermögen und Verbindlichkeiten werden Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht. Auf der Aktivseite weist es auch den Saldo der zwischen gebietsfremden und gebietsansässigen Einheiten stattfindenden Transaktionen zum Erwerb oder zur Veräußerung von Währungsgold und Sonderziehungsrechten aus. Tabelle 8.16 — Außenkonten
Tabelle 8.16 — Außenkonten (Fortsetzung)
Tabelle 8.16 — Außenkonten (Fortsetzung)
Tabelle 8.16 — Außenkonten (Fortsetzung)
Tabelle 8.16 — Außenkonten (Fortsetzung)
Tabelle 8.16 — Außenkonten (Fortsetzung)
Tabelle 8.16 — Außenkonten (Fortsetzung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜTERKONTO (0)
|
8.78 |
Das Waren- und Dienstleistungskonto soll, sowohl aufgegliedert nach Gütergruppen als auch für die gesamte Volkswirtschaft, das Aufkommen an Gütern und deren Verwendung verdeutlichen. Dieses Konto gehört nicht zur Kontenabfolge; es handelt sich vielmehr um eine Identitätsbeziehung, die den Zusammenhang zwischen dem Aufkommen und der Verwendung von Gütern in der Volkswirtschaft unterstreicht. Das Konto stellt auf aggregierter Ebene die Entsprechung zwischen dem Aufkommen und der Verwendung von Gütern in den Zeilen der Aufkommens- und Verwendungstabellen dar. |
|
8.79 |
Es zeigt daher für die gesamte Volkswirtschaft das Aufkommen (Produktionswert und Importe) und die Verwendung von Gütern als Vorleistungen, Konsum, Bruttoanlageinvestitionen, Vorratsveränderungen, Nettozugang an Wertsachen und Exporte. |
|
8.80 |
Da der Produktionswert zu Herstellungspreisen und die Verwendung zu Anschaffungspreisen bewertet wird, sind auf der Aufkommensseite die Gütersteuern abzüglich der Gütersubventionen hinzuzufügen. |
|
8.81 |
Im Waren- und Dienstleistungskonto wird die Verwendung auf der rechten und das Aufkommen auf der linken Seite gebucht, d. h. umgekehrt wie in den Transaktionskonten der institutionellen Sektoren, da die Güterströme in entgegengesetzter Richtung zu den Geldströmen fließen. |
|
8.82 |
Das Waren- und Dienstleistungskonto ist definitionsgemäß ausgeglichen, weist also keinen Saldo auf. Tabelle 8.17 — Konto 0: Waren- und Dienstleistungskontokonto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUSAMMENGEFASSTE KONTEN
|
8.83 |
Das zusammengefasste Kontensystem gibt einen Gesamtüberblick über die Konten einer Volkswirtschaft: Dies sind die Transaktionskonten, die Vermögensänderungskonten und die Vermögensbilanzen. Dabei werden in einer Tabelle die Konten aller institutionellen Sektoren, der Volkswirtschaft und der übrigen Welt dargestellt und sämtliche Stromgrößen sowie Aktiva und Passiva ausgeglichen. Ferner können aus den zusammengefassten Konten die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen unmittelbar abgelesen werden. |
|
8.84 |
Im zusammengefassten Kontensystem erscheinen auf der linken Seite die Güterverwendung, die Aktiva und ihre Veränderung und auf der rechten Seite das Güteraufkommen, die Passiva und ihre Veränderung sowie das Reinvermögen. |
|
8.85 |
Da einerseits der gesamte Wirtschaftskreislauf abgebildet wird und andererseits die Tabelle übersichtlich gehalten werden soll, wird die höchste Aggregationsebene verwendet, bei der der Aufbau des Systems noch verständlich ist. |
|
8.86 |
Die Spalten der Tabelle stehen für die institutionellen Sektoren (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, finanzielle Kapitalgesellschaften, Staat, private Organisationen ohne Erwerbszweck und private Haushalte). Ferner enthält die Tabelle je eine Spalte für die gesamte Volkswirtschaft und die übrige Welt sowie eine Spalte für den Ausgleich von Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen. |
|
8.87 |
Die Zeilen der Tabelle zeigen die verschiedenen Arten von Transaktionen sowie von Aktiva und Passiva, die Kontensalden und bestimmte Aggregate. Tabelle 8.18 — Zusammengefasste Konten Transaktionskonten
Tabelle 8.18 — Zusammengefasste Konten Vermögensänderungskonten
Tabelle 8.18 — Zusammengefasste Konten Vermögensbilanzen Aktiva
Passiva
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGREGATE
|
8.88 |
Die Aggregate sind Indikatoren für das Ergebnis der Tätigkeit der gesamten Volkswirtschaft und Bezugsgrößen für die makroökonomische Analyse sowie für zeitliche Vergleiche und Vergleiche zwischen Wirtschaftsräumen. |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP)
|
8.89 |
Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen ist ein Maß für das Ergebnis der Produktionstätigkeit der gebietsansässigen produzierenden Einheiten. Es lässt sich auf drei Wegen ermitteln:
|
|
8.90 |
Durch Abzug der Abschreibungen vom BIP ergibt sich das Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (NIP). |
Betriebsüberschuss der Volkswirtschaft
|
8.91 |
Der Betriebsüberschuss (brutto oder netto, je nach Berücksichtigung der Abschreibungen) der gesamten Volkswirtschaft ist gleich der Summe der Betriebsüberschüsse der Wirtschaftsbereiche oder der institutionellen Sektoren. |
Selbständigeneinkommen der Volkswirtschaft
|
8.92 |
Das Selbständigeneinkommen (bezüglich der Abschreibungen brutto oder netto) der gesamten Volkswirtschaft ist gleich dem Selbständigeneinkommen des Sektors private Haushalte. |
Unternehmensgewinn der Volkswirtschaft
|
8.93 |
Der Unternehmensgewinn (bezüglich der Abschreibungen brutto oder netto) der gesamten Volkswirtschaft ist gleich der Summe der Unternehmensgewinne der Sektoren. |
Nationaleinkommen zu Marktpreisen
|
8.94 |
Das Nationaleinkommen (brutto oder netto) zu Marktpreisen ist gleich dem von den gebietsansässigen Einheiten per saldo empfangenen Primäreinkommen: empfangene Arbeitnehmerentgelte, Produktions- und Importabgaben abzüglich der Subventionen, per saldo empfangene Vermögenseinkommen (empfangene abzüglich geleistete), Betriebsüberschuss (brutto oder netto) und Selbständigeneinkommen (brutto oder netto). Das Bruttonationaleinkommen (zu Marktpreisen) ist gleich dem Bruttoinlandsprodukt abzüglich der von gebietsansässigen Einheiten an die nichtgebietsansässige Einheiten geleisteten Primäreinkommen zuzüglich der von gebietsansässigen Einheiten aus der übrigen Welt empfangenen Primäreinkommen. Das Nationaleinkommen ist kein Produktions-, sondern ein Einkommensbegriff. Das Nationaleinkommen ist aussagekräftiger, wenn es netto, d h. abzüglich Abschreibungen, ausgewiesen wird. |
Verfügbares Einkommen insgesamt
|
8.95 |
Das verfügbare Einkommen insgesamt (brutto oder netto) ist gleich der Summe der verfügbaren Einkommen (brutto oder netto) der institutionellen Sektoren. Das verfügbare Einkommen der Volkswirtschaft (brutto oder netto) ist gleich dem Nationaleinkommen zu Marktpreisen (brutto oder netto) abzüglich laufender Transfers (Einkommen- und Vermögensteuern, Sozialbeiträge, Sozialleistungen und sonstige laufende Transfers) an die übrige Welt, zuzüglich laufender Transfers aus der übrigen Welt. |
Sparen
|
8.96 |
Dieses Aggregat zeigt für die Volkswirtschaft den Teil des verfügbaren Einkommens insgesamt, der nicht für den Konsum verwendet wird. Das Sparen insgesamt (brutto oder netto) ist gleich der Summe des Sparens (brutto oder netto) der institutionellen Sektoren. |
Saldo der laufenden Außentransaktionen
|
8.97 |
Der Saldo des Außenkontos der Primäreinkommen und Transfers zeigt für die Volkswirtschaft den Überschuss (wenn er negativ ist) bzw. das Defizit (wenn er positiv ist) ihrer laufenden Transaktionen (Waren- und Dienstleistungsverkehr, Primäreinkommen, laufende Transfers) mit der übrigen Welt. |
Finanzierungssaldo der gesamten Volkswirtschaft
|
8.98 |
Der Finanzierungssaldo der gesamten Volkswirtschaft ist gleich der Summe der Finanzierungsüberschüsse bzw. -defizite der institutionellen Sektoren. Diese Gesamtgröße zeigt (wenn sie positiv ist) den Nettobetrag an Mitteln, den die gesamte Volkswirtschaft der übrigen Welt zur Verfügung stellt bzw. (wenn sie negativ ist) den Nettobetrag, den die übrige Welt der gesamten Volkswirtschaft zur Verfügung stellt. Der Finanzierungssaldo der gesamten Volkswirtschaft ist dem Betrag nach gleich dem Finanzierungssaldo der übrigen Welt, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. |
Reinvermögen der gesamten Volkswirtschaft
|
8.99 |
Das Reinvermögen der gesamten Volkswirtschaft ist gleich der Summe der Reinvermögen der institutionellen Sektoren. Es zeigt den Wert der Vermögensgüter der gesamten Volkswirtschaft abzüglich der Salden der Forderungen und Verbindlichkeiten der übrigen Welt. |
Ausgaben und Einnahmen des Staates
Die Ausgaben und Einnahmen des Staates werden anhand einer Liste von Positionen des ESVG definiert.
|
8.100 |
Die Ausgaben des Staates umfassen folgende Positionen des ESVG, die mit Ausnahme der Position D.3, die auf der Aufkommensseite der Konten des Staates erscheint, auf der Verwendungsseite der Konten des Staates ausgewiesen werden:
Die Einnahmen des Staates umfassen folgende Positionen des ESVG, die mit Ausnahme der Position D.39, die auf der Verwendungsseite der Konten des Staates erscheint, auf der Aufkommensseite der Konten des Staates ausgewiesen werden:
Die Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Staates ist definitionsgemäß der Finanzierungssaldo des Staates. Die Transaktionen D.41 (Zinsen), D.73 (laufende Transfers innerhalb des Staates), D.92 (Investitionszuschüsse) und D.99 (sonstige Vermögenstransfers) werden konsolidiert. Die übrigen Transaktionen werden nicht konsolidiert. |
KAPITEL 9
AUFKOMMENS- UND VERWENDUNGSTABELLEN UND INPUT-OUTPUT- SYSTEM
EINLEITUNG
|
9.01 |
Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Aufkommens- und Verwendungstabellen und das Input-Output-System geben. |
|
9.02 |
Im Zentrum des Input-Output-Systems stehen die Aufkommens- und Verwendungstabellen in jeweiligen Preisen und in Vorjahrespreisen. Vervollständigt wird das System durch die symmetrischen Input-Output-Tabellen, die über Annahmen oder Zusatzdaten aus den Aufkommens– und Verwendungstabellen abgeleitet werden. Die Aufkommens– und Verwendungstabellen sowie symmetrischen Input-Output-Tabellen können für spezielle Zwecke erweitert und abgewandelt werden, zum Beispiel für Produktivitätsrechnungen, Arbeitskräfterechnungen, vierteljährliche Gesamtrechnungen, regionale Gesamtrechnungen und umweltökonomische Gesamtrechnungen in Geldeinheiten oder physischen Einheiten. |
|
9.03 |
Aufkommens- und Verwendungstabellen sind nach Wirtschaftsbereichen und Gütergruppen gegliederte Matrizen, die die Werte der Gütertransaktionen in der Volkswirtschaft beschreiben. Diese Tabellen zeigen
|
|
9.04 |
Eine Aufkommenstabelle zeigt das Aufkommen von Waren und Dienstleistungen nach Gütergruppen und nach produzierenden Wirtschaftsbereichen, wobei zwischen inländischem Aufkommen und Importen unterschieden wird. Ein schematischer Aufriss einer Aufkommenstabelle ist nachstehend in Tabelle 9.1 aufgeführt. Tabelle 9.1 — Schematische Darstellung einer Aufkommenstabelle
|
|
9.05 |
Eine Verwendungstabelle zeigt die Verwendung von Waren und Dienstleistungen nach Gütergruppen und Verwendungsarten. In den Spalten werden folgende Verwendungsarten dargestellt:
In den Tabellenspalten sind unter der Rubrik Vorleistungen nach Wirtschaftsbereichen die Komponenten der Bruttowertschöpfung wie folgt dargestellt:
Eine schematische Darstellung einer Verwendungstabelle ist in Tabelle 9.2 enthalten. Tabelle 9.2 — Schematische Darstellung einer Verwendungstabelle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.06 |
In den Aufkommens- und Verwendungstabellen gibt es folgende Identitätsbeziehungen:
|
|
9.07 |
Aufkommens- und Verwendungstabellen sind der zentrale Bezugsrahmen für Analysen der Wirtschaftsbereiche, z. B. die Analyse des Produktionswerts, der Wertschöpfung, des Arbeitnehmerentgeltes, der Erwerbstätigkeit, des Betriebsüberschusses/Selbständigeneinkommens, der Produktionsabgaben (abzüglich Subventionen), der Bruttoanlageinvestitionen, der Abschreibungen und des Kapitalstocks. |
|
9.08 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen enthalten die in den folgenden Konten dargestellten Ströme:
Diese Konten bilden die Einkommensentstehung sowie Aufkommen und Verwendung von Waren und Dienstleistungen nach institutionellen Sektoren ab. Die Aufkommens- und Verwendungstabellen können diese Informationen ergänzen, indem sie nach Wirtschaftszweigen aufschlüsseln sowie Volumen- und Preisänderungen ausweisen. Die Informationen nach institutionellen Sektoren in den Sektorkonten und die Informationen nach Wirtschaftsbereichen in den Aufkommens- und Verwendungstabellen lassen sich wie in Tabelle 9.3 gezeigt über eine Kreuztabelle verbinden. Tabelle 9.3 — Kreuztabelle zur Verbindung der Aufkommens- und Verwendungstabelle mit den Sektorkonten
|
|
9.09 |
Eine symmetrische Input-Output-Tabelle wie in Tabelle 9.4 ist eine Matrix, aus der ersichtlich ist, wie das Aufkommen der Verwendung entspricht, wenn der Produktionswert und die detaillierten Vorleistungs- und Konsumtransaktionen in einer Güter/Güter-Matrix oder Wirtschaftsbereich/Wirtschaftsbereich-Matrix dargestellt werden. Es gibt einen wesentlichen konzeptionellen Unterschied zwischen einer symmetrischen Input-Output-Tabelle und einer Verwendungstabelle: Die Einträge in einer Verwendungstabelle zeigen auf, wie Güter von Wirtschaftsbereichen als Vorleistungen verwendet werden, während eine symmetrische Input-Output-Tabelle zwei unterschiedliche Darstellungen enthält:
Folglich sind die symmetrischen Input-Output-Tabellen in den Zeilen und Spalten einheitlich entweder nach Gütergruppen oder nach Wirtschaftsbereichen aufgeteilt. Tabelle 9.4 — Schematische Darstellung einer symmetrischen Input-Output-Tabelle für Güter
|
|
9.10 |
Statistische Informationen, die man von produzierenden Einheiten erhält, bilden meist die Güterarten ab, die produziert und verkauft werden, und, gewöhnlich weniger detailliert, welche Güterarten gekauft und verwendet werden. Der Aufbau der Aufkommens- und Verwendungstabellen ist auf diesen Typ statistischer Informationen ausgelegt (d.h. Güter nach Wirtschaftsbereichen). |
|
9.11 |
Dagegen stehen die für symmetrische Input-Output-Tabellen erforderlichen Daten in kombinierter Gliederung nach Gütergruppen oder Wirtschaftsbereichen nur selten zur Verfügung. Beispielsweise liefern die Erhebungen in der Wirtschaft gewöhnlich Angaben darüber, welche Gütergruppen in der Produktion verwendet und welche Güter produziert und verkauft wurden. Daten darüber, was für die Produktion bestimmter Güter verwendet wird, sind in der Regel nicht verfügbar. |
|
9.12 |
Informationen angeordnet in der Form von Aufkommens- und Verwendungstabellen sind der Ausgangspunkt für die Erstellung der mehr analytisch ausgerichteten symmetrischen Input-Output-Tabellen. Die nach Wirtschaftsbereichen/Gütergruppen gegliederten Daten der Aufkommens- und Verwendungstabellen lassen sich dabei in symmetrische Tabellen umwandeln, indem zusätzliche Informationen über die Inputstrukturen genutzt werden oder durch die Annahme identischer Inputstrukturen oder Absatzstrukturen bei Gütergruppen bzw. Wirtschaftsbereichen. |
|
9.13 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen und das Input-Output-System vereinen drei unterschiedliche Funktionen:
|
BESCHREIBUNG
|
9.14 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen liefern eine systematische Beschreibung der Einkommensentstehung sowie des Aufkommens an Gütern und der Verwendung nach Wirtschaftsbereichen. Die Entwicklungen der Inputs und Outputs der Produktionsprozesse einzelner Wirtschaftsbereiche werden im Zusammenhang mit der Volkswirtschaft dargestellt, d. h. im Verhältnis zu den Produktionsprozessen anderer inländischer Wirtschaftsbereiche, zur übrigen Welt und zu den Konsumausgaben. Ein wesentlicher Zweck der Aufkommens- und Verwendungstabellen ist die Abbildung der strukturellen Veränderungen der Volkswirtschaft, z. B. Verschiebungen in der Bedeutung einzelner Wirtschaftsbereiche, Änderungen bei Einsatz und Produktion von Gütern, veränderte Zusammensetzung der Konsumausgaben, Bruttoinvestitionen, Importe und Exporte. Hinter den Änderungen lassen sich alle Arten von Entwicklungen erkennen, wie Globalisierung, Betriebsauslagerungen (Outsourcing), Innovationen sowie Änderungen der Arbeitskosten, Steuern und Abgaben, Ölpreise und Wechselkurse. Aufkommens- und Verwendungstabellen in Vorjahrespreisen werden genutzt, um die Wachstumsrate des BIP-Volumens statistisch zu ermitteln und Änderungen der Wirtschaftsstruktur nominal und volumenmäßig zu beschreiben. Die Tabellen liefern außerdem einen Rahmen für die Darstellung nationaler Preis- und Arbeitskostenänderungen. |
STATISTISCHES INSTRUMENT
|
9.15 |
Indem für den Aufbau der Aufkommens- und Verwendungstabellen Daten über die Produktion, die Ausgaben und das Einkommen verwendet und unstimmige Größen abgeglichen werden, entstehen zuverlässige und abgestimmte Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, u. a. die Angaben von Schlüsselaggregaten wie das BIP zu jeweiligen Preisen und zu Vorjahrespreisen. |
|
9.16 |
Zur Messung des BIP zu Marktpreisen lassen sich drei grundlegende Ansätze verwenden: der Produktionsansatz, der Ausgabenansatz und der Einkommensansatz. Diese drei unterschiedlichen Ansätze werden zur Erstellung der Aufkommens– und Verwendungstabellen wie folgt genutzt:
Ein abgestimmtes Ergebnis für das BIP zu Marktpreisen liegt vor, wenn die Aufkommens– und Verwendungstabellen ausbilanziert sind. |
|
9.17 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen sind besonders hilfreich für die Ermittlung des BIP zu Marktpreisen nach dem Produktionsansatz und dem Ausgabenansatz. Hauptdatenquellen sind Wirtschaftserhebungen und administrative Daten wie z. B. Angaben zu Mehrwertsteuer und Verbrauchsabgaben. Über die Aufkommens- und Verwendungstabellen werden auch Informationen aus dem Produktions- und Ausgabenansatz kombiniert, nämlich durch Berechnung und Abgleich von Aufkommen und Verwendung auf Güterebene. Bei dieser Methode wird beispielsweise das Aufkommen eines bestimmten Erzeugnisses berechnet und dann verschiedenen Verwendungsarten zugeordnet, wie den Konsumausgaben von Privathaushalten, Vorleistungen und Exporten. Der Einkommensansatz liefert keine genauso robusten Abstimmungen, da Betriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen gewöhnlich als Restposten aus den Informationen der beiden anderen Ansätze geschätzt werden. Durch den Einkommensansatz wird jedoch die Abstimmung der Aufkommens- und Verwendungstabellen verbessert, wenn eingeschätzt werden kann, wie die Komponenten des Faktoreinkommens strukturiert sind. Die Konsistenz zwischen den Aufkommens- und Verwendungstabellen und den Sektorkonten lässt sich durch Verknüpfungstabellen, wie in Tabelle 9.3 gezeigt, überprüfen. Diese Gegenüberstellung kann bei der Ermittlung des BIP zu Marktpreisen hilfreich sein, indem Daten aus den Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen mit entsprechenden Angaben für die Wirtschaftsbereiche verglichen werden. |
|
9.18 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen dienen verschiedenen statistischen Zwecken.
Der Abgleich des Aufkommens und der Verwendung einer Gütergruppe ist leichter, wenn die Zahl der unterschiedenen Gütergruppen größer ist und wenn Datenmaterial für eine tiefere Gliederung verfügbar ist. Die Qualität der abgeglichenen Ergebnisse ist dann höher; das trifft besonders zu, wenn die Daten Lücken aufweisen. |
INSTRUMENT FÜR DIE ANALYSE
|
9.19 |
Eine wesentliche analytische Stärke der Input-Output-Tabellen liegt darin, dass sich nicht nur Auswirkungen erster Ordnung, z. B. Änderungen der Energiepreise oder Arbeitskosten, sondern auch Auswirkungen zweiter Ordnung oder noch indirektere Auswirkungen messen lassen. Beispielsweise wirkt sich eine erhebliche Erhöhung der Energiepreise nicht nur auf energieintensive Wirtschaftsbereiche aus, sondern auch auf diejenigen Wirtschaftsbereiche, die die energieintensiv hergestellten Erzeugnisse verwenden. Solche indirekten Auswirkungen können von hoher Bedeutung sein und sind zuweilen erheblicher als unmittelbare Auswirkungen. |
DETAILLIERTERE AUFKOMMENS- UND VERWENDUNGSTABELLEN
Klassifikationen
|
9.20 |
Als Klassifikationen werden in Aufkommens- und Verwendungstabellen sowie in den Input-Output-Tabellen für die Wirtschaftsbereiche die NACE und für die Güter die CPA verwendet; diese Klassifikationen sind vollständig aufeinander abgestimmt: Die CPA weist auf jeder Aggregationsebene die charakteristischen Erzeugnisse der entsprechenden Wirtschaftsbereiche gemäß NACE aus. |
|
9.21 |
In den Aufkommens- und Verwendungstabellen ist die Güterklassifikation mindestens ebenso detailliert wie die Klassifikation der Wirtschaftsbereiche, z. B. die dreistellige Ebene der CPA und die zweistellige Ebene der NACE. |
|
9.22 |
Die Klassifikationen der Wirtschaftsbereiche und Güter lassen sich auf dreierlei Kriterien zurückführen: Angebotskriterien, Nachfragekriterien und Größe. Für Produktivitätsanalysen werden Güter und ihre Hersteller grundsätzlich nach Art des Produktionsprozesses klassifiziert. Für Nachfrageanalysen werden Güter nach der Ähnlichkeit des Zwecks klassifiziert, indem z. B. Luxusgüter zusammengefasst werden, oder nach der Vermarktungsorientierung, etwa nach dem Vertriebskanal. Für Input-Output-Analysen wird für Güter oder Wirtschaftsbereiche die gleiche Klassifikation sowohl für das Aufkommen als auch für die Verwendung genutzt. Die Klassifikation wird dabei so gestaltet, dass die einzelnen Klassen keinen zu kleinen oder zu großen Teil der Volkswirtschaft abbilden. Das bedeutet für internationale Klassifikationen auch, dass die meisten Klassen in vielen Ländern quantitativ bedeutsam sind. |
|
9.23 |
Die Klassifikationen nach Wirtschaftsbereichen und Gütergruppen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind zwangsläufig eine Mischung solcher Kriterien und auch historisch bedingt. Sie sind im Wesentlichen nach dem Blickwinkel der Hersteller festgelegt und daher für die Analyse von Angebot und Nachfrage weniger gut geeignet. Hersteller wie auch Nutzer der Daten über Wirtschaftsbereiche und Gütergruppen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sollten eine gute Vorstellung darüber haben, was die einzelnen Gruppen tatsächlich beinhalten und nicht beinhalten und was daraus folgt. Der Wirtschaftsbereich Grundstücks- und Wohnungswesen enthält beispielsweise die Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohneigentum, während der Wirtschaftsbereich Versicherungen keine Sozialversicherungen enthält. |
|
9.24 |
Die örtlichen fachlichen Einheiten (FE) in einem bestimmten Wirtschaftsbereich können unterschiedliche Produktionsprozesse aufweisen. Hier kann es wesentliche Unterschiede geben in Bezug auf vertikale Integration, Fremdvergabe von Hilfstätigkeiten wie Reinigungs-, Transport-, Verwaltungs- und Verpflegungsleistungen, Anmietung von Maschinen, Inanspruchnahme von Leiharbeit und Marketing. Weitere Unterschiede kann es zwischen legalen und illegalen Hersteller oder Hersteller in unterschiedlichen Regionen geben. |
|
9.25 |
Die Klassifikationen nach Wirtschaftsbereichen und Gütergruppen werden regelmäßig aktualisiert, da sich die wirtschaftliche Bedeutung verschiedener Wirtschaftsbereiche und Gütergruppen wandelt, Produktionsprozesse sich ändern und neue Produkte auftauchen. Zwischen dem Bestreben, mit den Veränderungen in der Wirtschaft Schritt zu halten, und der periodenübergreifenden Vergleichbarkeit von Daten sowie angesichts der Kosten solcher wesentlichen Änderungen für die Datenproduzenten und -nutzer muss hierbei jedoch ein Mittelweg gefunden werden. |
|
9.26 |
Die Güterklassifikation in den Aufkommens- und Verwendungstabellen ist in der Regel detaillierter als die Klassifikation der Wirtschaftsbereiche. Dafür gibt es vier wesentliche Gründe:
|
|
9.27 |
Die Aufgliederung in Marktproduktion, Produktion für die Eigenverwendung und Nichtmarktproduktion ist nur für die Produktionswerte nach Wirtschaftsbereichen bestimmt und nicht für die einzelnen Gütergruppen erforderlich. |
|
9.28 |
Zwischen Marktproduzenten, Produzenten für die Eigenverwendung und sonstigen Nichtmarktproduzenten wird bei den Wirtschaftsbereichen unterschieden, bei denen diese unterschiedlichen Arten von Produzenten vorkommen. In der Regel wird diese tiefere Aufgliederung deshalb nur in sehr wenigen Wirtschaftsbereichen notwendig sein, beispielsweise in den Bereichen Gesundheitswesen und Erziehung. |
|
9.29 |
Zur Analyse der Wirtschaft der Mitgliedstaaten aus europäischer Sicht bzw. zur Ableitung der Aufkommens- und Verwendungstabellen für die gesamte EU werden die Importe und Exporte untergliedert in
|
Bewertungsgrundsätze
|
9.30 |
Waren- und Dienstleistungsströme werden in der Aufkommenstabelle zu Herstellungspreisen und in der Verwendungstabelle zu Anschaffungspreisen bewertet. Um Aufkommen und Verwendung konsistent zu bewerten, weist Tabelle 9.5 auch den Übergang vom Aufkommen zu Herstellungspreisen zum Aufkommen zu Anschaffungspreisen aus. Da für Güter das Aufkommen gleich der Verwendung ist, gelten zwei Identitätsbeziehungen:
|
|
9.31 |
Die Bruttowertschöpfung wird zu Herstellungspreisen ausgewiesen. Sie ist die Differenz zwischen dem Produktionswert zu Herstellungspreisen und den Vorleistungen zu Anschaffungspreisen. |
|
9.32 |
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten ist kein Konzept, das im ESVG benutzt wird. Sie kann dadurch berechnet werden, dass von der Wertschöpfung zu Herstellungspreisen die sonstigen Produktionsabgaben (abzüglich der sonstigen Subventionen) subtrahiert werden. |
|
9.33 |
Der Übergang von Herstellungspreisen zu Anschaffungspreisen beim Aufkommen erfolgt durch
Ähnlich erfolgt der Übergang von der Verwendung zu Anschaffungspreisen zur Verwendung zu Herstellungspreisen, wobei hier jedoch Gütersteuern subtrahiert und Gütersubventionen addiert werden. Die Tabellen 9.8 und 9.9 zeigen, wie der Übergang im Einzelnen vonstatten geht. Diese Tabellen sind auch für umfassende analytische Zwecke geeignet, beispielsweise für die Preisanalyse und für die Analyse der Auswirkungen von Änderungen der Gütersteuersätze. |
|
9.34 |
Somit ergeben sich die folgenden Tabellen aus dem Abgleichverfahren:
Tabelle 9.5 — Aufkommenstabelle zu Herstellungspreisen einschließlich Umwandlung zu Anschaffungspreisen
Tabelle 9.6 — Verwendungstabelle zu Anschaffungspreisen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handels- und Transportspannen
Tabelle 9.7 — Handels- und Transportspannen — Aufkommen
|
|
Handels- und Transportspannen bei Aufkommen nach Gütergruppen |
|
||
|
|
Großhandel |
Einzelhandel |
Transport |
Handels- und Transportspannen |
|
Gütergruppen (CPA) 1 2 3 4 |
|
|
|
Handels- und Transportspannen bei Gesamtaufkommen nach Gütergruppen |
|
Insgesamt |
Großhandel insgesamt |
Einzelhandel insgesamt |
Transport insgesamt |
Spannen insgesamt bei Aufkommen nach Gütergruppen |
Tabelle 9.7 (Fortsetzung) — Handels- und Transportspannen — Verwendung
|
|
Handels- und Transportspannen bei Verwendung nach Gütergruppen |
|||||||||||||||||
|
|
|
Wirtschaftszweige (NACE) 1 – 2 – 3 – 4 - … |
Konsum |
Bruttoinvestitionen |
Exporte |
Handels- und Transportspannen |
||||||||||||
|
Gütergruppen (CPA) 1 2 3 4 |
|
Handels- und Transportspannen bei Vorleistungen nach Gütergruppen und Wirtschaftsbereichen |
Handels- und Transportspannen bei Konsumausgaben nach Gütergruppen und nach
|
Handels- und Transportspannen bei Bruttoinvestitionen nach Gütergruppen und nach
|
Handels- und Transportspannen bei Exporten |
Handels- und Transportspannen bei Gesamtverwendung nach Gütergruppen |
||||||||||||
|
Insgesamt |
|
Handels- und Transportspannen bei Vorleistungen insgesamt nach Wirtschaftsbereichen |
Handels- und Transportspannen insgesamt bei Konsum |
Handels- und Transportspannen insgesamt bei Bruttoinvestitionen |
Handels- und Transportspannen insgesamt bei Exporten |
Spannen insgesamt bei Verwendung nach Gütergruppen |
||||||||||||
|
9.35 |
Ein Teil des Übergangs von den Herstellungs- zu den Anschaffungspreisen in Aufkommenstabellen (bzw. von den Anschaffungs- zu den Herstellungspreisen in Verwendungstabellen) ist die Umbuchung der Handelsspannen. Bei einer Bewertung zu Herstellungspreisen werden die Handelsspannen im Handel gebucht, während die Handelsspannen bei einer Bewertung zu Anschaffungspreisen den entsprechenden Gütern zugeordnet werden. Dasselbe gilt für die Transportspannen. |
|
9.36 |
Die auf den Gütern insgesamt liegenden Handelsspannen sind gleich dem Gesamtwert der im Handel anfallenden Handelsspannen zuzüglich der Handelsspannen anderer Wirtschaftsbereiche. Dasselbe gilt für die Transportspannen. |
|
9.37 |
Die Transportspanne umfasst die Transportkosten, die vom Käufer getrennt gezahlt werden und verwendungsseitig im Anschaffungspreis enthalten sind, nicht aber im Herstellungspreis oder in der Handelsspanne von Groß- oder Einzelhändlern. Zur Transportspanne gehört insbesondere:
|
|
9.38 |
Anderen Transportkosten werden nicht als Transportspanne beim Käufer der transportierten Ware ausgewiesen, z. B.:
|
|
9.39 |
Tabelle 9.7 zeigt aus folgenden Gründen ein etwas vereinfachtes Bild einer Matrix der Handels- und Transportspannen:
|
Produktionssteuern und Importabgaben abzüglich Subventionen
|
9.40 |
Produktionssteuern und Importabgaben umfassen:
Die Subventionen werden in ähnlicher Weise untergliedert. |
|
9.41 |
Das Aufkommen zu Herstellungspreisen enthält die sonstigen Produktionsabgaben abzüglich Subventionen. Für den Übergang von den Herstellungspreisen zu den Anschaffungspreisen werden die verschiedenen Gütersteuern hinzugerechnet und die Gütersubventionen herausgerechnet. Tabelle 9.8 — Gütersteuer abzüglich Gütersubventionen Steuern auf das Aufkommen abzüglich Subventionen
Tabelle 9.8 — Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen (Fortsetzung) Steuern auf die Verwendung abzüglich Subventionen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.42 |
Die Tabelle 9.8 über Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen ist folgendermaßen vereinfacht:
|
|
9.43 |
Als Gütersteuern und -subventionen zu buchen sind die nur aufgrund von Steuerveranlagungen, Steuererklärungen usw. fälligen Beträge oder die tatsächlich gezahlten Beträge. Bei der Aufstellung der Aufkommens- und Verwendungstabellen werden üblicherweise Schätzwerte nach Gütergruppen ermittelt, die man durch Anlegen der amtlichen Steuer- bzw. Subventionssätze an die verschiedenen Nachfrageströme erhält. Die Differenzen zu den Steuerveranlagungen und den tatsächlich gezahlten Beträgen sollten anschließend bewertet werden.
|
|
9.44 |
Die MwSt. kann abziehbar oder nichtabziehbar sein oder wird nicht erhoben:
|
|
9.45 |
Die MwSt. wird netto erfasst: Das Aufkommen wird stets zu Herstellungspreisen bewertet, d. h. ohne die in Rechnung gestellte MwSt. Die intermediäre und die letzte Verwendung werden zu Anschaffungspreisen ausgewiesen, d. h. ohne die abziehbare MwSt. |
Sonstige Grundkonzepte
|
9.46 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen enthalten zwei Korrekturposten, mit denen die Bewertung der Importe in den Aufkommens- und Verwendungstabellen und die Bewertung in den institutionellen Sektorkonten abgeglichen wird. In der Aufkommenstabelle werden die Warenimporte cif bewertet, um die Vergleichbarkeit mit der inländischen Produktion der gleichen Gütergruppe zu erreichen. Der cif-Wert schließt die Transport- und Versicherungsleistungen ein, die von inländischen Einheiten erbracht werden (etwa beim Transport durch den Importeur selbst oder durch ein inländisches Transportunternehmen). Um Importe und Exporte konsistent zu bewerten, müssen die Dienstleistungsexporte also um diesen Betrag angehoben werden. In den institutionellen Sektorkonten werden die Warenimporte fob dargestellt, d. h. analog zur Bewertung von Güterexporten. Bei fob-Bewertung ist jedoch der Wert der von Inländern erbrachten Transport- und Versicherungsleistungen, der im Export von Dienstleistungen enthalten ist, kleiner, da nur der Leistungsteil erfasst ist, der innerhalb des Ausfuhrlandes erbracht wird. Die Anwendung unterschiedlicher Bewertungsgrundsätze führt dazu, dass die Warenwerte der Importe zwar gleich bleiben, die gesamten Importe und Exporte aber bei der cif-Bewertung jeweils größer sind als bei der fob-Bewertung. Mit Hilfe von Korrekturposten wird in den Aufkommens- und Verwendungstabellen dieser cif/fob-Bewertungsunterschied bei den Importen und Exporten insgesamt ausgleichen. Die Korrekturposten sind gleich den im cif-Wert — aber nicht im fob-Wert — enthaltenen Transport- und Versicherungsleistungen, die von inländischen Einheiten für Warenimporteure zwischen der ausländischen Exportgrenze und der inländischen Importgrenze erbracht werden. Sobald diese Korrekturposten in die Aufkommens- und Verwendungstabellen eingearbeitet sind, bedürfen sie in der Input-Output-Rechnung keiner besonderen Behandlung mehr. |
|
9.47 |
Die Abgabe gebrauchter Güter wird in der Verwendungstabelle als negative Ausgabe des Verkäufers und als positive Ausgabe des Käufers gebucht. Für die betreffende Gütergruppe wirkt sich die Abgabe eines gebrauchten Gutes als Zuordnung zu einer anderen Verwendungskategorie aus. Nur die damit verbundenen Transaktionskosten werden nicht als Neuzuordnung behandelt, sondern als Verbrauch von Dienstleistungen verbucht, beispielsweise als Inanspruchnahme wirtschaftlicher oder freiberuflicher Dienstleistungen. Für Beschreibungen und Untersuchungen kann es sinnvoll sein, für bestimmte Gütergruppen den Umfang des Handels mit gebrauchten Gütern getrennt auszuweisen, etwa den Anteil der Gebrauchtwagen am gesamten Handel mit neuen und gebrauchten Fahrzeugen oder den Anteil von Altpapier am Aufkommen von Erzeugnissen aus Papier oder Pappe. |
|
9.48 |
Zum richtigen Verständnis der Aufkommens- und Verwendungstabellen ist es hilfreich, an einige Buchungskonventionen zu erinnern, die im ESVG zur Anwendung kommen:
|
Nachrichtliche Angaben
|
9.49 |
Die Verwendungstabelle 9.6 enthält ergänzende Informationen: Bruttoanlageinvestitionen, Anlagevermögen und Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen. Eine Aufschlüsselung nach Arbeitnehmern und Selbständigen ist eine wertvolle zusätzliche Angabe. Die Angaben zu Bruttoanlageinvestitionen und Anlagevermögen der einzelnen Wirtschaftsbereiche wird für die Ableitung der jeweiligen Abschreibungen und für eine Buchung der nichtabziehbaren MwSt. auf die Bruttoanlageinvestitionen benötigt. Die Darstellung der Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen ist für die folgende Berechnungen wesentlich:
Zusätzliche Angaben zur Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen sind auch für Beschäftigungs- und Produktivitätsanalysen nützlich. |
DATENQUELLEN UND ABSTIMMUNG
|
9.50 |
Wesentliche Datenquellen für die Produktionswerte der einzelnen Wirtschaftsbereiche und Gütergruppen sind üblicherweise Wirtschaftserhebungen, Produktionserhebungen und Jahresberichte bzw. Betriebskonten von wichtigen Unternehmen. Großunternehmen werden in der Regel komplett erfasst, während die Erhebungen bei kleinen Unternehmen stichprobenartig erfolgen. Bei bestimmten Tätigkeiten können Daten unterschiedlicher Quellen maßgeblich sein, beispielsweise für Aufsichtsbehörden, Einnahmen und Ausgaben des Staates auf lokaler und zentraler Ebene, Sozialversicherungen usw. |
|
9.51 |
Solche Daten werden für die Erstellung eines ersten, noch unvollständigen Satzes von Aufkommens- und Verwendungstabellen ausgewertet. Diese Tabellen werden in mehreren Stufen abgeglichen. Die manuelle Saldierung auf unterer Aggregationsebene liefert wichtige Prüfungen auf Datenfehler sowie Systemfehler und gleichzeitig können Änderungen an den Basisdaten vorgenommen werden, beispielsweise in Bezug auf konzeptionelle Unterschiede und fehlende Einheiten. Erfolgte die Abstimmung auf einer höheren Aggregationsebene durch eine automatischen Saldierung oder eine streng vorgegebenen Abstimmungsfolge, so würden die meisten dieser Prüfungen wegfallen, da Fehler geglättet werden und Ursachen nicht rückverfolgbar sind. |
INSTRUMENT FÜR DIE ANALYSE UND ERWEITERUNGEN
|
9.52 |
Zur Analyse können drei Tabellenarten verwendet werden:
Symmetrischen Input-Output-Tabellen lassen sich aus den Aufkommens- und Verwendungstabellen herleiten, zu jeweiligen Preisen ebenso wie zu Vorjahrespreisen. |
|
9.53 |
Die Verwendungstabelle 9.6 lässt nicht erkennen, ob die verwendeten Waren und Dienstleistungen im Inland produziert oder eingeführt worden sind. Diese Unterscheidung ist für Analysen erforderlich, bei denen die Beziehungen zwischen dem Aufkommen und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Volkswirtschaft eine Rolle spielen. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung, wie sich Änderungen bei den Exporten oder den Konsumausgaben auf die Importe sowie auf die Inlandsproduktion und damit verbundene volkswirtschaftliche Größen wie die Beschäftigung auswirken. Das System der Input-Output-Tabellen sollte daher möglichst gesonderte Verwendungstabellen für importierte Güter und für die im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen enthalten. |
|
9.54 |
Die Verwendungstabelle für importierte Güter wird anhand aller verfügbaren Informationen über die Verwendung importierter Güter berechnet. So können beispielsweise für einige Güter die wichtigsten Importeure bekannt sein, oder für einige Hersteller können Informationen über deren Importe vorliegen. Im Allgemeinen sind jedoch kaum statistische Informationen über die Verwendung der Importe verfügbar. Normalerweise sind daher ergänzende Hypothesen über die Verwendung gleichartiger Güter erforderlich. |
|
9.55 |
Die Verwendungstabelle der Inlandsproduktion ergibt sich dann durch Abzug der Importmatrix von der Verwendungstabelle der Gesamtwirtschaft. |
|
9.56 |
Theoretisch gibt es vier Grundmodelle für die Umwandlung einer Aufkommens- und Verwendungstabelle in eine symmetrische Input-Output-Tabelle. Diese Modelle arbeiten entweder mit Technologie-Annahmen oder festen Bezugsstruktur-Annahmen. Am häufigsten ist die Gütertechnologie-Annahme anzutreffen: Jedes Erzeugnis wird auf seine eigene spezielle Weise hergestellt, egal in welchem Wirtschaftsbereich es produziert wird. Anhand dieser Annahme wird oft eine Input-Output-Tabelle in Form einer Güter/Güter-Tabelle abgeleitet. Das zweite gängige Modell nimmt eine feste Liefer- und Bezugsstruktur der Gütergruppen an (Marktanteil-Annahme): Jedes Erzeugnis hat seine eigene spezielle Vertriebsstruktur, gleichgültig von welchem Wirtschaftsbereich es produziert wird. Dieser Ansatz führt zu einer Input-Output-Tabelle in Form einer Wirtschaftsbereich/Wirtschaftsbereich-Matrix. Auch Hybridmodelle, die diese Annahmen miteinander kombinieren, sind möglich. Modelle, die von der Wirtschaftsbereichstechnologie oder von der wirtschaftsbereichsbezogenen Bezugsstruktur ausgehen, sind weniger relevant, da sie in der Praxis mit geringer Wahrscheinlichkeit auftreten. Eine Erörterung der alternativen Modelle und Umwandlungsverfahren findet sich im Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables, Ausgabe 2008, Kapitel 11 (1). |
|
9.57 |
Es ist im Einzelfall nicht einfach, die jeweils beste Annahme zu treffen. Sie ist abhängig von der in einem Land üblichen Wirtschaftsstruktur, dem Spezialisierungsgrad und von der Homogenität der nationalen Technologien zur Herstellung gleicher Erzeugnisse und nicht zuletzt vom Detailgrad der Basisdaten. Eine einfache Anwendung des Gütertechnologie-Ansatzes kann zu inakzeptablen Ergebnissen führen, indem unwahrscheinliche oder gar unmögliche, zum Beispiel negative, Input-Output-Koeffizienten erzeugt werden können. Das kann an Messfehlern liegen. Es kann auch sein, dass der Gütermix im betreffenden Wirtschaftsbereich zu heterogen ist. Das lässt sich durch entsprechende Anpassungen anhand ergänzender Informationen oder durch möglichst gute Sachkenntnis korrigieren. Alternativ könnte von einer festen Güterbezugsstruktur ausgegangen werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass gemischte Technologieannahmen in Kombination mit ergänzenden Informationen am besten geeignet sind, symmetrische Input-Output-Tabellen zu berechnen. |
|
9.58 |
Die symmetrische Input-Output-Tabelle kann in zwei Tabellen untergliedert werden:
Die letztere Tabelle sollte benutzt werden, um kumulative Koeffizienten zu berechnen, d. h. die Leontief-Inverse ist die Inverse der Differenz zwischen der Einheitsmatrix und der Matrix der technischen Inputkoeffizienten der Vorleistungen aus der Tabelle der Inlandsproduktion. Die Leontief-Inverse lässt sich auch für Importe ableiten. Dabei sollte unterstellt werden, dass die Importe mit der gleichen Technologie produziert werden wie konkurrierende Güter im Inland. |
|
9.59 |
Die Aufkommens- und Verwendungstabellen und die symmetrischen Input-Output-Tabellen können als Werkzeuge der Wirtschaftsanalyse benutzt werden. Beide Tabellentypen haben unterschiedliche Vorzüge. Symmetrische Input-Output-Tabellen eignen sich ohne weiteres zur Berechnung nicht nur direkter, sondern auch indirekter und kumulativer Effekte. Sie können auch qualitativ gut sein, wenn Fachwissen und vielfältige statistische Informationen bei der Ableitung der Tabellen aus den Aufkommens- und Verwendungstabellen benutzt wurden. |
|
9.60 |
Wirtschaftsbereich/Wirtschaftsbereich-Tabellen sind nützlich, um wirtschaftsbereichsbezogene Analysen durchzuführen, beispielsweise Steuerreform, Folgenabschätzung, Fiskalpolitik und Währungspolitik. Sie sind auch näher an den verschiedenen statistischen Datenquellen. Güter/Güter-Tabellen eignen sich für Analysen homogener Produktionseinheiten, beispielsweise in Bezug auf Produktivität, Vergleich von Kostenstrukturen, beschäftigungspolitische Auswirkungen, Energiepolitik und Umweltpolitik. |
|
9.61 |
Die Güter/Güter-Matrix und die Wirtschaftsbereich/Wirtschaftsbereich-Matrix unterscheiden sich in ihren analytischen Eigenschaften nicht erheblich. Die Unterschiede sind in der Existenz einer im Umfang generell begrenzten Nebenproduktion begründet. In der Praxis unterstellen Input-Output-Tabellen stillschweigend stets auch eine Wirtschaftsbereichstechnologie, gleichgültig wie die Tabellen ursprünglich erstellt wurden. Außerdem ist eine Güter/Güter-Matrix in der Praxis immer auch eine überarbeitete Wirtschaftsbereich/Wirtschaftsbereich-Matrix, da alle Merkmale der Aufkommens- und Verwendungstabellen in Bezug auf institutionelle fachliche (und produzierende) Einheiten nach wie vor enthalten sind. |
|
9.62 |
Allgemein sind Aufkommens- und Verwendungstabellen und symmetrische Input-Output-Tabellen sind für viele Arten von Analysen geeignet, zum Beispiel für die
Ein Makromodell könnte auch lediglich die kumulierten Kostenanteilen einschließen, die aus den Input-Output-Tabellen errechnet werden. So werden die Informationen aus der Input-Output-Tabelle über direkte und indirekte Effekte, zum Beispiel Höhe der Arbeitskosten, Energieimporte für privaten Konsum oder Exporte, aus der Input-Output-Tabelle in das Makromodell überführt und stehen für analytische und prognostische Zwecke zur Verfügung. |
|
9.63 |
Für besondere Verwendungszweck können die Aufkommens- und Verwendungstabellen und die symmetrischen Input-Output-Tabellen durch die Einführung alternativer und zusätzlicher Klassifikationen modifiziert werden. Die wichtigsten Beispiele sind folgende:
|
(1) Eurostat, Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables (2008 edition), 2008, (abrufbar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
KAPITEL 10
PREIS- UND VOLUMENMESSUNG
|
10.01 |
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden die Strom- und Bestandsgrößen in Geldeinheiten gemessen. Die Geldeinheit ist der gemeinsame Nenner, der zur Bewertung der in dem Kontensystem erfassten äußerst unterschiedlichen Transaktionen und zur Errechnung aussagekräftiger Kontensalden verwendet wird. Die Verwendung von Geldeinheiten als Maßeinheiten bereitet Probleme, da die Preise weder stabil noch international vergleichbar sind. Ein Hauptanliegen der Wirtschaftsanalyse ist die Messung des volumenmäßigen (realen) Wirtschaftswachstums zwischen verschiedenen Zeiträumen. Daher muss die wertmäßige Änderung bestimmter Aggregate in eine Preiskomponente infolge von Preisänderungen und eine verbleibende Volumenkomponente aufgeteilt werden. Die Wirtschaftsanalyse befasst sich aber auch mit räumlichen Vergleichen, d. h. Vergleichen zwischen verschiedenen Volkswirtschaften. Im Mittelpunkt stehen dabei internationale Volumenvergleiche des Produktionsniveaus und der Einkommen sowie Vergleiche des Preisniveaus. Deshalb müssen die Unterschiede im Wert wirtschaftlicher Gesamtgrößen zwischen zwei Ländern bzw. Ländergruppen in eine Volumen- und eine Preiskomponente zerlegt werden. |
|
10.02 |
Bei zeitlichen Vergleichen von Strom- und Bestandsgrößen ist eine korrekte Messung der Preisänderungen ebenso wichtig wie die Messung der Volumenänderungen, denn kurzfristig ist die Preisbeobachtung ebenso interessant wie die Messung des Volumens von Angebot und Nachfrage. Bei längerfristigen Untersuchungen des Wirtschaftswachstums muss auch den Verschiebungen der Preisrelationen von Waren und Dienstleistungen Rechnung getragen werden. Es reicht aber nicht aus, die Preis- und Volumenänderungen wichtiger Aggregate zu erfassen, sondern es muss ein zusammenhängendes System von Indikatoren erstellt werden, das systematische und genaue Analysen von Inflation, Wirtschaftswachstum und Konjunkturschwankungen ermöglicht. |
|
10.03 |
Bei räumlichen Vergleichen müssen die Volumen- und die Preiskomponenten volkswirtschaftlicher Gesamtgrößen korrekt gemessen werden. Da bei räumlichen Preisvergleichen die Ergebnisse nach der Laspeyres-Formel häufig von denen nach der Paasche-Formel signifikant abweichen, ist für diesen Zweck nur die Fisher-Formel akzeptabel. |
|
10.04 |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen liefern einen geeigneten Rahmen für ein System von Volumen- und Preisindizes und sichern die Konsistenz der statistischen Daten. Die Vorteile eines Gesamtrechnungsansatzes können wie folgt zusammengefasst werden:
|
|
10.05 |
Trotz der Vorteile eines integrierten Systems, das — sowohl insgesamt als auch nach Wirtschaftsbereichen — auf abgestimmten Waren- und Dienstleistungstransaktionen basiert, genügen die so ermittelten Preis- und Volumenindizes nicht allen Anforderungen und können nicht alle Fragen zum Thema Preis- und Volumenänderungen beantworten. Buchungszwänge und die Wahl von Preis- und Volumenindexformeln sind zwar für die Entwicklung eines kohärenten Systems wesentlich, können sich aber manchmal als hinderlich erweisen. Es besteht auch Bedarf an Informationen über kürzere Zeiträume, z. B. Monate oder Quartale. In solchen Fällen können sich andere Arten von Preis- und Volumenindizes als zweckmäßig erweisen. |
ANWENDUNGSBEREICH VON PREIS- UND VOLUMENINDIZES IN DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN
|
10.06 |
Unter den in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nachgewiesenen Strömen in jeweiligen Preisen befinden sich einige, hauptsächlich Güter betreffende Ströme, bei denen in ähnlicher Weise zwischen Preisänderungen und Volumenänderungen unterschieden wird wie auf mikroökonomischer Ebene. Für viele andere Ströme ist diese Unterscheidung weniger naheliegend. Umfassen die Ströme eine Gruppe von Einzeltransaktionen mit Waren und Dienstleistungen, deren jeweiliger Wert durch Multiplikation der Anzahl der Mengeneinheiten mit dem Preis je Mengeneinheit berechnet werden kann, so werden lediglich Informationen darüber benötigt, in welche Komponenten sich der Strom untergliedert, um Preis- und Volumenänderungen im Zeitverlauf zu ermitteln. Umfasst ein Strom eine Reihe von Verteilungstransaktionen sowie Transaktionen im Zusammenhang mit finanzieller Mittlertätigkeit und mit Kontensalden wie die Wertschöpfung, so ist es schwierig oder sogar unmöglich, die jeweiligen Werte in Preis- und Volumenkomponenten zu zerlegen, so dass spezifische Lösungen gefunden werden müssen. Außerdem ist auch die Messung der realen Kaufkraft einiger Gesamtgrößen wie Arbeitnehmerentgelt, verfügbares Einkommen der privaten Haushalte oder Nationaleinkommen erforderlich. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass sie mit einem Index der Preise der Waren und Dienstleistungen deflationiert werden, die mit ihnen gekauft werden könnten. |
|
10.07 |
Bei der Messung der realen Kaufkraft des geschätzten Einkommens sind die Zielsetzung und das Verfahren der Deflationierung anders als bei den Güterströmen und den daraus abgeleiteten Salden. Für Güterströme kann ein integriertes System von Preis- und Volumenindizes entwickelt werden, das einen konsistenten Rahmen für die Messung des Wirtschaftswachstums liefert. Für die Messung der realen Kaufkraft von Einkommensströmen werden Preisindizes verwendet, die nicht unmittelbar mit dem Einkommensstrom verknüpft sind. So kann je nach dem verfolgten Zweck ein unterschiedlicher Preis für die Messung des Einkommenszuwachses gewählt werden: im integrierten System der Preis- und Volumenindizes ist dafür kein einheitlicher Preis festgelegt. |
Integriertes System der Preis- und Volumenindizes
|
10.08 |
Die Aufgliederung der Wertänderungen in Preis- und Volumenkomponenten beschränkt sich auf die Transaktionen, die im Güterkonto und im Rahmen der Aufkommens- und Verwendungsrechnung dargestellt werden. Sie erfolgt sowohl für die Daten in Wirtschaftsbereichs- und Gütergliederung als auch für die gesamtwirtschaftlichen Daten. Kontensalden wie die Wertschöpfung können nicht direkt in Preis- und Volumenkomponenten zerlegt werden, sondern nur indirekt anhand der für ihre Berechnung herangezogenen Transaktionen. Bei der Darstellung der Daten in einem Gesamtrechnungssystem müssen zwei Bedingungen erfüllt werden:
Eine dritte Bedingung, die sich nicht aus dem Gesamtrechnungssystem selbst ergibt, sondern auf einer bewussten Entscheidung beruht, verlangt, dass jede Änderung des Wertes einer Transaktion entweder einer Preisänderung oder einer Volumenänderung oder einer Kombination aus beiden zugeordnet werden muss. Sind diese drei Bedingungen erfüllt, so kann mit der preisbereinigten Darstellung der Positionen im Güterkonto und im Produktionskonto ein integriertes System von Preis- und Volumenindizes gewonnen werden. |
|
10.09 |
Im integrierten System der Preis- und Volumenindizes werden folgende Positionen berücksichtigt: Gütertransaktionen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Preis- und Volumenindizes
|
10.10 |
Neben den genannten Aggregaten können je nach Zielsetzung auch andere Gesamtgrößen in Preis- und Volumenkomponente unterteilt werden. Die Vorratsbestände am Anfang und am Ende eines Zeitraums müssen gegebenenfalls preisbereinigt werden, um zu den Bilanzaggregaten zu gelangen. Die Berechnung des preisbereinigten Bestands an Anlagegütern dient u. a. der Ermittlung von Kapitalkoeffizienten und der Berechnung der preisbereinigten Abschreibungen. Preisbereinigte Angaben zum Arbeitnehmerentgelt sind unter Umständen für Produktivitätsanalysen erforderlich bzw. in den Fällen, in denen der Produktionswert anhand von preisbereinigten Daten für Inputs bestimmt wird. Abschreibungen, sonstige Produktionsabgaben und sonstige Subventionen müssen bei der Berechnung der preisbereinigten Kosten ebenfalls preisbereinigt geschätzt werden. |
|
10.11 |
Das Arbeitnehmerentgelt ist Teil des Einkommens. Um die reale Kaufkraft des Einkommens zu messen, kann es mit einem Index deflationiert werden, der die Preise der Güter repräsentiert, die von den Arbeitnehmern gekauft werden könnten. Der Realwert auch anderer Einkommensarten, wie das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte oder das Nationaleinkommen, kann auf diese Weise berechnet werden. |
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER PREIS- UND VOLUMENMESSUNG
Definition von Preisen und Volumen marktbestimmter Güter
|
10.12 |
Volumen- und Preisindizes können nur für Variablen mit Preis- und Mengenelementen ermittelt werden. Die Begriffe „Preis“ und „Menge“ sind eng mit dem Begriff „homogene Güter“ verknüpft, d. h. Güter, für die Einheiten definiert werden können, die alle als äquivalent angesehen werden und die daher zum gleichen Geldwert getauscht werden können. Somit kann der Preis eines homogenen Gutes definiert werden als der Geldbetrag, zu dem eine einzelne Einheit des Gutes getauscht werden kann. Für jeden homogenen Güterstrom, z. B. den Produktionswert, können somit ein Preis (p), eine der Zahl der Einheiten entsprechende Menge (q) und ein Wert (v) definiert werden durch:
|
Qualität, Preis und homogene Güter
|
10.13 |
Ein homogenes Gut kann auch definiert werden als ein Gut, das aus Einheiten von gleicher Qualität besteht. Homogene Güter spielen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eine wesentliche Rolle. Die Produktion wird zum Herstellungspreis bewertet, der am Markt zum Zeitpunkt der Herstellung, also sehr häufig vor dem Verkauf, zu beobachten ist. Daher müssen die produzierten Einheiten nicht zu dem Preis bewertet werden, zu dem sie irgendwann tatsächlich verkauft werden, sondern zu dem Preis, zu dem äquivalente Einheiten zum Zeitpunkt der Produktion der betreffenden Einheiten verkauft werden. Diese Bewertung kann nur bei homogenen Gütern stringent durchgeführt werden. |
|
10.14 |
In der Praxis können jedoch zwei Einheiten eines Gutes mit identischen physischen Merkmalen aus zweierlei Gründen zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden:
Somit kann ein homogenes Gut auch definiert werden als ein Gut, dessen sämtliche Einheiten im vollständigen Wettbewerb zum gleichen Preis verkauft würden. Ist vollständiger Wettbewerb nicht gegeben, wird der Preis des homogenen Gutes anhand des Durchschnittspreises seiner Einheiten bestimmt. Daher wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen jedem homogenen Gut jeweils nur ein einziger Preis zugeordnet, so dass bei der Bewertung von Gütern allgemeine Regeln angewandt werden können. |
|
10.15 |
Preisdifferenzen infolge eines Informationsdefizits liegen vor, wenn ein Käufer nicht die verschiedenen Preise kennt und so unbeabsichtigt einen höheren Preis zahlt. Gleiches gilt, wenn einzelne Käufer oder Verkäufer um den Preis handeln bzw. feilschen. Die Differenz des Durchschnittspreises eines Guts auf Märkten, auf denen normalerweise gehandelt wird, wie etwa auf einem Basar, zum Preis des gleichen Guts in einer anderen Handelseinrichtung, z. B. einem Kaufhaus, wird dagegen den Verkaufsbedingungen und somit der Qualitätskomponente zugerechnet. |
|
10.16 |
Preisdifferenzierung in der Form von Preisdiskriminierung liegt vor, wenn es dem Verkäufer gelingt, verschiedene Käufergruppen zu bilden, an die identische Erzeugnisse unter identischen Bedingungen zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Die Käufer haben in solchen Fällen keine bzw. nahezu keine Möglichkeit, zwischen den unterschiedlichen Preisen zu wählen. Wenn also infolge der Preisdiskriminierung für identische Erzeugnisse unter identischen Bedingungen auf klar abgegrenzten Märkten Preisdifferenzen existieren, d. h. wenn für das gleiche homogene Gut unterschiedliche Preise in Rechnung gestellt werden, so gilt das als Preis- und nicht als Volumenunterschied. Wenn dagegen bei Preisdifferenzierung die Waren weiterverkauft werden können, spricht das gegen Preisdiskriminierung. Die unterschiedlichen Preise erklären sich vielmehr aus Informationsmängeln bzw. aus Parallelmärkten. Für bestimmte Dienstleistungen, wie z. B. bei Verkehrsleistungen, gelten für einzelne Personengruppen mit geringem Einkommen, wie Rentner oder Studenten, mitunter geringere Preise. Wenn solche Personen die Verkehrsleistung jederzeit in Anspruch nehmen können, gilt das als Preisdiskriminierung. Wenn sie jedoch nur zu bestimmten Zeiten außerhalb der Spitzenzeiten verbilligt reisen können, gilt das als qualitativ geringwertigere Verkehrsleistung, da Verkehrsleistungen, die an Bedingungen geknüpft sind und Verkehrsleistungen, die ohne Bedingungen erbracht werden, als unterschiedliche homogene Güter betrachtet werden können. |
|
10.17 |
Für Preisdifferenzierung auf Parallelmärkten gibt es verschiedene Gründe. So kann das Angebot zum geringen Preis mengenmäßig eingeschränkt sein, so dass zusätzliche Mengen nur zu höheren Preisen verfügbar sind. Parallelmärkte können sich auch aus der Möglichkeit heraus bilden, dass Anbieter auf bestimmten Märkten niedrigere Preise fordern können, weil sie die Zahlung bestimmter Steuern vermeiden können. |
|
10.18 |
Wenn also Qualität durch alle gemeinsamen Merkmale aller Einheiten eines homogenen Gutes definiert wird, sind Qualitätsunterschiede durch folgende Faktoren bedingt:
|
Preise und Volumen
|
10.19 |
Die Einführung des Volumenbegriffs in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen geht auf den Wunsch zurück, den Effekt von Preisänderungen in der in Geldeinheiten ausgedrückten Wertstruktur auszuschalten, und ist somit als Erweiterung des für Gütergruppen geltenden Mengenbegriffs zu betrachten. Tatsächlich kann die Veränderung eines Wertes im Zeitverlauf für ein gegebenes homogenes Gut mit Hilfe der Gleichung
|
|
10.20 |
Es gibt indessen ein einfaches Verfahren zur Aufgliederung der Wertänderung einer Gruppe homogener Güter zwischen zwei Zeiträumen, von denen der eine die Basisperiode, der andere die Berichtsperiode darstellt. Der Effekt der Preisänderung kann ausgeschaltet werden, indem berechnet wird, welchen Wert die Gütergruppe gehabt hätte, wenn keine Preisänderung stattgefunden hätte, d. h. indem die Preise der Basisperiode an die Mengen der Berichtsperiode angelegt werden. Dieser Wert zu Preisen der Basisperiode definiert den Volumenbegriff. Somit kann der Wert einer Gütergruppe in der Berichtsperiode durch
beschrieben werden, wobei sich der Exponent 1 auf die Berichtsperiode und der Index i auf ein bestimmtes homogenes Gut bezieht. Das Volumen der Gütergruppe in der Berichtsperiode wird so im Verhältnis zur Basisperiode definiert durch
wobei sich der Exponent 0 auf die Basisperiode bezieht. Durch Vergleich des Volumens der Gütergruppe in der Berichtsperiode mit ihrem Gesamtwert in der Basisperiode kann eine Veränderung gemessen werden, in die keine Preisänderung eingeflossen ist. Ein Volumenindex lässt sich daher mit folgender Formel berechnen:
Der so definierte Volumenindex ist ein Laspeyres-Mengenindex, in dem jeder Basisindex mit dem Anteil des Basisprodukts am Gesamtwert der Basisperiode gewichtet wird. Nach der Definition des Volumenbegriffs kann analog zur Gleichung
Dieser Index ist ein Paasche-Preisindex, in dem jeder Basispreisindex mit dem Anteil des Basisprodukts am Gesamtwert der Berichtsperiode gewichtet wird. Die so definierten Volumen- und Preisindizes beweisen die Gleichung: Wertindex = Preisindex × Volumenindex Diese Gleichung ist eine allgemeinere Fassung der Gleichung Bei der Berechnung des Volumens werden die Mengen mit den Preisen der Basisperiode gewichtet, so dass das Ergebnis von der Preisstruktur abhängt. Änderungen der Preisstruktur dürften sich über kurze Zeiträume weniger stark auswirken als über längere Zeiträume. Daher wird das Volumen nur für zwei aufeinanderfolgende Jahre, d. h. zu den Preisen des Vorjahres berechnet. Für längerfristige Vergleiche werden die Laspeyres-Volumenindizes und Paasche-Preisindizes zunächst auf das Vorjahr bezogen berechnet, dann werden die Kettenindizes ermittelt. |
|
10.21 |
Hauptvorteile der Verwendung von Paasche-Preisindizes und Laspeyres-Volumenindizes sind die Einfachheit der Auslegung und Berechnung sowie die Additivität in den Aufkommens- und Verwendungstabellen. |
|
10.22 |
Verkettete Indizes haben den Nachteil, dass die damit berechneten Volumen nicht additiv sind, so dass sie bei der Abstimmung der Aufkommens- und Verwendungstabellen nicht verwendet werden können. |
|
10.23 |
Die mit Kettenindizes berechneten nicht additiven Volumenangaben sind ohne jegliche Anpassungen zu veröffentlichen. Diese Methode ist transparent und lässt die Nutzer den Umfang des Problems erkennen. Unter bestimmten Umständen kann es jedoch zweckmäßig erscheinen, die Diskrepanzen zu beseitigen, um die Gesamtkonsistenz der Daten zu erhalten. Wenn die Werte des Referenzjahres mit Kettenvolumenindizes fortgeschrieben werden, muss den Datennutzern erläutert werden, warum die Ergebnisse in den Tabellen infolge der Verkettung nicht mehr additiv sind. |
|
10.24 |
Da es unmöglich ist, die Preise und Mengen aller homogenen Güter einer Volkswirtschaft zu messen, werden in der Praxis Volumen- oder Preisindizes anhand von Stichproben repräsentativer homogener Güter berechnet, wobei unterstellt wird, dass sich die Volumen oder Preise der nicht in die Stichprobe einbezogenen Güter in der gleichen Weise verändern wie die des Stichprobendurchschnitts. Daher sollte unabhängig von der Darstellungstiefe eine möglichst tief untergliederte Güterklassifikation verwendet werden, so dass die einzelnen Güter möglichst homogen sind. |
|
10.25 |
Da die Gleichung Wert-, Preis- und Volumenindizes verknüpft, müssen nur zwei Indizes berechnet werden. In der Regel ergibt sich der Wertindex direkt aus einem einfachen Vergleich der Gesamtwerte für die Berichtsperiode und die Basisperiode. Danach gilt es nur noch zu entscheiden, ob ein Preisindex oder ein Volumenindex berechnet werden soll. In den meisten Fällen wird die der Methode zugrunde liegende Annahme der parallel verlaufenden Änderung eher durch die Preise bestätigt als durch die Volumen, da die Preise unterschiedlicher Güter oftmals ganz erheblich durch bestimmte gemeinsame Faktoren beeinflusst werden, etwa durch Rohstoff- und Lohnkosten. In diesem Fall ist der Preisindex anhand einer Stichprobe aus Gütern von im Zeitablauf gleichbleibender Qualität zu berechnen, wobei Qualität nicht nur durch die physischen Merkmale des Gutes bestimmt wird, sondern auch durch die Verkaufsbedingungen, wie vorstehend erläutert. Auf diese Weise erscheinen alle durch strukturelle Änderungen bei den verschiedenen Gütern verursachten Änderungen des Gesamtwertes als Volumen-, nicht als Preisänderungen. In einigen Fällen kann es allerdings leichter sein, einen Volumenindex zu berechnen und daraus einen Preisindex abzuleiten. Gelegentlich könnte es sogar vorzuziehen sein, den Wertindex auf der Basis eines Preisindex und eines Volumenindex zu berechnen. |
Neue Güter
|
10.26 |
Bei der vorstehend umrissenen Methode der Berechnung von Preis- und Volumenindizes wird davon ausgegangen, dass die Güter in jeweils zwei aufeinanderfolgenden Jahren existieren. Tatsächlich kommen jedoch von einem Jahr zum anderen viele Produkte neu auf den Markt oder verschwinden wieder vom Markt, und dies muss in den Preis- und Volumenindizes berücksichtigt werden. Wird das Volumen anhand der Vorjahrespreise definiert, so ergeben sich keine besonderen Schwierigkeiten im Fall von Gütern, die es im Vorjahr noch gab, im Berichtsjahr jedoch nicht mehr, denn ihnen wird für das Berichtsjahr einfach die Menge Null zugeordnet. Schwieriger ist das Problem im Fall neuer Güter, da es hier nicht möglich ist, für das Vorjahr den Preis eines nicht existierenden Produktes zu messen. In einem solchen Fall gibt es zweierlei Methoden der Preisschätzung für das Vorjahr: Bei der ersten wird davon ausgegangen, dass die Preisänderung eines neuen Gutes der Preisänderung vergleichbarer Güter entspricht, bei der zweiten wird versucht, direkt zu berechnen, welches der Preis eines neuen Gutes gewesen wäre, wenn es dieses bereits in der Basisperiode gegeben hätte. Bei der ersten Methode wird einfach ein Preisindex verwendet, der anhand einer Stichprobe homogener Güter, die es in den zwei aufeinanderfolgenden Jahren gab, berechnet wird; in der Praxis wird diese Methode für die meisten neuen Güter angewandt, denn ihre Zahl ist im Allgemeinen zu groß, als dass sie einzeln erfasst werden könnten, insbesondere bei strikter Anwendung der Definition homogener Güter. Bei dem zweiten Ansatz wird zumeist mit der hedonischen Methode gearbeitet, bei der der Preis eines Gutes anhand seiner wichtigsten Eigenschaften bestimmt wird, oder mit der Inputmethode, bei der der Preis anhand der Produktkosten berechnet wird. Das Problem der neuen Güter ist in bestimmten Bereichen von besonderer Bedeutung. So werden viele Anlagegüter nur als Einzelfertigung hergestellt und erscheinen daher als neue Güter. Dies trifft auch auf zahlreiche Dienstleistungen zu, die niemals auf genau dieselbe Weise erbracht werden, etwa im Bereich Forschung und Entwicklung. |
|
10.27 |
Bei Dienstleistungstransaktionen ist es oft schwieriger, die Merkmale zu spezifizieren, die die Mengeneinheiten bestimmen, auch kann es hier unterschiedliche Auffassungen über die Kriterien geben. Diese Schwierigkeit kann die Dienstleistungen wichtiger Wirtschaftsbereiche betreffen, wie die der Kreditinstitute, des Groß- und Einzelhandels oder Dienstleistungen für Unternehmen, für Bildung, Forschung und Entwicklung sowie für Gesundheit und Unterhaltung. Die Auswahl der Mengeneinheiten für diese Tätigkeiten wird im Handbuch zur Preis- und Volumenmessung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (1) dargestellt. |
Grundsätze für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen
|
10.28 |
Das System von Preis- und Volumenindizes, das das gesamte Aufkommen und die gesamte Verwendung von Gütern umschließt, bereitet bei der Erfassung des Wertes der nichtmarktbestimmten Dienstleistungen besondere Schwierigkeiten. Anders als bei Marktdienstleistungen gibt es für solche Dienstleistungen keine Marktpreise, so dass ihr Wert in jeweiligen Preisen als Summe der Produktionskosten ermittelt wird. Dazu zählen die Vorleistungen, das Arbeitnehmerentgelt, die sonstigen Produktionsabgaben abzüglich der sonstigen Subventionen sowie die Abschreibungen. |
|
10.29 |
In Ermangelung eines Marktpreises können die Stückkosten einer nichtmarktbestimmten Dienstleistung als Preisäquivalent angesehen werden. Tatsächlich entspricht der Preis eines marktbestimmten Gutes den Ausgaben, die der Käufer tätigen muss, um in den Besitz des Gutes zu gelangen, während die Stückkosten einer nichtmarktbestimmten Dienstleistung den Ausgaben entsprechen, die die Gesellschaft tragen muss, um in den Genuss der Leistung zu kommen. Wenn es also möglich ist, Mengeneinheiten nichtmarktbestimmter Dienstleistungen zu definieren, können auch die vorstehend genannten allgemeinen Grundsätze für die Berechnung von Volumen- und Preisindizes angewandt werden. Bei individualisierbaren, nichtmarktbestimmten Dienstleistungen, z. B. Bildungs- und Gesundheitsleistungen, können im Allgemeinen Mengeneinheiten definiert werden, daher sind hier die allgemeinen Grundsätze routinemäßig anzuwenden. Die Methode, bei der zur Berechnung des Volumens die Stückkosten des Vorjahres auf die Mengen des Berichtsjahres angewandt werden, wird als Outputmethode bezeichnet. |
|
10.30 |
Bei kollektiven nichtmarktbestimmten Dienstleistungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Staat, Justiz oder Verteidigung, lassen sich dagegen nur schwer Mengeneinheiten ermitteln. Daher muss in diesem Fall ein anderes Vorgehen analog zur allgemeinen Methode gewählt werden. Bei dieser Methode wird das Volumen anhand der Vorjahrespreise definiert, d. h. als die Ausgaben, die den Käufern entstanden wären, wenn sich die Preise nicht verändert hätten. Diese letztgenannte Definition kann verwendet werden, wenn keine Mengeneinheit ermittelt werden kann, vorausgesetzt, sie wird nicht auf eine Einheit des Gutes, sondern auf die Ausgaben insgesamt angewandt. Da sich der Wert einer nichtmarktbestimmten Dienstleistung durch ihre Kosten bestimmt, ist es somit möglich, das Volumen anhand des Wertes der Kosten zu Preisen der Basisperiode zu berechnen, also anhand des zu Preisen der Basisperiode ausgedrückten Wertes der Vorleistungen, des Arbeitnehmerentgelts, der sonstigen Produktionsabgaben abzüglich der sonstigen Subventionen sowie der Abschreibungen. Diese Methode wird als Inputmethode bezeichnet. Die jeweils preisbereinigte Berechnung des Arbeitnehmerentgelts, der Abschreibungen sowie der Produktionsabgaben und Subventionen wird nachstehend beschrieben. Sogar im günstigsten Fall der individualisierbaren nichtmarktbestimmten Dienstleistungen, etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich, ist es nicht immer leicht, homogene Güter zu unterscheiden. Die Merkmale solcher Dienstleistungen sind nämlich nur selten so genau definiert, dass mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob zwei unterschiedliche Leistungseinheiten als äquivalent betrachtet können oder nicht, d. h. ob sie ein und demselben homogenen Gut oder zwei getrennten Gütern entsprechen. Die Gesamtrechner können zwei Äquivalenzkriterien anwenden:
Da das Ergebniskriterium oft aussagekräftiger zu sein scheint, wurde viel unternommen, um Methoden zu entwickeln, die auf diesem Kriterium basieren. An ihrer Verbesserung wird weiter gearbeitet. In der Praxis bestehen solche Methoden häufig darin, in die Volumenberechnung Berichtigungskoeffizienten für die Mengen einzuführen. Sie werden dann als Methoden mit expliziter Qualitätsanpassung bezeichnet. Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung solcher Methoden hängt mit der Definition und Messung des Ergebnisses zusammen. Die Messung des Ergebnisses setzt nämlich die Definition von Zielen voraus, was bei den nichtmarktbestimmten Dienstleistungen nicht so einfach ist. Welche Ziele verfolgt beispielsweise der öffentliche Gesundheitsdienst: die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung oder die Verlängerung der Lebensdauer? Sicher beides, aber wie soll man verschiedene Ziele bewerten, wenn sie nicht äquivalent sind? Welches ist etwa die beste Behandlung, diejenige, die es möglich macht, ein zusätzliches Jahr bei guter Gesundheit zu leben, oder diejenige, die es möglich macht, zwei zusätzliche Jahre bei schlechter Gesundheit zu leben? Hinzu kommt, dass Ergebnisschätzungen oft kontrovers sind. So kommt es in vielen Ländern immer wieder zu gegensätzlichen Auffassungen über die Verbesserung oder Verschlechterung der schulischen Leistungen. In der Europäischen Union wurden diese Methoden in Anbetracht der konzeptionellen Schwierigkeiten und weil noch keine Einigung über Outputmethoden mit Qualitätsanpassung (auf der Grundlage des Ergebnisses) erzielt wurde, nicht in das Kernsystem aufgenommen, damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewahrt bleibt. Solange noch an den Methoden gearbeitet wird, können diese Methoden lediglich fakultativ für Zusatztabellen verwendet werden. Im Bereich der nichtmarktbestimmten Gesundheits- und Bildungsleistungen etwa müssen die geschätzten Produktions- und Verbrauchsvolumen anhand direkter Outputmessungen — ohne Qualitätsanpassung — berechnet werden, indem die produzierten Mengen zu Vorjahresstückkosten dieser Dienstleistungen ohne jegliche Korrektur zur Berücksichtigung der Qualität bewertet werden. Solche Methoden müssen auf einer hinreichend tiefen Gliederungsebene angewandt werden; die Mindestgliederungstiefe ist dem von Eurostat herausgegebenen Handbuch zur Preis- und Volumenmessung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu entnehmen. Die Verwendung inputbasierter Methoden ist im Allgemeinen zwar zu vermeiden, im Gesundheitsbereich kann die Inputmethode jedoch angewandt werden, wenn die Dienstleistungen so vielfältig sind, dass es praktisch unmöglich ist, homogene Güter zu bestimmen. Außerdem sind die Schätzungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit Erläuterungen zu versehen, in denen die Nutzer auf die Messmethoden hingewiesen werden. |
Grundsätze für die Wertschöpfung und das Bruttoinlandsprodukt
|
10.31 |
Die Wertschöpfung, der Kontensaldo des Produktionskontos, ist der einzige Saldo, der Teil des integrierten Systems von Preis- und Volumenindizes ist. Es muss jedoch auf die ganz spezifischen Merkmale dieses Postens und den Aussagewert der damit zusammenhängenden Volumen- und Preisindizes hingewiesen werden. Anders als die Waren- und Dienstleistungsströme stellt die Wertschöpfung keine Transaktionskategorie dar. Sie kann deshalb auch nicht direkt in eine Preis- und eine Volumenkomponente untergliedert werden. |
|
10.32 |
Definition: Die preisbereinigte Wertschöpfung wird definiert als Differenz zwischen dem preisbereinigten Produktionswert und den preisbereinigten Vorleistungen. Es gilt:
Dabei sind P und Q Preise und Mengen des Produktionswerts und p und q Preise und Mengen der Vorleistungen. Die theoretisch korrekte Methode zur Berechnung der preisbereinigten Wertschöpfung wird doppelte Deflationierung genannt, also die getrennte Deflationierung der beiden Ströme des Produktionskontos (Produktionswert und Vorleistungen) und die Bildung des Saldos dieser beiden umbewerteten Ströme. |
|
10.33 |
Wenn die statistischen Daten unvollständig oder nicht ausreichend zuverlässig sind, muss ein einziger Indikator verwendet werden. So kann etwa eine verlässlich ermittelte Wertschöpfung zu jeweiligen Preisen alternativ zur doppelten Deflationierung mit dem Preisindex des Produktionswerts deflationiert werden. Implizit wird dabei unterstellt, dass sich die Vorleistungspreise im gleichen Maß ändern wie die Erzeugerpreise. Ein weiteres mögliches Verfahren ist die Fortschreibung der Wertschöpfung des Basisjahres mit einem Volumenindex für den Produktionswert. Dieser Volumenindex kann entweder direkt mit Hilfe von Mengendaten oder durch Deflationierung des jeweiligen Produktionswerts mit einem geeigneten Preisindex berechnet werden. Dabei wird angenommen, dass die Volumenänderungen der Produktionswerte und der Vorleistungen gleich sind. Für einige marktbestimmte und nichtmarktbestimmte Dienstleistungsbereiche, wie das Kreditwesen, Unternehmensdienstleistungen oder Verteidigung, ist es unter Umständen nicht möglich, die Preis- und Volumenänderung befriedigend zu messen. Dann kann die Veränderung der preisbereinigten Wertschöpfung anhand der Veränderung des Arbeitnehmerentgelts in Vorjahreslohnsätzen und der preisbereinigten Abschreibungen geschätzt werden. Derartige Hilfslösungen müssen die Gesamtrechner selbst dann akzeptieren, wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Arbeitsproduktivität kurz- oder langfristig konstant bleibt. |
|
10.34 |
Es liegt somit im Wesen der Preis- und Volumenindizes für die Wertschöpfung, dass sie sich von den entsprechenden Indizes für die Waren- und Dienstleistungsströme unterscheiden. Dasselbe gilt für Preis- und Volumenindizes von Gesamtsalden wie dem Bruttoinlandsprodukt. Der Wert des Letzteren entspricht der Summe der Wertschöpfungen aller Wirtschaftsbereiche — d. h. der Summe der Kontensalden — plus den Gütersteuern abzüglich der Gütersubventionen. Von der Ausgabenseite betrachtet ist das Bruttoinlandsprodukt gleich dem Saldo zwischen der gesamten letzten Verwendung und den Importen. |
SPEZIFISCHE PROBLEME BEI DER ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE
|
10.35 |
Obwohl sich das integrierte System der Preis- und Volumenindizes primär auf Gütertransaktionen bezieht, können auch einige andere Transaktionsarten in eine Preis- und Volumenkomponente aufgeteilt werden. |
Gütersteuern und Gütersubventionen
|
10.36 |
Die vorstehend genannte Möglichkeit besteht insbesondere bei Gütersteuern und Gütersubventionen, die sich direkt auf die Menge oder den Wert von Waren oder Dienstleistungen beziehen und Bestandteil bestimmter Transaktionen werden. In den Aufkommens- und Verwendungstabellen werden die Beträge der Gütersteuern und Gütersubventionen explizit ausgewiesen. Nach den unten beschriebenen Regeln können die im Güterkonto ausgewiesenen Steuern und Subventionen in eine Preis- und eine Volumenkomponente aufgeteilt werden, nämlich die
|
|
10.37 |
Am einfachsten ist es, wenn die Steuer als fester Betrag je Mengeneinheit des besteuerten Gutes erhoben wird. Dann hängt die Steuerzahlung ab von
Hier bereitet die Aufteilung in die beiden Komponenten keinerlei Probleme. Die Volumenkomponente wird durch die Mengenänderungen des besteuerten Gutes bestimmt. Die Preiskomponente entspricht der Veränderung des Steuertarifs. |
|
10.38 |
Häufiger wird die Steuer als Prozentsatz des Wertes eines Gutes erhoben. Dann hängt die Steuerzahlung ab von
Die Preiskomponente der Steuer ergibt sich aus dem Steuersatz und dem Preis des Gutes. Der zu zahlende Steuerbetrag kann in eine Volumenkomponente entsprechend der mengenmäßigen Änderung des besteuerten Gutes und eine Preiskomponente aufgeteilt werden, die die Preis- und die Steuersatzänderung (b × c) umfasst. |
|
10.39 |
Das Volumen der sonstigen Gütersteuern (D212 und D.214) und der Importabgaben (D.212) wird ermittelt, indem entweder der Steuersatz des Basisjahres an die Menge der produzierten bzw. importierten besteuerten Güter gelegt wird oder indem der Steuersatz des Basisjahres an den Wert der besteuerten Güter (aus inländischer Produktion oder aus dem Import) umbewertet auf Preise des Basisjahres gelegt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Besteuerung von der Art der Verwendung der Güter abhängen kann, die aus den Aufkommens- und Verwendungstabellen hervorgeht. |
|
10.40 |
Entsprechend wird das Volumen der Gütersubventionen (D.31) bestimmt, indem der Subventionsmessbetrag des Basisjahres auf die Menge der subventionierten Güter aus der Inlandsproduktion oder Einfuhr angelegt wird oder indem der Wert der subventionierten Güter umbewertet auf Preise des Basisjahres mit dem Subventionssatz des Basisjahres multipliziert wird. Auch hier ist der Verwendung der Güter Rechnung zu tragen. |
|
10.41 |
Die auf den Gütern lastende Mehrwertsteuer (D.211) der Volkswirtschaft und der verwendenden Bereiche ist eine Differenzgröße und umfasst nur die nichtabziehbare Mehrwertsteuer. Sie ergibt sich aus der in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer abzüglich der abziehbaren Mehrwertsteuer. Sie ist gleich der von den Käufern bezahlten Mehrwertsteuer, d. h. dem Anteil der Mehrwertsteuer, der nicht als Vorsteuer von der Mehrwertsteuerschuld der Käufer abziehbar ist. Die preisbereinigte nichtabziehbare Mehrwertsteuer kann berechnet werden, indem der Steuersatz des Vorjahres an die besteuerten Güter umbewertet auf Vorjahrespreisen gelegt wird. Steuersatzänderungen im laufenden Jahr gehen damit in die Preis- und nicht in die Volumenkomponente der Steuer ein. Der Anteil der abziehbaren bzw. nichtabziehbaren Mehrwertsteuer an der in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer kann sich ändern,
Rechtliche Änderungen in der Abzugsfähigkeit der Mehrwertsteuer wie auch Änderungen des Mehrwertsteuersatzes schlagen sich nach der hier beschriebenen Methode in der Preiskomponente nieder. Auswirkungen aus Verwendungsänderungen der besteuerten Güter auf die Höhe der abziehbaren Mehrwertsteuer werden dagegen der Volumenkomponente der Mehrwertsteuer zugerechnet. |
Sonstige Produktionsabgaben und sonstige Subventionen
|
10.42 |
Die Behandlung der sonstigen Produktionsabgaben (D.29) und der sonstigen Subventionen (D.39) bereitet besondere Schwierigkeiten, da es definitionsgemäß nicht möglich ist, diese Positionen direkt den produzierten Einheiten zuzuordnen. Im Falle der nichtmarktbestimmten Dienstleistungen wird diese Schwierigkeit dadurch noch verschärft, dass sie nur dann verwendet werden, wenn keine Mengeneinheiten definiert werden können. Im Allgemeinen kann dieses Problem jedoch umgangen werden, indem preisbereinigte sonstige Produktionsabgaben und sonstige Subventionen anhand des Betrags definiert werden, auf den sie sich belaufen hätten, wenn es nicht zu einer Änderung der Steuervorschriften und der Preise insgesamt gegenüber dem Vorjahr gekommen wäre. So können beispielsweise Vermögenssteuern oder Steuern auf die Nutzung von Vermögensgütern preisbereinigt bewertet werden, indem die Vorschriften und der Preis der Vermögensgüter in des Vorjahres auf die Berichtsperiode angewandt werden. |
Abschreibungen
|
10.43 |
Die Volumenentwicklung der Abschreibungen in konstanten Preisen können relativ einfach berechnet werden, wenn ausreichende Informationen über die Zusammensetzung des Anlagevermögens verfügbar sind. Nach der in den meisten Ländern verwendeten Kumulationsmethode (perpetual inventory method) werden die Abschreibungen in jeweiligen Preisen aus Angaben über das preisbereinigte Anlagevermögen ermittelt. Um von der Bewertung zu historischen Anschaffungspreisen zu Angaben in laufenden Wiederbeschaffungspreisen zu gelangen, müssen zuerst die Zugänge zum Anlagevermögen der zurückliegenden Jahre einheitlich in den Preisen eines Basisjahres bewertet werden. Die sich dabei ergebenden Preis- und Volumenindizes können zur Berechnung der Abschreibungen preisbereinigt und in jeweiligen Preisen genutzt werden. Wenn die Kumulationsmethode nicht angewandt wird, müssen die Abschreibungen zu Anschaffungspreisen mit Preisindizes der Anlageinvestitionen deflationiert werden, wobei allerdings die altersmäßige Zusammensetzung des Anlagevermögens zu beachten ist. |
Arbeitnehmerentgelt
|
10.44 |
Zur Messung des Volumens Mengeneinheit des Arbeitseinsatzes kann die geleistete Arbeitsstunde als Mengeneinheit dienen, wobei die Art und die Qualität der Arbeit zu berücksichtigen sind. Wie auch bei den Gütern muss die qualitative Abstufung der Arbeit berücksichtigt und für jede Art die mengenmäßige Veränderung berechnet werden. Der Preis jeder Arbeitsart wird durch das Arbeitnehmerentgelt je Stunde gebildet, das sich natürlich nach den Arbeitsarten unterscheiden kann. Das Volumen der geleisteten Arbeit kann als gewichteter Durchschnitt der Messziffern der einzelnen Arbeitsarten berechnet werden, wobei das Arbeitsentgelt je Stunde des Vorjahres oder eines festen Basisjahres als Gewichtung verwendet wird. Alternativ kann ein Lohnsatzindex berechnet werden, der die gewichtete Veränderung der Arbeitnehmerentgelte je Stunde und Arbeitsart misst. Wenn ein Laspeyres-Volumenindex durch Deflationierung des jeweiligen Arbeitnehmerentgelts berechnet wird, sollte der Lohnsatzindex nach der Paasche-Formel ermittelt werden. |
Anlagevermögen und Vorräte
|
10.45 |
Sowohl das Anlagevermögen als auch die Vorratsbestände müssen anhand von Volumenangaben in Preisen des Vorjahres berechnet werden. Das Anlagevermögen in Preisen des Vorjahres wird u. a. für Produktivitätsanalysen benötigt. Es ergibt sich automatisch nach der Kumulationsmethode. Andernfalls müssen Angaben der Produzenten über den Wert des Anlagevermögens mit Preisindizes der Anlageinvestitionen deflationiert werden, wobei die altersmäßige Zusammensetzung des Anlagevermögens zu beachten ist. Die Vorratsveränderungen ergeben sich aus den Zugängen abzüglich der Abgänge und sonstiger Verluste an Vorratsgütern während des Zeitraums. Die Volumen zu Vorjahrespreisen können durch Deflationierung dieser Komponenten ermittelt werden. In der Praxis sind jedoch Vorratszugänge und -abgänge nur selten tatsächlich bekannt, und oftmals liegen nur Angaben über den Wert der Vorräte zu Beginn und am Ende des Zeitraums vor. In solchen Fällen muss von regelmäßigen Zu- und Abgängen während der Berichtsperiode ausgegangen werden, so dass der Durchschnittspreis des Zeitraums sowohl für Zugänge als auch für Abgänge als relevant gelten kann. Unter diesen Umständen entspricht die Berechnung der Vorratsveränderung als Differenz zwischen Zu- und Abgängen der Berechnung der Differenz zwischen den Werten der Anfangs- und Endbestände. Die preisbereinigte Vorratsveränderung kann dann berechnet werden, indem die Anfangs- und Endbestände deflationiert werden, um sie mit dem Durchschnittspreis der Basisperiode in Einklang zu bringen. Wenn die mengenmäßigen Vorratsveränderungen bekannt sind, kann, wiederum ausgehend von regelmäßigen Zu- und Abgängen, das Volumen der Vorratsveränderung berechnet werden, indem der Durchschnittspreis der Basisperiode auf die mengenmäßige Vorratsveränderung angewandt wird. |
REALEINKOMMMEN DER VOLKSWIRTSCHAFT
|
10.46 |
Da Einkommen im Allgemeinen nicht in eine Preis- und eine Mengenkomponente aufgeteilt werden können, können diese Komponenten nicht in der gleichen Weise gemessen werden wie die Güterströme und -bestände. Der Realwert des Einkommens kann nur anhand eines Güterkorbes gemessen werden, für den das Einkommen normalerweise ausgegeben wird. Der Preisindex dieses Korbes kann zur Deflationierung des jeweiligen Einkommens verwendet werden. Die Wahl ist insofern willkürlich, als Einkommen meist nicht vollständig in der Periode ausgegeben werden. Teile werden gespart, um später für Käufe ausgegeben zu werden. Andererseits ist es möglich, dass Käufe in der Periode aus früher erzielten Einkommen, also auch Ersparnissen, finanziert werden. |
|
10.47 |
Das Bruttoinlandsprodukt in Vorjahrespreisen misst das Volumen der gesamten Produktion in der Volkswirtschaft nach Abzug der Vorleistungen. Das Realeinkommen der Volkswirtschaft wird nicht nur durch dieses Produktionsvolumen bestimmt, sondern auch durch das Preisverhältnis, mit dem importierte Güter getauscht werden können. Wenn sich die Terms of Trade (also die Relation der Exportpreise zu den Importpreisen) verbessern, muss weniger exportiert werden, um die gleiche Gütermenge zu importieren, so dass bei gleichem Produktionsvolumen zusätzliche Güter konsumiert oder investiert werden können. Der Realwert des Bruttoinlandsprodukts ergibt sich durch Hinzurechnung des Terms-of-Trade-Effekts zum Bruttoinlandsprodukt. Dieser Effekt kann positiv oder negativ sein, da Folgendes gilt:
Das ist der Außenbeitrag (X – M) in jeweiligen Preisen, deflationiert mit einem Preisindex P, abzüglich des Außenbeitrags in konstanten Preisen, also der Exporte (X), deflationiert mit dem Exportpreisindex (Px), abzüglich der Importe (M), deflationiert mit dem Importpreisindex (Pm). Die Wahl eines angemessenen Preisindex P sollte den nationalen statistischen Ämtern überlassen bleiben, um den speziellen Gegebenheiten in dem jeweiligen Land Rechnung zu tragen. Wenn es nicht klar ist, welcher Deflator verwendet werden soll, ist der Mittelwert aus dem Export- und dem Importpreisindex eine akzeptable Alternative. Für die Realeinkommensaggregate gilt folgende Bezeichnung: preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt
Der Realwert der grenzüberschreitenden Primäreinkommen und Transfers sollte mit dem Preisindex der letzten inländischen Verwendung von Gütern berechnet werden. Der Realwert des verfügbaren Einkommens ergibt sich durch Abzug der preisbereinigten Abschreibungen vom Bruttowert. |
RÄUMLICHER PREIS- UND VOLUMENVERGLEICH
|
10.48 |
Die unterschiedlichen Preisniveaus und Währungen der Länder erschweren räumliche Preis- und Volumenvergleiche. Nominale Wechselkurse sind keine geeigneten Umrechnungsfaktoren für solche Vergleiche, da sie die Unterschiede im Preisniveau nicht angemessen widerspiegeln und zeitlich nicht hinreichend stabil sind. |
|
10.49 |
Stattdessen werden Kaufkraftparitäten (KKP) verwendet. Eine KKP gibt an, wie viele Währungseinheiten des Landes B benötigt werden, um im Land B die gleiche Menge Waren und Dienstleistungen zu kaufen, die im Land A mit einer Währungseinheit des Landes A gekauft werden kann. KKP können somit interpretiert werden als Wechselkurs einer künstlichen Währung, die allgemein als Kaufkraftstandard (KKS) bezeichnet wird. Werden die in Landeswährungen ausgedrückten Ausgaben der Länder A und B in KKS umgerechnet, so ergeben sich Werte auf demselben Preisniveau und in derselben Währung, was einen aussagekräftigen Volumenvergleich ermöglicht. |
|
10.50 |
KKP für marktbestimmte Waren und Dienstleistungen beruhen auf internationalen Preiserhebungen. Diese Erhebungen werden zeitgleich in allen teilnehmenden Ländern durchgeführt und basieren auf einem gemeinsamen Warenkorb. Die Artikel in diesem Warenkorb sind trennscharf definiert, zum einen durch ihre technischen Merkmale, zum anderen durch Variablen, von denen angenommen wird, dass sie den Preis beeinflussen, wie Installationskosten und Verkaufsbedingungen. Vorrangig ist zwar die Vergleichbarkeit der Artikel im Warenkorb, gleichzeitig muss aber auch eine hinreichende Repräsentativität dieser Güter auf dem jeweiligen nationalen Markt sichergestellt sein. Idealerweise sollte der Warenkorb in allen Teilnehmerländern gleichermaßen repräsentativ sein. |
|
10.51 |
Bei nichtmarktbestimmten Dienstleistungen bereiten räumliche Vergleiche das gleiche Problem wie zeitliche, da in beiden Dimensionen keine Marktpreise zur Verfügung stehen. Bisher wurde traditionell mit einem Inputansatz (oder einem Inputkostenansatz) gearbeitet, bei dem unterstellt wurde, dass der Produktionswert (Output) der Summe der Produktionskosten (Input) entspricht. Dieser Ansatz der direkten oder indirekten Vergleiche der Inputvolumen lässt allerdings Unterschiede bei der Produktivität unberücksichtigt. Zu bevorzugen sind daher, wie auch bei zeitlichen Vergleichen, Methoden der direkten Outputmessung oder der Messung von Outputpreisen, die anschließend zur Deflationierung der Ausgaben herangezogen werden, zumindest für individualisierbare Dienstleistungen etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich. |
|
10.52 |
Bei der Berechnung der KKP werden die gleichen Indexformeln verwendet wie bei der Berechnung der zeitlichen Indizes. Im Falle bilateraler Paritäten für zwei Länder A und B können die Indizes mit den Gewichten eines jeden Landes berechnet werden. Aus der Sicht des Landes A bilden die Gewichte von A einen Laspeyres-Index und die Gewichte von B einen Paasche-Index. Im Falle struktureller Unterschiede zwischen beiden Volkswirtschaften können die beiden Indizes jedoch stark differierende Ergebnisse liefern, und das Endresultat würde in hohem Maße von der Indexwahl abhängen. Für bilaterale Ländervergleiche sollte daher besser der Durchschnitt aus beiden Indizes verwendet werden, also ein Fisher-Index. |
|
10.53 |
Explizite numerische Gewichte stehen in der Regel auf der Ebene der einzelnen Artikel im Warenkorb nicht zur Verfügung. Daher wird eine Art impliziter Gewichtung vorgenommen, je nachdem, ob die Länder einen bestimmten Artikel als für den Inlandsverbrauch repräsentativ betrachten oder nicht. Die unterste Aggregationsebene, auf der numerische Gewichte zur Verfügung stehen, ist die der Einzelpositionen (EP). |
|
10.54 |
Von Transitivität spricht man, wenn die direkte KKP zwischen den Ländern A und C gleich der indirekten KKP ist, die durch Multiplikation der direkten KKP zwischen den Ländern A und B (oder einem beliebigen anderen Drittland) mit der direkten KKP zwischen den Ländern B und C abgeleitet wird. Die Fisher-KKP auf EP-Ebene sind nicht transitiv, aus ihnen lässt sich jedoch mit Hilfe der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate eine Reihe transitiver KKP ableiten, die den originären Fisher-Indizes annähernd entsprechen. Durch Anwendung der sogenannten Éltetö-Köves-Szulc-Methode (EKS) werden die Abweichungen zwischen den originären Fisher-Indizes minimiert, und man erhält eine vollständige Reihe transitiver KKP auf EP-Ebene. |
|
10.55 |
Die sich ergebenden transitiven KKP für alle Länder und alle EP werden bis auf die Ebene des Gesamt-BIP aggregiert, wobei zur Gewichtung die Ausgabendaten aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen herangezogen werden. Die aggregierten KKP auf der Ebene des BIP oder einer anderen Kategorie können beispielsweise bei der Berechnung realer Ausgaben und wirtschaftsraumbezogener Volumenindizes verwendet werden. Dividiert man eine KKP durch den nominalen Wechselkurs zwischen zwei Ländern, so erhält man einen Preisniveauindex (PNI), der bei Vergleichen der Preisniveaus von Ländern herangezogen werden kann. |
|
10.56 |
Nach der Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 (2) ist die Europäische Kommission (Eurostat) für die Berechnung von KKP für die Mitgliedstaaten zuständig. In der Praxis sind diese KKP-Berechnungen Teil eines umfassenderen KKP-Programms, das von Eurostat und der OECD gemeinsam koordiniert wird. Eine ausführliche Beschreibung der angewandten Methoden ist im Handbuch von Eurostat und der OECD zu finden (Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities (3)). |
(1) Eurostat, Handbuch zur Preis- und Volumenmessung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, 2001 (abrufbar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
(2) Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Bereitstellung der Basisinformationen für Kaufkraftparitäten sowie für deren Berechnung und Verbreitung (ABl. L 336 vom 20.12.2007, S. 1).
(3) Eurostat-OECD, Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities, 2006 (verfügbar unter http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
KAPITEL 11
BEVÖLKERUNG UND ARBEITSEINSATZ
|
11.01 |
Vergleiche zwischen Ländern oder zwischen Wirtschaftsbereichen oder Sektoren einer Volkswirtschaft sind für einige Zwecke nützlicher, wenn betreffende volkswirtschaftliche Größen (z. B. Bruttoinlandsprodukt, Konsumausgaben privater Haushalte, Wertschöpfung einzelner Wirtschaftsbereiche, Arbeitnehmerentgelt) auf die Zahl der Einwohner und Größen des Arbeitseinsatzes bezogen werden. In diesen Fällen müssen die Definitionen für die Begriffe Einwohner und Arbeitseinsatz den Konzepten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entsprechen und die Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen widerspiegeln. |
|
11.02 |
Der Zweck dieses Kapitels ist es, die Rahmen und die Maßgrößen der Bevölkerungs- und Erwerbstätigenstatistiken darzustellen und zu erläutern, inwieweit diese Rahmen dem System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen entsprechen. |
|
11.03 |
Die Größen für den Arbeitseinsatz werden auf der Grundlage derselben statistischen Einheiten klassifiziert, wie sie auch für die Analyse der Produktion verwendet werden, nämlich der örtlichen fachlichen Einheit und der institutionellen Einheit. |
|
11.04 |
Bei den volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen, auf die die Einwohnerzahlen und die Angaben für den Arbeitseinsatz bezogen werden, handelt es sich häufig um Jahreswerte. In diesem Fall müssen für Einwohner und für den Arbeitseinsatz Jahresdurchschnittswerte verwendet werden. Werden mehrmals jährlich Erhebungen durchgeführt, so ist der Mittelwert aus den zu diesen verschiedenen Zeitpunkten erzielten Ergebnissen zu verwenden. Wird eine Erhebung während eines Zeitraumes im Jahr durchgeführt, so muss der gewählte Zeitraum repräsentativ sein. Zur Schätzung von Jahreswerten müssen die letzten verfügbaren Informationen über Veränderungen während des Jahres berücksichtigt werden. Wenn beispielsweise durchschnittliche Erwerbstätigenzahlen geschätzt werden, muss in geeigneter Form berücksichtigt werden, dass bestimmte Personen nicht das ganze Jahr hindurch arbeiten, z. B. Gelegenheitsarbeiter und Saisonarbeiter. |
BEVÖLKERUNG
|
11.05 |
Definition: Zu einem gegebenen Zeitpunkt umfasst die Bevölkerung (Einwohner) eines Landes alle Personen, Staatsangehörige oder Ausländer, die im Wirtschaftsgebiet des Landes ansässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sein sind. Die durchschnittliche jährliche Kopfzahl ist eine geeignete Grundlage für die Schätzung von Variablen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen oder eine geeignete Bezugsgröße für Vergleiche. |
|
11.06 |
Die Bevölkerung wird für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach dem Wohnsitzprinzip definiert, wie in Kapitel 2 beschrieben. Als im Land ansässig gelten alle Personen, die sich im Wirtschaftsgebiet dieses Landes für einen Zeitraum von einem Jahr oder länger aufhalten oder aufzuhalten beabsichtigen. Als vorübergehend abwesend gelten alle im Land ansässigen Personen, die sich für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr in der übrigen Welt aufhalten oder aufzuhalten beabsichtigen. Alle Einzelpersonen, die zu ein und demselben Haushalt gehören, sind dort gebietsansässig, wo der Haushalt einen Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses hat. Dies ist dort, wo der Haushalt eine Wohnung oder nacheinander mehrere Wohnungen unterhält, die von den Mitgliedern des Haushalts als ihr Hauptwohnsitz behandelt und genutzt werden. Ein Mitglied eines gebietsansässigen Haushalts bleibt Gebietsansässiger, auch wenn diese Person häufig Reisen außerhalb des Wirtschaftsgebiets unternimmt, da ihr Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses in dem Wirtschaftsgebiet bleibt, in dem der Haushalt gebietsansässig ist. |
|
11.07 |
Die Bevölkerung eines Landes umfasst
Die Bevölkerung eines Landes umfasst unabhängig von der Aufenthaltsdauer in der übrigen Welt außerdem
|
|
11.08 |
Demgegenüber gehören nicht zur Bevölkerung eines Landes
|
|
11.09 |
Die weiter oben gegebene Definition der Bevölkerung eines Landes unterscheidet sich vom Konzept der anwesenden oder De-facto-Einwohner: Letztere bestehen aus Personen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt tatsächlich auf dem geografischen Gebiet eines Landes anwesend sind. Sie unterscheidet sich auch vom Konzept der gemeldeten Einwohner. |
ERWERBSPERSONEN
|
11.10 |
Definition: Die Erwerbsbevölkerung umfasst alle Personen, die das Arbeitskräfteangebot für die Produktionstätigkeiten im Rahmen der Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen darstellen oder darstellen können. Sie umfassen alle Personen, die die Bedingungen für die Zurechnung zu den Erwerbstätigen oder den Arbeitslosen gemäß den folgenden Definitionen erfüllen. Die einschlägigen Standards zur Arbeitskräftestatistik werden von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) herausgegeben. Die ILO-Standards sind in „Entschließungen“ enthalten, die von der Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker (ICLS) verabschiedet werden. Die wichtigste Entschließung für die Erhebung und Aufbereitung von Daten über Arbeitskräfte ist die Entschließung über Statistiken der Erwerbsbevölkerung, der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Unterbeschäftigung. Diese Entschließung wurde von der 13. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker im Oktober 1982 verabschiedet und durch die Entschließung der 18. ICLS im Dezember 2008 geändert. In der Entschließung werden Erwerbspersonen als Personen definiert, die innerhalb der Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eine Tätigkeit ausüben. |
ERWERBSTÄTIGE
|
11.11 |
Definition: Erwerbstätige sind alle Personen, die innerhalb der Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eine Produktionstätigkeit ausüben. Erwerbstätige sind Arbeitnehmer oder Selbständige. Personen, die mehr als ein Beschäftigungsverhältnis haben, werden je nach ihrem Hauptbeschäftigungsverhältnis den Arbeitnehmern oder Selbständigen zugerechnet. |
Arbeitnehmer
|
11.12 |
Definition: Arbeitnehmer sind Personen, die auf vertraglicher Basis für eine gebietsansässige institutionelle Einheit abhängig arbeiten und eine Vergütung erhalten, die als Arbeitnehmerentgelt erfasst wird. Der Begriff „Arbeitnehmer“ entspricht der Definition der ILO für „entlohnte Tätigkeit“. Ein Arbeitsverhältnis besteht, wenn zwischen einem Unternehmen und einem Arbeitnehmer ein formeller oder informeller, freiwillig geschlossener Vertrag besteht, demzufolge der Arbeitnehmer für das Unternehmen tätig wird und dafür Geld- oder Sachleistungen erhält. Personen, die sowohl ein Beschäftigungsverhältnis als Arbeitnehmer haben als auch eine selbständige Tätigkeit ausüben, zählen zu den Arbeitnehmern, sofern die Arbeitnehmertätigkeit einkommensmäßig ihre Haupttätigkeit ist. Falls Angaben über das Einkommen nicht zu erlangen sind, sind die geleisteten Arbeitsstunden als Ersatz heranzuziehen. |
|
11.13 |
Arbeitnehmer umfassen
|
|
11.14 |
Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die vorübergehend nicht arbeiten, sofern sie formell mit ihrem Arbeitsplatz verbunden sind. Diese formelle Verbundenheit wird nach einem oder mehreren der folgenden Kriterien festgestellt:
Hierzu gehören Personen, die aus folgenden Gründen vorübergehend nicht arbeiten: Krankheit oder Verletzung, Ferien oder Urlaub, Streik oder Aussperrung, Bildungs- oder Fortbildungsurlaub, Mutterschafts- oder Elternurlaub, Konjunkturrückgang, vorübergehende Arbeitseinstellung oder Freisetzung, z. B. wegen schlechten Wetters, Maschinen- oder Stromausfalls, Rohstoff- oder Treibstoffknappheit, oder sonstige vorübergehende Abwesenheit mit oder ohne Erlaubnis. |
Selbständige
|
11.15 |
Definition: Selbständige werden definiert als Personen, die alleinige oder gemeinsame Eigentümer eines Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind, in dem sie arbeiten, ausgenommen diejenigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die als Quasi-Kapitalgesellschaften eingestuft werden. Personen, die sowohl in einem Beschäftigungsverhältnis als Arbeitnehmer als auch als Selbständiger stehen, zählen zu den Selbständigen, sofern die selbständige Tätigkeit gemessen an den aus der Tätigkeit erzielten Einkommen ihre Haupttätigkeit ist. Falls Angaben über das Einkommen nur schwer zu erlangen sind, können die geleisteten Arbeitsstunden als Ersatz herangezogen werden. Es kann sein, dass Selbständige während des Bezugszeitraums vorübergehend nicht arbeiten. Die Vergütung für selbständige Tätigkeit ist das Selbständigeneinkommen. |
|
11.16 |
Zu den Selbständigen gehören auch folgende Kategorien:
Personen, die freiwillig unbezahlte Tätigkeiten ausüben, zählen zu den Selbständigen, wenn die freiwillig übernommenen Tätigkeiten der Warenproduktion dienen, z. B. dem Bau einer Wohnung, einer Kirche oder eines sonstigen Gebäudes. Werden jedoch freiwillig Dienstleistungen erbracht, z. B. bei unentgeltlichen Hausmeister- oder Reinigungsarbeiten, so zählt das nicht zur Erwerbstätigkeit, da diese Tätigkeit außerhalb der Produktionsgrenze des ESVG liegt. Obwohl die Nutzung eigener Wohnungen innerhalb der Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen liegt, geschieht diese Nutzung ohne Arbeitseinsatz. Die Wohnungseigentümer werden nicht als Selbständige betrachtet. |
Erwerbstätige und Wohnsitz
|
11.17 |
Konsistent in ihrer Erfassung sind die Ergebnisse der produzierenden Einheiten und der Erwerbstätigen, sofern bei Erwerbstätigen sowohl Gebietsansässige als auch Gebietsfremde, die bei diesen Einheiten arbeiten, einbezogen werden. Die Erwerbstätigen umfassen deshalb auch
|
|
11.18 |
Nicht zu den Erwerbstätigen zählen
|
|
11.19 |
Um den Übergang zu den Begriffen zu ermöglichen, die im Allgemeinen in Arbeitskräfteerhebungen verwendet werden (Erwerbstätige nach dem Inländerkonzept), sieht das ESVG die getrennte Ausweisung der folgenden Posten vor:
|
ARBEITSLOSE
|
11.20 |
Definition: In Übereinstimmung mit den von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) (13. Internationale Konferenz der Arbeitsstatistiker) aufgestellten Leitlinien, im Rahmen der Europäischen Union näher geregelt in der Verordnung (EG) Nr. 1897/2000 (1), umfasst der Begriff "Arbeitslose" alle Personen ab einem bestimmten Alter, die während des Bezugszeitraums
|
|
11.21 |
Spezifische Schritte können sein: die Registrierung beim Arbeitsamt oder bei einer privaten Arbeitsvermittlungsstelle, die Bewerbung bei Arbeitgebern, die Nachfrage auf Baustellen, bei landwirtschaftlichen Betrieben, an Fabriktoren, auf Markt- oder sonstigen Versammlungsplätzen, das Aufgeben von oder das Antworten auf Zeitungsannoncen, das an Freunde oder Verwandte gerichtete Ersuchen um Unterstützung, die Suche nach Gelände, Gebäuden, Maschinen oder Ausrüstung zur Gründung eines eigenen Unternehmens, das Beantragung von Genehmigungen und Lizenzen oder Geldmitteln usw. |
BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE
|
11.22 |
Definition: Ein Beschäftigungsverhältnis ist ein expliziter oder impliziter Vertrag zwischen einer Person und einer gebietsansässigen institutionellen Einheit über die Verrichtung von Arbeit gegen eine Vergütung für einen bestimmten Zeitraum oder bis auf weiteres. In dieser Definition werden die folgenden Begriffe definiert:
Diese Definition des Begriffs der Beschäftigungsverhältnisse schließt sowohl Beschäftigungsverhältnisse der Arbeitnehmer als auch der Selbständigen ein: d. h. das Beschäftigungsverhältnis eines Arbeitnehmers liegt vor, wenn die Person zu einer anderen institutionellen Einheit als der Arbeitgeber gehört, und das Beschäftigungsverhältnis eines Selbständigen, wenn die Person zu derselben institutionellen Einheit wie der Arbeitgeber gehört. |
|
11.23 |
Der Begriff Beschäftigungsverhältnisse unterscheidet sich von dem Begriff Erwerbstätige nach obiger Definition:
|
Beschäftigungsverhältnisse und Gebietsansässigkeit
|
11.24 |
Ein Beschäftigungsverhältnis im Wirtschaftsgebiet des Landes (im Inland) entspricht einem expliziten oder impliziten Vertrag zwischen einer Person (die auch in einem anderen Wirtschaftsgebiet gebietsansässig sein kann) und einer in dem Land gebietsansässigen institutionellen Einheit. Zur Messung des inländischen Arbeitseinsatzes ist nur der Sitz der produzierenden Einheit relevant, da nur gebietsansässige Produzenten zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. |
|
11.25 |
Darüber hinaus gilt Folgendes:
|
NICHT BEOBACHTETE WIRTSCHAFT
|
11.26 |
Der Wert von Produktionstätigkeiten, die nicht direkt beobachtet werden, liegt grundsätzlich innerhalb der Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die folgenden drei Arten für derartige Tätigkeiten werden daher in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einbezogen:
Die Vergütung der betreffenden Arbeitskräfte wird grundsätzlich beim Arbeitnehmerentgelt oder beim Selbständigeneinkommen ausgewiesen. Diese Anpassung ist bei den Daten über abhängige und selbständige Beschäftigung zu berücksichtigen, wenn Verhältniszahlen und andere statistische Werte ermittelt werden. Illegale Tätigkeiten, an denen sich eine der Parteien nicht freiwillig beteiligt (z. B. Diebstahl), sind keine wirtschaftlichen Transaktionen und gelten daher als nicht innerhalb der Produktionsgrenze liegend. |
ARBEITSVOLUMEN
|
11.27 |
Definition: Das Arbeitsvolumen umfasst die insgesamt von den Arbeitnehmern und Selbständigen tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden bei Tätigkeiten innerhalb der Produktionsgrenze des ESVG. Da zu den Arbeitnehmern auch Teilzeitbeschäftigte zählen sowie Personen, die vorübergehend nicht arbeiten, aber formell in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist die geeignete Messgröße für die Berechnung von Produktivitätskennzahlen nicht die Kopfzahl sondern das Arbeitsvolumen. Das Arbeitsvolumen ist in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen das geeignetste Maß für den Arbeitseinsatz. |
Angabe des Arbeitsvolumens
|
11.28 |
Das Arbeitsvolumen umfasst die Arbeitsstunden, die zur Produktion beigetragen haben und unter Bezugnahme auf die Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechungen definiert werden können. In der ILO-Entschließung über die Messung der Arbeitszeit („Resolution on the Measurement of Working Time“), die von der 18. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker (ICLS) im Dezember 2008 verabschiedet wurde, werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden als die Zeit definiert, die Personen bei der Ausübung von Tätigkeiten verbringen, die zur Produktion von Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Bezugszeitraum beitragen. Die Entschließung enthält folgende Angaben zu den Arbeitsstunden:
Umfassendere Definitionen dieser Kriterien enthält die von der ICLS im Dezember 2008 verabschiedete Entschließung über die Messung der Arbeitszeit („Resolution on the Measurement of Working Time“). |
|
11.29 |
Das Arbeitsvolumen umfasst die Gesamtzahl der während des Rechnungszeitraums am Arbeitsplatz (Beschäftigungsfall) von Arbeitnehmern und Selbständigen innerhalb des Wirtschaftsgebiets tatsächlich geleisteten Stunden,
|
|
11.30 |
In vielen Unternehmenserhebungen werden nicht die geleisteten, sondern die bezahlten Arbeitsstunden erfasst. In diesen Fällen müssen die geleisteten Stunden für jede Gruppe von Beschäftigungsfällen geschätzt werden, wobei alle verfügbaren Informationen über bezahlten Urlaub usw. zu verwenden sind. |
|
11.31 |
Für die Konjunkturanalyse kann es zweckmäßig sein, das Arbeitsvolumen auf eine Standardanzahl von Arbeitstagen pro Jahr zu normieren. |
VOLLZEITÄQUIVALENTE
|
11.32 |
Definition: Die Vollzeitäquivalente der Erwerbstätigkeit entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse. Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt je Vollzeitarbeitsplatz im Wirtschaftsgebiet geleistet wird. |
|
11.33 |
Diese Definition beschreibt nicht, wie die Vollzeitäquivalente tatsächlich berechnet werden: Da sich die Länge der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten im Zeitablauf ändert und zwischen den Wirtschaftsbereichen unterschiedlich ist, werden je Beschäftigtengruppe die Abweichung der tatsächlichen Arbeitsstunden von den Normalarbeitsstunden ermittelt und die Beschäftigtengruppen anteilmäßig zusammengefasst. Zunächst muss also für jede Beschäftigtengruppe die Normalarbeitszeit je Woche bei Vollarbeit ermittelt werden. Eine Beschäftigungsgruppe kann innerhalb eines Wirtschaftsbereichs anhand des Geschlechts der Erwerbstätigen und der Art der Arbeit definiert werden. Für Arbeitnehmer ist die tariflich vereinbarte Stundenzahl geeignet. Die Vollzeitäquivalente werden für jede Beschäftigungsgruppe getrennt berechnet und dann addiert. |
|
11.34 |
Das Arbeitsvolumen ist der beste Messwert für den Arbeitseinsatz, aber wenn diese Angabe nicht vorliegt, sind Vollzeitäquivalente unter Umständen die besten verfügbaren Ersatzwerte. Sie können leichter geschätzt werden, so dass internationale Vergleiche mit Ländern, die die Erwerbstätigkeit lediglich in der Form von Vollzeitäquivalenten schätzen können, möglich sind. |
ARBEITSEINSATZ DER ARBEITNEHMER ZU KONSTANTEN LOHNSÄTZEN
|
11.35 |
Definition: Für Arbeitseinsätze ähnlicher Art und Qualifikation im Basiszeitraum ergibt sich der Arbeitseinsatz der Arbeitnehmer zu konstanten Lohnsätzen, indem die im Berichtszeitraum tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit den Lohnsätzen bewertet werden, die im Basiszeitraum für entsprechende Arbeitsstunden galten. |
|
11.36 |
Das Arbeitnehmerentgelt zu jeweiligen Preisen, dividiert durch den Arbeitseinsatz von Arbeitnehmern zu konstanten Lohnsätzen, ergibt einen impliziten Preisindex für das Arbeitnehmerentgelt, der mit dem impliziten Preisindex der letzten Verwendung vergleichbar ist. |
|
11.37 |
Mit dem Arbeitseinsatz der Arbeitnehmer zu konstanten Lohnsätzen sollen Veränderungen in der Zusammensetzung der Arbeitnehmer — wie Verschiebungen von geringwertigen zu höherwertigen Arbeiten —beschrieben werden. Die Analyse ist getrennt nach Wirtschaftsbereichen durchzuführen. |
MESSGRÖSSEN DER PRODUKTIVITÄT
|
11.38 |
Definition: Die Produktivität ist ein Maß des Produktionswertes eines Produktionsprozesses je Vorleistungseinheit. Beispielsweise wird die Arbeitsproduktivität in der Regel als Quotient von Produktionswert und Arbeitsstunden, einer Vorleistung, gemessen. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dass die Maße für den Arbeitseinsatz, die bei Untersuchungen herangezogen werden, bei denen der Produktionswert auf den Maßen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beruht, vom Konzept und Erfassungsbereich her mit den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen übereinstimmen. |
(1) Verordnung (EG) Nr. 1897/2000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 557/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft bezüglich der Arbeitsdefinition der Arbeitslosigkeit (ABl. L 228 vom 8.9.2000, S. 18).
KAPITEL 12
VIERTELJÄHRLICHE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN
EINLEITUNG
|
12.01 |
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Grundsätze und Eigenschaften vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen dargestellt. |
|
12.02 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen sind Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, deren Bezugszeitraum ein Vierteljahr ist. Sie bilden ein System integrierter vierteljährlicher Indikatoren. Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen stellen ein umfassendes Rechnungssystem zur Verfügung, in dem Wirtschaftsdaten erfasst und in einem Format dargestellt werden können, das zu Zwecken der auf vierteljährlicher Basis erfolgenden wirtschaftlichen Analyse, Beschlussfassung und Politikgestaltung entwickelt wurde. |
|
12.03 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen basieren auf denselben Grundsätzen und Definitionen und demselben Aufbau wie jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Für vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen werden dieselben Begriffe verwendet wie für jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, sofern in diesem Kapitel nichts anderes angegeben ist. |
|
12.04 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen decken die gesamte Kontenabfolge und Bilanzierung ab. In der Praxis führen Beschränkungen hinsichtlich Datenverfügbarkeit, Zeit und Ressourcen dazu, dass vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen weniger vollständig sind als jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Im Vergleich zu jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist der Umfang der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen begrenzter. Der Schwerpunkt liegt auf der Messung des BIP, der Messung des Aufkommens und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen und auf der Einkommensentstehung. Die Wirtschaftsbereiche und spezifischen Transaktionen werden weniger ausführlich dargestellt. Die Abstriche bei Umfang, Ausführlichkeit und Zuverlässigkeit erfolgen zugunsten der Aktualität. |
|
12.05 |
Im Vergleich zu jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen häufiger erstellt und veröffentlicht. Sie bieten einen frühzeitigen Überblick über die wirtschaftlichen Entwicklungen und können genutzt werden, um Frühschätzungen jährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen zu erstellen. |
|
12.06 |
Die statistischen Zeitreihen der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind aufgrund ihrer vierteljährlichen Erstellung von Saison- und Kalendereffekten beeinflusst. Saisonbewegungen werden durch Saison- und Kalenderbereinigungsverfahren geglättet. |
|
12.07 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen stützen sich in der Regel auf stärker begrenzte Datenquellen als jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und ihre Erstellung macht eine intensivere Anwendung statistischer und ökonometrischer Verfahren erforderlich. Bei der Erstellung von vierteljährlichen Gesamtrechnungen kommen zwei Ansätze zur Anwendung: der direkte und der indirekte Ansatz. |
|
12.08 |
Grundlage des direkten Ansatzes ist die vierteljährliche Verfügbarkeit ähnlicher Datenquellen, wie sie bei der Erstellung der jährlichen Gesamtrechnungen verwendet werden; die Erstellungsmethoden sind bei diesem Ansatz ebenfalls ähnlich. Der indirekte Ansatz stützt sich auf statistische und ökonometrische Schätzverfahren, bei denen Informationen der jährlichen Gesamtrechnungen und kurzfristige Indikatoren zur Inter- und Extrapolation der jährlichen Schätzungen verwendet werden. Die Entscheidung für einen der beiden Ansätze hängt davon ab, ob die bei der Erstellung der jährlichen Gesamtrechnungen verwendeten Daten so rasch zur Verfügung stehen, dass sie in dieser Form für die vierteljährlichen Gesamtrechnungen genutzt werden können. |
|
12.09 |
Der Zweck vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen unterscheidet sich von dem der jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen legen den Fokus auf kurzfristige Wirtschaftsentwicklungen und messen diese Bewegungen innerhalb des Rahmens der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf kohärente Weise. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Wachstumsraten und ihren Eigenschaften wie Beschleunigung, Verlangsamung oder Veränderung ihrer Vorzeichen. Bei den jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen liegt der Fokus auf den Ebenen und der Struktur der Wirtschaft sowie auf den Wachstumsraten. Die jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen eignen sich weniger für Konjunkturanalysen als die vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, da jährliche Daten kurzfristige wirtschaftliche Entwicklungen verschleiern. |
|
12.10 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen können zur Erstellung jährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen verwendet werden. Sie verbessern die Zuverlässigkeit und Aktualität der jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, und in einigen Ländern werden Letztere direkt aus der Aggregation der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen hergeleitet. Aus diesen unterschiedlichen Rollen ergeben sich Unterschiede in der Datenverfügbarkeit und den Erstellungsverfahren. |
|
12.11 |
Eine Reihe von Daten steht am Anfang der Erstellung vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, darunter kurzfristige Statistiken zu Produktion, Preisen, Beschäftigung und Außenhandel, Vertrauensindikatoren der Wirtschaft und der Verbraucher sowie administrative Daten wie Mehrwertsteuereinnahmen. Im Vergleich zu diesen Indikatoren haben vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen folgende Vorteile:
|
|
12.12 |
Der Erfassungsbereich der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entspricht dem Erfassungsbereich der jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; so umfasst er die gesamte Kontenabfolge und die entsprechenden Aggregate sowie den Aufkommens- und Verwendungsrahmen. Die geringere Verfügbarkeit von Informationen und die Erstellung in Vierteljahresintervallen führen bei den vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen jedoch in der Regel zu einer Reduzierung ihres Erfassungs- und Anwendungsbereichs. Das System der vierteljährlichen Gesamtrechnungen umfasst folgende Punkte:
Diese Elemente werden zu Erfassungszwecken durch einen vereinfachten Aufkommens- und Verwendungsrahmen sinnvoll ergänzt. |
CHARAKTERISTISCHE BESONDERHEITEN VIERTELJÄHRLICHER VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN
|
12.13 |
Für die Erstellung vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen sind folgende Aspekte besonders wichtig:
|
Buchungszeitpunkt
|
12.14 |
Für vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen gelten dieselben Bestimmungen in Bezug auf den Buchungszeitpunkt wie für jährliche Gesamtrechnungen. Allerdings ergeben sich aus dem kürzeren Buchungszeitraum spezifische Messprobleme in Bezug auf den Buchungszeitpunkt. Dies betrifft insbesondere die Messung von
|
|
12.15 |
Wichtig für die Erstellung vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ist die Verbuchung von Tätigkeiten und Strömen, die sich auf bestimmte Zeiträume innerhalb eines Jahres konzentrieren. Der Umfang solcher Tätigkeiten pro Quartal, wie beispielsweise der Produktionswert von Landwirtschaft, Bauwesen und Tourismus, hängt von spezifischen äußeren Faktoren wie dem Wetter und gesetzlichen Feiertagen ab. Die Zahlung von Löhnen und Gehältern, Steuern, Sozialleistungen und Dividenden kann vorübergehenden vierteljährlichen Einflüssen unterworfen sein, z. B. wenn in einem Monat Jahresprämien ausgezahlt werden. Fehler bei der Messung der zeitlichen Zuordnung und des Umfangs solcher Ereignisse führen zu Messfehlern des vierteljährlichen Wachstums. |
Unfertige Erzeugnisse
|
12.16 |
Bei unfertigen Erzeugnissen bzw. angefangenen Arbeiten handelt es sich um Produktion, die noch nicht zur Auslieferung bereit ist. In diesem Fall geht die Produktion über einen Berichtszeitraum hinaus. Lange Produktionszyklen betreffen Tätigkeiten wie beispielsweise Landwirtschaft, Bauwesen, Maschinen-, Fahrzeug- und Schiffbau sowie Dienstleistungen wie Softwareentwicklung, architektonische Dienstleistungen, Filmprojekte oder große Sportveranstaltungen. Diese langen Produktionsprozesse gehen oftmals mit Abschlagszahlungen einher, insbesondere im Schiff- und Flugzeugbau, in der Weinherstellung und bei Werbeverträgen. Bei der Messung dieser Produktionsprozesse muss ein einzelner Prozess in mehrere gesonderte Zeiträume aufgeteilt werden. Dies ist bei vierteljährlichen schwieriger als bei jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Für die Messung unfertiger Erzeugnisse gelten jedoch auf vierteljährlicher und auf jährlicher Basis dieselben Grundsätze. |
Tätigkeiten, die sich auf bestimmte Zeiträume innerhalb eines Jahres konzentrieren
|
12.17 |
Die Verteilung von Output auf der Basis der im Zeitablauf entstandenen Kosten ist die normale Form der periodengerechten Zuordnung der eventuellen Produktion, findet aber nicht immer vollständig Anwendung. Auf Zeiträume, in denen es keinen andauernden Produktionsprozess gibt, sollte kein Produktionswert verteilt werden, auch wenn laufende Kosten vorliegen. Dies gilt für die Kosten für die Nutzung von Sachanlagen, z. B. Mietzahlungen für die Nutzung von Maschinen. Diese Situation kann in der Landwirtschaft auftreten, in der die Produktion in bestimmten Zeiträumen vollständig stillstehen kann. Zeiträume, in denen möglicherweise nicht produziert wird, sind unter anderem in der lebensmittelverarbeitenden Industrie möglich, die von Ernteprodukten abhängig ist. |
Zahlungen von geringer Häufigkeit
|
12.18 |
Betrachtet man eine Wirtschaftsaktivität über das gesamte Jahr hinweg, sind Zahlungen von geringer Häufigkeit Zahlungen, die auf jährlicher Basis oder als seltene Teilzahlungen auf das Jahr verteilt vorgenommen werden. Beispiele für solche Zahlungen sind Dividenden, Zinsen, Steuern, Subventionen und Mitarbeiterprämien wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. All diese distributiven Transaktionen werden periodengerecht aufgezeichnet, d. h. wenn die Forderung entstanden ist und nicht, wenn sie bezahlt wurde. Die Frage des Buchungszeitpunkts stellt sich auch in den jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, wenn Zahlungen sich teilweise auf ein anderes Rechnungsjahr beziehen. |
|
12.19 |
Im Hinblick auf diese Fragen des Buchungszeitpunkts muss zwischen zwei Zahlungskategorien unterschieden werden:
|
|
12.20 |
Die Anwendung des Grundsatzes der Periodenabgrenzung auf vierteljährliche Daten kann in solchen Fällen zu großen Schwierigkeiten führen; dann sind alternative Methoden erforderlich wie das Kassenprinzip oder die Zahlungen so auf die Rechnungsperioden zu verteilen, dass die Verzerrung der Eigenschaften der Zeitreihen minimiert wird. |
Schnellschätzungen
|
12.21 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bieten nach dem Ende des vierteljährlichen Bezugszeitraums mit kurzer Verzögerung einen Überblick über die konjunkturelle Lage. Die zeitnahe Verfügbarkeit dieser Informationen unterstützt die Ermittlung und Interpretation der Konjunkturentwicklung. Daher werden von den Statistikämtern immer häufiger Schnellschätzungen von entscheidenden makroökonomischen Aggregaten (darunter das BIP-Wachstum und Indikatoren der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) erstellt. |
|
12.22 |
Eine Schnellschätzung ist eine frühzeitige Schätzung einer ökonomischen Variable in Bezug auf den jüngsten Bezugszeitraum. Die Schnellschätzung wird normalerweise auf der Grundlage unvollständiger Daten berechnet; allerdings wird dasselbe statistische oder ökonometrische Modell verwendet wie bei herkömmlichen Schätzungen. Bei der Erstellung von Schnellschätzungen werden so viele Daten wie möglich berücksichtigt. Die Unterschiede zwischen Schnellschätzungen und herkömmlichen Schätzungen stellen sich wie folgt dar:
|
Bilanzierung und Benchmarking bei vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
|
12.23 |
Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bilden ein kohärentes Kontensystem, das auf vierteljährlicher Basis erstellt wird. Sie sind ein integraler Bestandteil des Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und daher mit den jährlichen Gesamtrechnungen konsistent. |
|
12.24 |
Die innere Konsistenz vierteljährlicher Gesamtrechnungen wird durch den Abgleich von Schätzungen des Aufkommens und der Verwendung für die Verbuchung auf vierteljährlicher Basis erreicht. Die Konsistenz mit den jährlichen Gesamtrechnungen wird entweder durch den Vergleich der vierteljährlichen Gesamtrechnungen mit den jährlichen Gesamtrechnungen oder durch die Herleitung der jährlichen Gesamtrechnungen aus den vierteljährlichen Gesamtrechnungen sichergestellt. |
Abstimmung
|
12.25 |
Das Bilanzierungs- oder Abstimmungsverfahren ist integraler Bestandteil des Verfahrens zur Erstellung Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Dabei werden die verschiedenen Informationsquellen, auf die sich die jeweiligen Messgrößen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen stützen, optimal genutzt. Im Allgemeinen dient die Abstimmung dazu, die statistischen Basisdaten, die den verschiedenen Ansätzen zur Erstellung des BIP und den anderen Bestandteilen der Gesamtrechnung zugrunde liegen, in einen Aufkommens- und Verwendungsrahmen einzupassen und somit sämtliche verfügbaren Informationen effektiv zu nutzen. |
|
12.26 |
Die auf die jährlichen Gesamtrechnungen angewandten Grundsätze und Methoden des Abstimmungsverfahrens finden auch auf die vierteljährlichen Gesamtrechnungen Anwendung, wobei sich die vierteljährliche Erstellung in zusätzlichen Verfahren niederschlägt. Diese zusätzlichen Verfahren betreffen vor allem folgende Merkmale der vierteljährlichen Gesamtrechnungen:
Ein vereinfachter vierteljährlicher Aufkommens- und Verwendungsrahmen erleichtert die Abstimmung der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Bei regelmäßiger Erstellung jährlicher Aufkommens- und Verwendungstabellen können die Informationen in den vierteljährlichen Aufkommens- und Verwendungstabellen als Teil des Abstimmungs- und Benchmarkingverfahrens ausdrücklich mit ihnen verknüpft werden. |
Konsistenz zwischen vierteljährlichen und jährlichen Gesamtrechnungen — Benchmarking
|
12.27 |
Zum Verfahren der Anpassung der vierteljährlichen an die jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gelangt man auf zwei Wegen:
|
|
12.28 |
Diskrepanzen zwischen vierteljährlichen und jährlichen Gesamtrechnungen bestehen vor allem aufgrund der Unterschiede bei den Quellen und bei der Verfügbarkeit von Informationen aus gemeinsamen Quellen. |
|
12.29 |
Es gibt viele verschiedene Methoden, um die vierteljährlichen mit den entsprechenden jährlichen Aggregaten abzustimmen. Die ideale Methode besteht darin, die Ursachen der Unterschiede zu ermitteln und neue, aufeinander abgestimmte vierteljährliche und jährliche Aggregate unter Verwendung aller verfügbaren Informationen zu gewinnen. Benchmarkingverfahren gewährleisten die Konsistenz zwischen den beiden Aggregate-Gruppen, indem sie die eine als Standard heranziehen und die andere damit in Konsistenz bringen. Dies geschieht durch eine Reihe von Verfahren, die von einfachen mathematischen Anpassungen bis hin zu komplexen statistischen und ökonometrischen Verfahren reichen. Benchmarkingverfahren sollen die Rechnungskohärenz zwischen den beiden Aggregate-Gruppen im Hinblick auf die Erhaltung von Bewegungen oder andere genau definierte Kriterien sicherstellen. Benchmarking ist integraler Bestandteil des Verfahrens zur Erstellung der VGR und muss grundsätzlich auf der untersten Aggregationsstufe erfolgen. In der Praxis kann dies bedeuten, dass das Benchmarking in Phasen erfolgt, wobei Daten für einige Reihen, die bereits einem Benchmarking unterworfen wurden, für die Schätzung anderer Reihen verwendet werden, worauf eine zweite oder dritte Benchmarking-Runde folgt. |
|
12.30 |
Wenn vierteljährliche Aggregate als Benchmark im System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen betrachtet werden, werden jährliche Aggregate durch Addition der vierteljährlichen Zahlen gewonnen. Auf diese Weise ist die Konsistenz sichergestellt. |
|
12.31 |
Sehr häufig resultiert die Abstimmung zwischen den vierteljährlichen und den jährlichen Aggregaten aus einer Kombination der Benchmarking-Ansätze: Beispielsweise können vorläufige jährliche Schätzungen durch Aggregation vierteljährlicher Zahlen gewonnen werden. Sobald die jährlichen Informationen verfügbar werden und das jährliche Aggregat revidiert wird, wird das jährliche Aggregat als Eckwert für die Korrektur der entsprechenden vierteljährlichen Zahlen herangezogen (Benchmarking). |
Verkettete Preis- und Volumenindizes
|
12.32 |
Die Messung von Preis und Volumenänderungen für jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen erfolgt im Grunde genommen durch einen jährlichen Kettenindex. Aus Gründen der Kohärenz sind die vierteljährlichen Preis- und Volumenmessungen auf die verketteten jährlichen Messzahlen beschränkt. |
|
12.33 |
Die Konsistenz zwischen vierteljährlichen und jährlichen Preis- und Volumenmessungen setzt voraus, dass entweder die jährlichen Messungen aus den vierteljährlichen Messzahlen gewonnen werden oder dass die vierteljährlichen Daten mithilfe von Benchmarkingverfahren auf die jährlichen Angaben beschränkt werden. Dies gilt auch, wenn die Grundvoraussetzung, dass die vierteljährlichen und die jährlichen Messungen auf denselben Erstellungs- und Darstellungsmethoden (z. B. derselben Indexformel, demselben Basisjahr und demselben Bezugszeitraum) basieren, erfüllt ist. Strenge Konsistenz ist nicht möglich, da die vierteljährlichen Indizes aufgrund ihrer mathematischen Formel normalerweise nicht genau dasselbe Wachstum wie die entsprechenden jährlichen Indizes widerspiegeln. |
|
12.34 |
Während vierteljährliche verkettete Volumenmessungen auf einer vierteljährlichen Verkettung basieren könnten, ist eine Verkettung im Prinzip einmal pro Jahr vorzunehmen. Vierteljährliche Volumenmessungen werden jährlich verkettet. |
|
12.35 |
Verkettete Volumenreihen vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen sind auf den jährlichen Durchschnittspreisen des Vorjahres basierende vierteljährliche Volumenänderungen. Für jährlich verkettete vierteljährliche Volumenindizes können drei Methoden angewandt werden:
Die Gewinnung von Zeitreihen durch die Anwendung einer der drei Verkettungsmethoden führt normalerweise zu strukturellen Brüchen in den entstandenen verketteten Reihen, deren Auswirkungen durch die gewählte Verkettungsmethode und durch die Änderung der Preisstruktur im Zeitverlauf bestimmt werden. |
|
12.36 |
Bei der Annual-overlap-Methode werden die jährlichen Durchschnittspreise des jeweiligen Vorjahres verwendet. Daraus ergeben sich jährliche Aggregate vierteljährlicher Volumenmessungen, die mit den unabhängig davon gewonnenen verketteten Reihen der jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen identisch sind. Ferner sind die Änderungsraten gegenüber dem Vorquartal innerhalb desselben Kalenderjahres (zwischen Q1 und Q 4) nicht von Brüchen betroffen. Allerdings ist die Volumenreihe von Brüchen betroffen, die vom vierten Quartal eines Jahres bis zum ersten Quartal des Folgejahres entstehen und auch in der entsprechenden Änderungsrate gegenüber dem Vorquartal aufgeführt werden. |
|
12.37 |
Dagegen führt die One-quarter-overlap-Methode in der Regel zu unverzerrten Änderungsraten gegenüber dem Vorquartal für alle Quartale des Jahres, da die Verkettungen auf die mit den Durchschnittspreisen des jeweiligen Jahres bewerteten Volumen des vierten Quartals des jeweiligen Vorjahrs Bezug nehmen. Allerdings führt die One-quarter-overlap-Methode anders als die Annual-overlap-Methode zu vierteljährlichen verketteten Reihen, die mit den unabhängig gewonnenen verketteten Reihen der jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht konsistent sind. |
|
12.38 |
Die Over-the-year-Methode der Verkettung führt zu unverzerrten Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr für alle Quartale des Jahres, da die Verkettungen auf die mit den jeweiligen Jahresdurchschnittspreisen bewerteten Volumen desselben Quartals des jeweiligen Vorjahrs Bezug nehmen. Diese Methode führt jedoch zu Ergebnissen, die von strukturellen Brüchen in allen Quartalen beeinflusst sind, so dass jede Änderungsrate gegenüber dem Vorquartal von einem Bruch betroffen ist. Die Over-the-year-Methode wirkt sich am stärksten auf das unterjährige Profil einer Reihe aus. |
|
12.39 |
Vorausgesetzt, die Substitutionseffekte (Volumenänderungen aufgrund von Verschiebungen in der Preisstruktur) innerhalb eines Jahres sind gering, führen die drei Methoden zur Verkettung der Volumen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Aufgrund von praktischen Erwägungen, wie beispielsweise der Konsistenz des vierteljährlichen Wachstums mit dem jährlichen verketteten Wachstum sowie der Einfachheit und Transparenz der Berechnung, wird die Annual-overlap-Methode empfohlen. |
Saison- und Kalenderbereinigungen
|
12.40 |
Saisonal ist jedes Muster, das sich jedes Jahr im selben Zeitraum regelmäßig wiederholt. Ein Beispiel ist der Verkauf von Eiskrem im Sommer. Die im Jahresverlauf regelmäßig und wiederholt auftretenden Einflüsse werden saisonbereinigt geglättet, während die Auswirkungen unregelmäßig auftretender Ereignisse unberührt bleiben. Zur Saisonbereinigung gehört die Berücksichtigung der unterschiedlichen Längen der Monate- bzw. Quartale. Saisonbereinigte Ergebnisse spiegeln die „normalen“ und wiederholt auftretenden Ereignisse eines gesamten Jahres wider. Folgende Merkmale werden von saisonbereinigten stärker als von nicht saisonbereinigten Reihen verdeutlicht:
|
|
12.41 |
Beim Kalendereffekt wirken sich folgende Aspekte auf eine Zeitreihe aus:
|
|
12.42 |
Das Auftreten von Saison– und Kalendereffekten in den Zeitreihen der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erschwert das Erkennen des Wachstumstrends der Aggregate der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Bereinigung um Saison– und Kalendereffekte erleichtert es daher, aus den vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf Trends zu schließen; ferner verdeutlicht die Saisonbereinigung die Auswirkungen größerer unregelmäßiger Effekte oder Ereignisse und erleichtert damit das Verständnis wirtschaftlicher Entwicklungen anhand der Statistiken der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. |
|
12.43 |
Saisonale Schwankungen sind gemeinhin der Effekt von Schwankungen bei Energieverbrauch, Fremdenverkehr, Wetterverhältnissen (diese beeinflussen Wirtschaftsaktivitäten im Freien, z. B. die Bautätigkeit), Lohn– und Gehaltsprämien und den Auswirkungen fester Feiertage sowie institutionellen oder administrativen Praktiken aller Art. Saisonale Schwankungen in vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen hängen auch von den verwendeten Datenquellen und Erstellungsmethoden ab. |
|
12.44 |
Um eine zuverlässige Schätzung saisonaler Faktoren zu erhalten, müssen die Zeitreihen gegebenenfalls vorbehandelt werden. Dadurch wird vermieden, dass Ausreißer, z. B. Impulsausreißer, vorübergehende Änderungen und Niveauverschiebungen, Kalendereffekte und staatliche Feiertage die Qualität der saisonalen Schätzungen beeinträchtigen. Dennoch müssen Ausreißer in den saisonbereinigten Daten erkennbar bleiben (außer wenn sie auf Fehler zurückzuführen sind), da sie spezifische Ereignisse wie Arbeitsniederlegungen, Naturkatastrophen etc. widerspiegeln können. Deshalb müssen Ausreißer wieder in die Zeitreihen eingefügt werden, nachdem die saisonalen Komponenten geschätzt wurden. |
Abfolge der Erstellung saisonbereinigter verketteter Volumenmessungen
|
12.45 |
Die Erstellung saison- und kalenderbereinigter verketteter Volumenmessungen vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ist das Ergebnis einer Reihe von Verfahren wie Saison- und Kalenderbereinigung, Verkettung, Benchmarking und Bilanzierung, die auf die verfügbaren grundlegenden oder aggregierten Informationen angewandt werden. |
|
12.46 |
Die Abfolge der verschiedenen Arbeitsschritte der Erstellung saisonbereinigter verketteter Volumenmessungen vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen hängt von den Besonderheiten des Produktionsverfahrens und dem Aggregationsniveau, auf dem es angewandt wird, ab. Idealerweise werden saisonbereinigte verkettete Volumenreihen durch die Saisonbereinigung der verketteten Reihen und ein anschließendes Benchmarking der bereinigten verketteten Reihen gewonnen. |
|
12.47 |
Es gibt Systeme zur Erstellung vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, in denen saisonbereinigte Daten auf einer sehr niedrigen Darstellungsebene produziert werden, gegebenenfalls sogar auf einer Ebene, auf der keine Verkettung erfolgt, z. B. bei der Gewinnung vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen aus vierteljährlichen Aufkommens– und Verwendungstabellen. Dabei gilt die Reihenfolge: Saisonbereinigung, Bilanzierung, Verkettung und Benchmarking. Auf einem disaggregierten Niveau können die Schätzungen der saisonalen Komponente weniger zuverlässig sein als auf einem höheren Niveau vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Besondere Sorgfalt erfordert sodann die Revision der saisonalen Komponente. Ferner darf die Bilanzierung aus und die Verkettung von saisonbereinigten Daten zu keinem saisonalen Muster führen, das in die Reihen eingefügt wird. |
|
12.48 |
Volumenmessungen vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen in Durchschnittspreisen des Vorjahres können mithilfe der One-Quarter-overlap-, der Annual-overlap- oder der Over-the-year-Methode verkettet werden. Aus der Sicht der Saisonbereinigung von Volumenmessungen vierteljährlicher Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen werden die One-Quarter-overlap-Methode und die Annual-overlap-Methode bevorzugt. Die Over-the-year-Methode wird nicht empfohlen, da sie zu Brüchen in jeder einzelnen Bewegung der Reihen gegenüber dem Vorquartal führen kann. |
|
12.49 |
Saisonbereinigte verkettete vierteljährliche Volumenmessungen sind beschränkt auf die jeweiligen nicht saisonbereinigten verketteten jährlichen Daten unter Verwendung von Benchmarking– oder Begrenzungsverfahren, die die Auswirkungen auf die Änderungen gegenüber dem Vorquartal minimieren. Die Anwendung des Benchmarkingverfahrens hat rein praktische Gründe, z. B. die Konsistenz der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten. Benchmarking darf nicht zur Einführung eines saisonalen Musters in die Reihen führen. Bezug genommen werden muss auf die unabhängig hergeleiteten verketteten jährlichen Reihen in unbereinigter Form für nur saisonbereinigte vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Ausnahmen von der erwünschten zeitlichen Konsistenz sind möglich, wenn rasche Änderungen der Saisonalität auftreten. |
|
12.50 |
Der Kalendereffekt lässt sich in eine saisonale und eine nicht saisonale Komponente aufteilen. Erstere entspricht der durchschnittlichen Kalendersituation, die sich jedes Jahr in derselben Jahreszeit wiederholt; letztere entspricht der Abweichung der Kalendervariablen (wie die Zahl der Handelstage/Arbeitstage beweglichen Feiertage und Schalttage) vom monats- oder quartalsspezifischen Durchschnitt. |
|
12.51 |
Die Kalenderbereinigung entfernt diejenigen nicht saisonalen Kalendereffekte (die Kalendereffektkomponenten) aus den Reihen, für die es einen statistischen Nachweis und eine wirtschaftliche Erklärung gibt. Kalendereffekte, um die eine Reihe bereinigt wird, sollten identifizierbar und im Zeitablauf stabil genug sein; ansonsten sollte es möglich sein, ihre veränderlichen Auswirkungen im Zeitablauf angemessen abzubilden. |
KAPITEL 13
REGIONALE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN
EINFÜHRUNG
|
13.01 |
Dieses Kapitel enthält einen allgemeinen Überblick über regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und erläutert die Ziele und die wichtigsten konzeptionellen Grundsätze sowie typische Probleme, die bei der Erstellung regionaler Gesamtrechnungen auftreten. |
|
13.02 |
Definition: Bei den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen handelt es sich um regionalisierte Darstellungen der entsprechenden nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen liefern eine regionale Untergliederung für Schlüsselaggregate wie Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und Haushaltseinkommen. |
|
13.03 |
Sofern in diesem Kapitel nichts anderes angegeben ist, liegen den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die gleichen Konzepte zugrunde wie den nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Hinter den volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen verbergen sich Unterschiede bei den regionalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Leistung. Bevölkerungszahl und Wirtschaftstätigkeiten sind in der Regel ungleich auf die Regionen verteilt. Städtische Regionen sind meist auf Dienstleistungen spezialisiert, während die Landwirtschaft, der Bergbau und die verarbeitende Industrie eher in nichtstädtischen Regionen angesiedelt sind. Wichtige Themen wie Globalisierung, Innovation, Alterung der Bevölkerung, Steuern, Armut, Arbeitslosigkeit und Umwelt besitzen oftmals eine regionale wirtschaftliche Dimension. Die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen bilden daher eine wichtige Ergänzung zu den nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. |
|
13.04 |
Die regionalen Gesamtrechnungen umfassen dasselbe Kontensystem wie die nationalen Gesamtrechnungen, machen also regionale wirtschaftliche Strukturen, Entwicklungen und Unterschiede sichtbar. Ihr Umfang und ihre Darstellungstiefe sind jedoch aufgrund konzeptioneller Probleme und Messprobleme begrenzter als bei den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf nationaler Ebene. Die Tabellen der regionalen Produktionstätigkeiten nach Wirtschaftsbereichen zeigen:
Die regionalen Konten der Einkommen der privaten Haushalte bilden das Primäreinkommen und das verfügbare Einkommen der Haushalte nach Regionen sowie die Einkommensquellen und die Einkommensverteilung nach/zwischen den Regionen ab. |
|
13.05 |
In einigen Mitgliedstaaten besitzen Regionen auf verschiedenen Ebenen umfassende Autonomie bei der Entscheidungsfindung. Die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für solche Regionen sind dann von Bedeutung für die nationale und die regionale Politik. |
|
13.06 |
Die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dienen auch wichtigen spezifischen Verwaltungszwecken, z. B.:
|
|
13.07 |
Die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen können auf verschiedenen Aggregationsebenen flexibel genutzt werden. Diese entsprechen nicht nur geografischen Regionen. Die geografischen Regionen können auch nach Wirtschaftsstruktur, Lage und Wirtschaftsbeziehungen mit anderen (angrenzenden) Regionen gruppiert werden. Dies ist insbesondere für die Analyse nationaler und europäischer Wirtschaftsstrukturen und Wirtschaftsentwicklungen von Bedeutung. |
|
13.08 |
Die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden auf der Grundlage von direkt erhobenen regionalen Daten und nationalen Daten mit regionalen Untergliederungen auf der Grundlage von Annahmen erstellt. Je vollständiger die direkt erhobenen Daten sind, desto geringer ist die Bedeutung von Annahmen. Fehlt es jedoch an hinreichend vollständigen, aktuellen und zuverlässigen regionalen Informationen, sind für die Erstellung der regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen Annahmen erforderlich. Das bedeutet, dass einige Unterschiede zwischen den Regionen in den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht zwingend zum Ausdruck kommen. |
DAS GEBIET EINER REGION
|
13.09 |
Die Volkswirtschaft einer Region eines Landes ist Teil der Volkswirtschaft des betreffenden Landes. Letztere wird unter Zugrundelegung von institutionellen Einheiten und Sektoren dargestellt und umfasst alle institutionellen Einheiten, die ihren Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Hauptinteresses im Wirtschaftsgebiet eines Landes haben (siehe 2.04). Das Wirtschaftsgebiet eines Landes entspricht nicht exakt dem geografischen Gebiet (siehe 2.05). Es wird untergliedert in die Gebiete der Regionen und die Extra-Regio. |
|
13.10 |
Das Gebiet einer Region umfasst den Teil des Wirtschaftsgebiets eines Landes, der unmittelbar einer Region zuzurechnen ist, einschließlich Zollfreigebiete, Zollfreilager und Fabriken unter Zollaufsicht. |
|
13.11 |
Die Extra-Regio umfasst die Teile des Wirtschaftsgebiets eines Landes, die nicht einer einzelnen Region zuzurechnen sind. Dazu zählen:
|
|
13.12 |
Das Wirtschaftsgebiet der Europäischen Union lässt sich anhand der NUTS-Klassifikation nach einheitlichen Kriterien untergliedern. Für nationale Zwecke können die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch auf einer tieferen regionalen Darstellungsebene erstellt werden. |
EINHEITEN UND REGIONALE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN
|
13.13 |
In der Volkswirtschaft wird zwischen zwei Arten von Einheiten unterschieden. Die Daten für institutionelle Einheiten werden zur Darstellung der Ströme, die das Einkommen, das Vermögen und die finanziellen Transaktionen betreffen, sowie für die Darstellung der sonstigen Ströme und der Vermögensbilanzen verwendet. Für die Darstellung der im Produktionsprozess und bei der Verwendung von Waren und Dienstleistungen anfallenden Ströme werden Daten für die örtliche fachliche Einheit (örtliche FE) herangezogen. |
Institutionelle Einheiten
|
13.14 |
Für die regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird je nach regionaler Ebene zwischen zwei Arten von institutionellen Einheiten unterschieden:
|
|
13.15 |
Alle Transaktionen der uniregionalen Einheiten sind der Region zuzurechnen, in der diese Einheiten den Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Hauptinteresses haben. Der Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses der privaten Haushalte liegt in der Region, in der die Haushaltsmitglieder ansässig sind, und nicht in der Region, in der sie arbeiten. Der Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses aller anderen uniregionalen Einheiten liegt in der Region, in der sie ihren Sitz haben. |
|
13.16 |
Ein Teil der Transaktionen der multiregionalen Einheiten kann nicht einzelnen Regionen zugeordnet werden. Dies gilt für die meisten Verteilungstransaktionen und finanziellen Transaktionen. Demzufolge werden Kontensalden wie Sparen und Finanzierungssaldo auf regionaler Ebene für multiregionale Einheiten nicht erfasst. |
Örtliche fachliche Einheiten und regionale Produktionstätigkeiten nach Wirtschaftsbereichen
|
13.17 |
Unternehmen können Produktionstätigkeiten an mehr als einem Standort ausüben; für die Zwecke der regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist es in diesem Fall erforderlich, die Tätigkeiten einem Standort zuzuordnen. Werden Unternehmen nach Standorten aufgeteilt, werden die einzelnen Unternehmenseinheiten als örtliche Einheiten bezeichnet. |
|
13.18 |
Institutionelle Einheiten können Wirtschaftszweigen zugeordnet werden, um die Produktionstätigkeiten der Volkswirtschaft nach Wirtschaftsbereichen darzustellen. Das Ergebnis ist jedoch eine Vielzahl heterogener Wirtschaftsbereiche, denn einige Unternehmen üben in erheblichem Umfang Nebentätigkeiten aus, die sich von ihrer Haupttätigkeit unterscheiden. Es bedeutet auch, dass in einigen Wirtschaftsbereichen das Hauptprodukt nur einen kleinen Teil der Gesamtproduktion des Wirtschaftsbereichs darstellt. Um Gruppen von Produzenten zu erhalten, deren Tätigkeiten im Hinblick auf Produktionswert, Kostenstruktur und Produktionstechnologien eine höhere Homogenität aufweisen, werden die Unternehmen in kleinere, homogenere Einheiten aufgeteilt. Diese werden als fachliche Einheiten bezeichnet. |
|
13.19 |
Die örtliche fachliche Einheit (örtliche FE) ist derjenige Teil einer fachlichen Einheit (FE), der sich auf örtlicher Ebene befindet. Wenn eine FE in mehreren Regionen Produktionstätigkeiten ausübt, werden die Informationen über die FE aufgeteilt, um regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen erstellen zu können. Für diese Aufteilung werden Angaben über Arbeitnehmerentgelt bzw., wenn diese nicht verfügbar sind, über Erwerbstätige und über Bruttoanlageinvestitionen benötigt. Bei Unternehmen mit einem einzigen Standort, deren Haupttätigkeit den größten Teil der Wertschöpfung ausmacht, entspricht die örtliche FE dem Unternehmen. |
|
13.20 |
Ein Wirtschaftsbereich auf regionaler Ebene umfasst eine Gruppe örtlicher FE, die gleiche oder ähnliche Arten von Tätigkeiten ausüben. |
|
13.21 |
Im Zusammenhang mit der Definition einer örtlichen FE sind drei Fälle zu unterscheiden:
|
|
13.22 |
Produktionstransaktionen zwischen örtlichen FE mit Sitz in unterschiedlichen Regionen, die derselben institutionellen Einheit angehören, werden explizit erfasst. Für die Erbringung von Hilfstätigkeiten zwischen örtlichen FE wird jedoch kein Produktionswert ausgewiesen, wenn es sich nicht um statistisch beobachtbare Leistungen handelt (siehe 1.31). Das bedeutet, dass nur als Haupt- oder Nebentätigkeit erbrachte Leistungen zwischen örtlichen FE mit ihrem Produktionswert verbucht werden, soweit dies der Praxis in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entspricht. |
|
13.23 |
Wenn ein Betrieb, der lediglich Hilfstätigkeiten ausübt, insofern statistisch beobachtbar ist, als gesonderte Konten für seine Produktion jederzeit verfügbar sind, oder wenn sich sein geografischer Standort von dem der Betriebe, die er beliefert, unterscheidet, wird er als gesonderte Einheit gebucht und sowohl in den nationalen als auch in den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dem Wirtschaftsbereich zugewiesen, der seiner Haupttätigkeit entspricht. Sind keine geeigneten Daten verfügbar, so wird der Produktionswert der Hilfstätigkeit durch Kostensummierung geschätzt. |
REGIONALISIERUNGSVERFAHREN
|
13.24 |
In den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden die Transaktionen von Einheiten erfasst, die im Gebiet einer Region ansässig sind. In der Regel erfolgt die Erstellung der regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen anhand der folgenden Methoden:
|
|
13.25 |
Bei der Bottom-up-Methode (Von-unten-nach-oben-Methode) zur Schätzung eines regionalen Aggregats werden Informationen über Einheiten, die in der Region ansässig sind, direkt erfasst und die regionalen Schätzwerte durch Aggregation erstellt. Eine Pseudo-Bottom-up-Methode ist zulässig, wenn keine Daten über örtliche FE verfügbar sind. Daten über örtliche FE können unter Verwendung von Verteilungsmodellen anhand von Daten über das Unternehmen, die FE oder die örtliche Einheit geschätzt werden. Die Schätzwerte werden anschließend genau wie bei der Bottom-up-Methode zu regionalen Gesamtgrößen aggregiert. In der zweiten Phase des Erstellungsverfahrens werden die Bottom-up-Schätzwerte auf die Gesamtgrößen der nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen abgestimmt. |
|
13.26 |
Sind nur Informationen über Einheiten verfügbar, die mehrere örtliche FE umfassen, welche unterschiedliche Tätigkeiten ausüben und in verschiedenen Regionen ihren Sitz haben, wird für die Regionalisierung der Angaben nach Wirtschaftsbereichen auf Indikatoren (z. B. auf die Regionen entfallendes Arbeitnehmerentgelt oder Erwerbstätige) zurückgegriffen. |
|
13.27 |
Bei der Top-down-Methode wird eine nationale Gesamtgröße auf die einzelnen Regionen verteilt, ohne dass der Versuch einer Zuordnung zu einzelnen, in der Region ansässigen Einheiten unternommen wird. Für die Verteilung der nationalen Größen wird ein Indikator verwendet, wobei die zu schätzende Variable entsprechend der regionalen Verteilung des Indikators auf die Regionen verteilt wird. Das Konzept der in einer Region ansässigen Einheit wird benötigt, damit der für die regionale Verteilung der erforderlichen Variablen verwendete Indikator die regionalen Besonderheiten widerspiegelt. |
|
13.28 |
Die Bottom-up-Methode wird selten in reiner Form angewandt. Deshalb sind auch Mischformen akzeptabel. Beispielsweise können regionale Schätzwerte für eine Variable oder ein Aggregat von Variablen auf makroregionaler Ebene unter Umständen nur mit Hilfe der Bottom-up-Methode erstellt werden. Für die Erstellung von Schätzwerten auf einer tieferen regionalen Ebene wird dann die Top-down-Methode verwendet. |
|
13.29 |
Die direkte Messung regionaler Gesamtgrößen wird der indirekten Messung vorgezogen. Wenn vollständige und zuverlässige Mikrodaten auf der Ebene der örtlichen FE verfügbar sind, so werden regionale Gesamtgrößen, die konzeptionell den nationalen volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen entsprechen, mithilfe der Bottom-up-Methode geschätzt. Um Konsistenz mit den nationalen volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen herzustellen, werden diese Schätzungen der regionalen Gesamtrechnungen anschließend mit den nationalen volkswirtschaftlichen Aggregaten abgestimmt. |
|
13.30 |
Bei der indirekten Messung auf der Grundlage nationaler Aggregate und eines Indikators, der mit der zu berechnenden Variablen korreliert, sind Messfehler möglich. Beispielsweise können nationale Daten über die Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen anhand regionaler Beschäftigungsstatistiken, unter der Annahme, dass die Bruttowertschöpfung je Beschäftigten in jedem Wirtschaftsbereich in allen Regionen gleich ist, Regionen zugeordnet werden. Solche Top-down-Berechnungen werden verbessert, wenn sie auf einer tiefen Stufe der Untergliederung nach Wirtschaftsbereichen erfolgen. |
|
13.31 |
Die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen über die Produktionstätigkeit werden der Region zugerechnet, in der die Einheit, die die betreffenden Transaktionen durchführt, ihren Sitz hat. Der Sitz einer örtlichen FE ist ein entscheidendes Kriterium für die Zuordnung solcher Gesamtgrößen zu einer bestimmten Region. Die Anwendung des Konzepts der Gebietsansässigkeit ist einem territorialen Ansatz vorzuziehen, bei dem Produktionstätigkeiten auf der Grundlage des Standortes verteilt werden, an dem sie ausgeübt werden. |
|
13.32 |
Spezifische Wirtschaftsbereiche wie Baugewerbe, Energieerzeugung und -verteilung, Kommunikationsnetze, Verkehr, finanzielle Mittlertätigkeiten sowie einige Transaktionen in den Konten der privaten Haushalte (z. B. Vermögenseinkommen) sind bei der Zuordnung zu Regionen mit spezifischen Problemen konfrontiert. Für die internationale Vergleichbarkeit der regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden dieselben Aufbereitungsmethoden oder Methoden, die zu ähnlichen Ergebnissen führen, angewandt. |
|
13.33 |
Bruttoanlageinvestitionen werden nach dem Eigentumskriterium auf die Regionen verteilt. Anlagegüter, die einer multiregionalen Einheit gehören, werden derjenigen örtlichen FE zugeordnet, von der sie genutzt werden. Die im Rahmen von Operating-Leasing genutzten Anlagegüter werden der Region des Eigentümers der Anlagegüter zugeordnet, die im Rahmen von Finanzierungsleasing genutzten dagegen der Region des Nutzers. |
AGGREGATE FÜR PRODUKTIONSTÄTIGKEITEN
Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt nach Regionen
|
13.34 |
Zur Schätzung des regionalen Bruttoinlandsprodukts können drei Ansätze angewandt werden: der Produktionsansatz (Entstehungsrechnung), der Einkommensansatz (Verteilungsrechnung) und der Ausgabenansatz (Verwendungsrechnung). |
|
13.35 |
Nach dem Produktionsansatz wird das regionale Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen als Summe der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen zuzüglich der Gütersteuern abzüglich der Gütersubventionen gemessen. Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird als Differenz zwischen dem Produktionswert zu Herstellungspreisen und den Vorleistungen zu Anschaffungspreisen ermittelt. |
|
13.36 |
Nach dem Einkommensansatz wird das regionale Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen durch Messung und Aggregation der verschiedenen Positionen auf der Verwendungsseite im regionalen Teil des Einkommensentstehungskontos der gesamten Volkswirtschaft berechnet: Arbeitnehmerentgelt, Bruttobetriebsüberschuss und Produktionsabgaben abzüglich Subventionen. Nach Wirtschaftsbereichen gegliederte Informationen über Arbeitnehmerentgelt (und Beschäftigung) sind häufig auf regionaler Ebene verfügbar. Diese Informationen werden genutzt, um die Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen direkt oder mittels des Produktionsansatzes zu schätzen. Bei der Berechnung des regionalen Bruttoinlandsprodukts kommt es zu Überschneidungen zwischen Einkommensansatz und Produktionsansatz. |
|
13.37 |
Informationen über den Bruttobetriebsüberschuss sind in der Regel nicht nach Wirtschaftsbereichen und Regionen untergliedert verfügbar. Informationen über den Bruttobetriebsüberschuss von Marktproduzenten können aus der betrieblichen Buchführung der Unternehmen abgeleitet werden. Eine Untergliederung nach institutionellen Sektoren und nach Regionen ist häufig nicht verfügbar. Dies stellt ein Hindernis für die Anwendung des Einkommensansatzes auf die Schätzung des regionalen Bruttoinlandsprodukts dar. |
|
13.38 |
Produktionsabgaben (abzüglich Subventionen) umfassen Gütersteuern (abzüglich Subventionen) und sonstige Produktionsabgaben (abzüglich Subventionen). Die Zuordnung der Gütersteuern (abzüglich Subventionen) wird in 13.43 erörtert. Informationen über sonstige Produktionsabgaben (abzüglich Subventionen) sind gegebenenfalls nach Wirtschaftsbereichen untergliedert verfügbar, z. B. in Form von Unternehmensumfragen oder durch Rückschlüsse aus der spezifischen Steuer- oder Subventionsart des betreffenden Wirtschaftsbereichs. Diese können dann als Indikator für die Zuordnung der Bruttowertschöpfung nach Regionen herangezogen werden. |
|
13.39 |
Für die Berechnung des regionalen Bruttoinlandsprodukts wird der Ausgabenansatz aufgrund fehlender Daten nicht angewendet. So fehlt es beispielsweise an direkten Informationen über interregionale Käufe und Verkäufe sowie an einer Untergliederung von Exporten und Importen nach Regionen. |
Aufgliederung der FISIM nach verwendenden Wirtschaftsbereichen
|
13.40 |
Die unterstellten Bankgebühren (FISIM) (Financial Intermediation Services, Indirectly Measured — Finanzserviceleistungen, indirekte Messung) werden in den regionalen Gesamtrechnungen genauso behandelt wie in den nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Aufgliederung der FISIM-Vorleistungen der einzelnen verwendenden Wirtschaftsbereiche auf die Regionen wirft jedoch ein Problem auf, da Schätzungen über Kredit- und Einlagenbestände auf regionaler Ebene in der Regel nicht verfügbar sind. In diesem Fall erfolgt die Aufgliederung unter Verwendung der zweitbesten Methode: Hier wird der regionale Wert der Bruttoproduktion oder der Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen als Verteilungsindikator verwendet. |
Erwerbstätigkeit
|
13.41 |
Die Messungen der regionalen Produktionstätigkeiten sind dann mit den Schätzungen der Erwerbstätigen in einer Region konsistent, wenn die Erwerbstätigen in einer Region sowohl Gebietsansässige als auch Gebietsfremde, die für regionale produzierende Einheiten arbeiten, umfassen. Regionale Erwerbstätige werden in Übereinstimmung mit den auf nationaler Ebene geltenden Grundsätzen für Erwerbstätige und Wohnsitz (siehe 11.17) definiert. |
Arbeitnehmerentgelt
|
13.42 |
Bei den Produzenten wird das Arbeitnehmerentgelt den örtlichen FE zugerechnet, bei denen die Arbeitnehmer beschäftigt sind. Sind diese Daten nicht verfügbar, wird als zweitbeste Methode das Arbeitnehmerentgelt nach dem Arbeitsvolumen aufgeteilt. Sind weder Arbeitnehmerentgelt noch Arbeitsvolumen verfügbar, wird die Zahl der bei den örtlichen FE Beschäftigten verwendet. Das Arbeitnehmerentgelt in den Konten der privaten Haushalte wird nach Wohnsitz den einzelnen Regionen zugeordnet. |
Übergang von der regionalen Bruttowertschöpfung zum regionalen BIP
|
13.43 |
Um das BIP zu Marktpreisen für die Regionen zu berechnen, werden Gütersteuern und Gütersubventionen auf die Regionen verteilt. Vereinbarungsgemäß werden diese überregionalen Steuern und Subventionen nach der relativen Höhe der zu Herstellungspreisen nachgewiesenen Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche der Region verteilt. Für Gebiete mit besonderen Steuersystemen, die zu stark abweichenden Gütersteuer- und Gütersubventionssätzen innerhalb eines Landes führen, können von Fall zu Fall alternative Verteilungsmethoden angewandt werden. |
|
13.44 |
Für das BIP aller Regionen können Pro-Kopf-Werte berechnet werden. Auf der Ebene von Extra-Regio findet diese Berechnung nicht statt. |
|
13.45 |
Pendlerströme zwischen den Regionen können das regionale Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt erheblich beeinflussen. Durch Nettoströme von Einpendlern in die Regionen wird die Produktion auf ein Niveau gesteigert, das die gebietsansässige erwerbstätige Bevölkerung allein nicht erreichen könnte. Das Pro-Kopf-BIP in Regionen mit Nettoströmen von Einpendlern ist relativ hoch und in Regionen mit Nettoströmen von Auspendlern relativ niedrig. |
Volumenwachstumsraten der regionalen Bruttowertschöpfung
|
13.46 |
Bei der Messung von Preis- und Volumenänderungen gelten die auf die nationale Volkswirtschaft angewandten Grundsätze auch für die Regionen. Dennoch treten Probleme mit den Regionaldaten auf, die die Anwendung dieser Grundsätze auf die Regionen erschweren, z. B.:
|
|
13.47 |
Ein Ansatz, auf den häufig zurückgegriffen wird, ist daher die Deflationierung der regionalen Wertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen auf der Basis nationaler Preisänderungen nach Wirtschaftsbereichen. Dies erfolgt auf der tiefsten Ebene, auf der die Wertschöpfung in jeweiligen Preisen verfügbar ist, wobei die Unterschiede zwischen Preisänderungen auf nationaler und auf regionaler Ebene berücksichtigt werden, die durch Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur der einzelnen Wirtschaftsbereiche bedingt sind. Bei größeren Abweichungen zwischen nationalen und regionalen Preisänderungen weist diese Lösung allerdings noch Schwächen auf. Beispiele für solche Abweichungen:
|
|
13.48 |
Methoden für die Deflationierung der regionalen Wertschöpfung:
|
REGIONALE EINKOMMENSKONTEN DER PRIVATEN HAUSHALTE
|
13.49 |
Aus der Einkommensverteilung und -umverteilung ergeben sich weitere Kontensalden wie das Primäreinkommen und das verfügbare Einkommen. In den regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind diese Einkommensmessungen auf private Haushalte beschränkt. |
|
13.50 |
Bei den regionalen Konten der privaten Haushalte handelt es sich um eine nach Regionen aufgeschlüsselte Darstellung der entsprechenden Konten auf nationaler Ebene. Aus messtechnischen Gründen werden auf regionaler Ebene lediglich folgende Konten erstellt:
Mit diesen Konten werden das Primäreinkommen und das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte mit Wohnsitz in einer bestimmten Region erfasst (siehe Tabelle 13.1). Tabelle 13.1 — Regionale Einkommenskonten der privaten Haushalte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.51 |
Die regionalen Konten der privaten Haushalte beziehen sich auf die privaten Haushalte mit Wohnsitz im Gebiet einer Region. Die Summe der Mitglieder privater Haushalte mit Wohnsitz in der Region ist gleich der gesamten gebietsansässigen Bevölkerung der Region. |
|
13.52 |
Die auf nationaler Ebene gültigen allgemeinen Regeln für die Bestimmung des Wohnsitzes privater Haushalte gelten auch für die regionalen Konten der privaten Haushalte. Liegt die Gastregion im gleichen Land wie die Wohnsitzregion, werden im Wege einer Ausnahme Studenten und Langzeitpatienten als Gebietsansässige der Gastregion behandelt, wenn sie sich länger als ein Jahr dort aufhalten. |
|
13.53 |
Die Konten der privaten Haushalte können um Einkommensverwendungskonten erweitert werden. Dies erfordert die Regionalisierung der in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ausgewiesenen statistischen Daten über die Konsumausgaben der privaten Haushalte und die Einbeziehung der Position Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche. Die regionale Ersparnis der privaten Haushalte ergibt sich als Saldo. |
|
13.54 |
Die Regionalisierung der Konsumausgaben der privaten Haushalte erfordert zuverlässige regionale Informationen, etwa aus einer erweiterten Erhebung über Wirtschaftsrechnungen. Häufig ist eine solche regionale Untergliederung jedoch nicht vorhanden. In den nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden die Konsumausgaben der privaten Haushalte oft anhand anderer Informationen geschätzt. Unter solchen Umständen ist eine regionale Untergliederung schwierig. |
|
13.55 |
Der Staat kann im Rahmen der Bereitstellung von Dienstleistungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens über soziale Sachtransfers eine bedeutende Rolle spielen. Diese sozialen Sachtransfers haben in den verschiedenen Ländern einen sehr unterschiedlichen Stellenwert und können größere Schwankungen im Zeitablauf aufweisen. Durch eine Zuordnung dieser sozialen Sachtransfers zu Regionen lassen sich der regionale Konsum der privaten Haushalte nach dem Verbrauchskonzept und das verfügbare Einkommen der Haushalte nach dem Verbrauchskonzept ermitteln. In Anbetracht der Bedeutung sozialer Sachtransfers in einigen Mitgliedstaaten kann für die privaten Haushalte ein Vergleich des Konsums nach dem Verbrauchskonzept und des verfügbaren Einkommens nach dem Verbrauchskonzept in den einzelnen Mitgliedstaaten ein ganz anderes Bild ergeben als ein Vergleich nur auf der Grundlage der Konsumausgaben und des verfügbaren Einkommens. |
KAPITEL 14
UNTERSTELLTE BANKGEBÜHREN (FISIM)
DAS KONZEPT DER FISIM UND DIE AUSWIRKUNGEN IHRER AUFGLIEDERUNG NACH VERWENDERN AUF DIE WICHTIGSTEN AGGREGATE
|
14.01 |
Eine traditionelle Form der Erbringung von Finanzdienstleistungen ist die finanzielle Mittlertätigkeit, also die Tätigkeit eines Finanzinstituts, etwa einer Bank, die darin besteht, Einlagen von Einheiten entgegenzunehmen, die Mittel zinsbringend anlegen möchten, und diese anschließend an andere Einheiten auszuleihen, deren eigene Mittel zur Deckung ihrer Bedürfnisse nicht ausreichen. Die Bank stellt also einen Mechanismus zur Verfügung, der es der ersten Einheit ermöglicht, der zweiten Einheit Mittel zu leihen. Die geldgebende Einheit akzeptiert dabei einen Zinssatz unter dem vom Kreditnehmer gezahlten Satz. Ein „Referenzzinssatz“ ist der Satz, zu dem sich sowohl Geldgeber als auch Kreditnehmer einen Geschäftsabschluss wünschen würden. Die Differenz zwischen dem Referenzzinssatz und dem tatsächlich an die Einleger gezahlten und den Kreditnehmern in Rechnung gestellten Zinssatz sind die unterstellten Bankgebühren (Financial Intermediation Service Charge Indirectly Measured, FISIM). Die Summe der beiden vom Kreditnehmer und vom Geldgeber gezahlten unterstellten Entgelte bildet den FISIM-Gesamtbetrag. |
|
14.02 |
Selten entspricht jedoch der Betrag der von einem Finanzinstitut verliehenen Mittel exakt dem Betrag der von ihm hereingenommenen Einlagen. So wurden vielleicht Gelder hereingenommen, aber noch nicht verliehen; umgekehrt finanziert die Bank möglicherweise einige Kredite aus Eigenmitteln und nicht aus geliehenen Mitteln. Der Einleger erhält indessen die gleichen Zinsen und Bankdienstleistungen des gleichen Umfangs, ob seine Mittel nun weiterverliehen wurden oder nicht, und auch der Kreditnehmer zahlt den gleichen Zinssatz und kommt in den Genuss der gleichen Bankdienstleistungen, unabhängig davon, ob sein Kredit aus im Rahmen der finanziellen Mittlertätigkeit verwalteten Mitteln oder aus eigenen Mitteln der Bank stammt. Aus diesem Grund werden für alle Kredite und Einlagen eines Finanzinstituts ungeachtet der Herkunft der Mittel FISIM geschätzt. Die verbuchten Zinsbeträge werden berechnet, indem der Referenzzinssatz mit der Höhe des betreffenden Kredits oder der betreffenden Einlage multipliziert wird. Die Differenz zwischen diesen und den tatsächlich an das oder vom Finanzinstitut gezahlten Beträgen wird als das vom Kreditnehmer oder Einleger an das Finanzinstitut entrichtete indirekte („unterstellte“) Dienstleistungsentgelt verbucht. Die im Kontensystem als Zinsen erfassten Beträge werden als „ESVG-Zinsen“ und die tatsächlich an das oder von dem Finanzinstitut gezahlten Beträge als „Bankzinsen“ bezeichnet. Das unterstellte Dienstleistungsentgelt insgesamt ist die Summe der Bankzinsen für Kredite abzüglich der ESVG-Zinsen für die gleichen Kredite zuzüglich der ESVG-Zinsen für Einlagen abzüglich der Bankzinsen für die gleichen Einlagen. |
|
14.03 |
FISIM werden nur für Kredite und Einlagen erfasst, bei denen es sich um das Kredit- und Einlagengeschäft von Finanzinstituten handelt. Weder die betreffenden Finanzinstitute noch ihre Kunden müssen gebietsansässig sein. FISIM können importiert und exportiert werden. Das Finanzinstitut muss nicht sowohl die Hereinnahme von Einlagen als auch die Gewährung von Krediten anbieten. Die Finanztöchter von Einzelhandelsunternehmen sind Beispiele für Finanzinstitute, die Kredite gewähren, aber keine Einlagen entgegennehmen. Ein Geldgeber, der über eine hinreichend detaillierte Buchführung verfügt, um als Kapitalgesellschaft oder Quasi-Kapitalgesellschaft zu gelten, kann FISIM empfangen. |
|
14.04 |
Um beurteilen zu können, wie sich die Aufgliederung der FISIM im Vergleich zu ihrer Nichtaufgliederung auf BIP und Nationaleinkommen auswirkt, sind fünf Fälle in Betracht zu ziehen:
|
|
14.05 |
Ausgehend von den fünf unter 14.04 dargestellten Fällen lassen sich die Auswirkungen der FISIM-Aufgliederung auf BIP und Nationaleinkommen wie folgt zusammenfassen:
|
BERECHNUNG DER FISIM-PRODUKTION DER SEKTOREN S.122 UND S.125
|
14.06 |
FISIM werden von FM, nämlich der Zentralbank (S.121), Kreditinstituten (ohne die Zentralbank) (S.122) und sonstigen Finanzmittlern (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) (S.125), produziert. Die Berechnung von FISIM konzentriert sich auf die Teilsektoren S.122 und S.125; für die Zentralbank werden vereinbarungsgemäß keine FISIM berechnet (siehe Teil VI). |
Benötigte statistische Daten
|
14.07 |
Für jeden der beiden Teilsektoren S.122 und S.125 werden Daten in Form einer Tabelle der Kredit- und Einlagenbestände benötigt, gegliedert nach verwendenden Sektoren, mit den Durchschnittswerten von vier Quartalen und den entsprechenden aufgelaufenen Zinsen. Die Zinsen werden nach Zuordnung der Zinszuschüsse zu ihren Empfängern berechnet. |
Referenzzinssätze
|
14.08 |
In der Vermögensbilanz der zu den Teilsektoren S.122 und S.125 gehörenden Finanzmittler sind Kredite an und Einlagen bei gebietsansässige(n) Einheiten so aufzugliedern, dass unterschieden wird zwischen:
Darüber hinaus werden Kredite an die und Einlagen bei der übrige(n) Welt (S.2) aufgegliedert nach Krediten an und Einlagen bei gebietsfremde(n) Finanzmittler(n) und Krediten an und Einlagen bei sonstige(n) Gebietsfremde(n). |
Interner Referenzzinssatz
|
14.09 |
Zur Ermittlung der nach gebietsansässigen verwendenden institutionellen Sektoren aufgegliederten FISIM-Produktion der gebietsansässigen FM wird der „interne“ Referenzzinssatz wie folgt als Quotient aus den empfangenen Zinsen auf Kredite innerhalb von und zwischen den Teilsektoren S.122 und S.125 und dem Bestand an Krediten innerhalb von und zwischen den Teilsektoren S.122 und S.125 berechnet:
Theoretisch ist der interne Referenzzinssatz gleich, wenn er anhand von Einlagendaten anstatt auf der Grundlage von Kreditdaten berechnet wird. Unstimmigkeiten in den Daten führen allerdings dazu, dass die Schätzungen anhand der Einlagendaten von den Schätzungen anhand der Kreditdaten abweichen. Sind die Einlagendaten zuverlässiger, so sollte der interne Referenzzinssatz für Interbankeinlagen als folgender Quotient berechnet werden:
Sind Kredit- und Einlagendaten gleichermaßen zuverlässig, so sollte der interne Referenzzinssatz auf Interbankkredite und -einlagen berechnet werden als Quotient aus den empfangenen Zinsen auf Kredite zuzüglich der gezahlten Zinsen auf Einlagen zwischen FM und dem Bestand an Krediten zuzüglich des Bestands an Einlagen von FM im Namen anderer FM. Wenn gebietsansässige FM für ihre gebietsansässigen Kunden Kredite in Fremdwährung bereitstellen und auf Fremdwährungen lautende Einlagen hereinnehmen, so sind mehrere „interne“ Referenzzinssätze nach Währungen oder Währungsgruppen zu berechnen, wenn dies die Schätzungen signifikant verbessert. Dabei ist sowohl für die Berechnung der „internen“ Referenzzinssätze als auch für die Kredit- und Einlagengeschäfte gebietsansässiger FM mit den einzelnen gebietsansässigen verwendenden Sektoren eine Aufgliederung nach Währungen oder Währungsgruppen vorzunehmen. |
Externe Referenzzinssätze
|
14.10 |
Zur Berechnung der Importe und Exporte von FISIM wird als Referenzzinssatz die durchschnittliche Interbankenrate verwendet, die mit den Werten zu gewichten ist, welche in der Vermögensbilanz der FM für die Positionen „Kredite zwischen gebietsansässigen FM einerseits und gebietsfremden FM andererseits“ und „Einlagen zwischen gebietsansässigen FM einerseits und gebietsfremden FM andererseits“ ausgewiesen sind. Somit wird der externe Referenzzinssatz berechnet als Quotient aus den Zinsen auf Kredite zuzüglich der Zinsen auf Einlagen zwischen gebietsansässigen FM und gebietsfremden FM und dem Bestand an Krediten zuzüglich des Bestands an Einlagen zwischen gebietsansässigen FM und gebietsfremden FM. Mehrere externe Referenzzinssätze sind für verschiedene Währungen oder Währungsgruppen zu berechnen, wenn für jede Währung oder Währungsgruppe Daten zu folgenden Kategorien zur Verfügung stehen und wenn dies die Schätzungen signifikant verbessert:
|
Detaillierte Untergliederung der FISIM nach institutionellen Sektoren
|
14.11 |
Vereinbarungsgemäß sind für das Interbankengeschäft zwischen gebietsansässigen FM oder zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden FM keine FISIM zu berechnen. FISIM werden nur für das Geschäft mit verwendenden institutionellen Sektoren des Nichtbankenbereichs berechnet. Für jeden institutionellen Nicht-FM-Sektor werden Daten nach der folgenden Tabelle der von gebietsansässigen FM gewährten Kredite und von ihnen hereingenommenen Einlagen benötigt:
Der FISIM-Gesamtbetrag nach institutionellen Sektoren ist gleich der Summe der FISIM auf Kredite an den jeweiligen institutionellen Sektor und der FISIM auf dessen Einlagen. Die FISIM auf die Kredite an den institutionellen Sektor werden geschätzt als empfangene Kreditzinsen abzüglich (Kreditbestand multipliziert mit dem internen Referenzzinssatz). Die FISIM auf die Einlagen des institutionellen Sektors werden geschätzt als (Einlagenbestand multipliziert mit dem internen Referenzzinssatz) abzüglich der gezahlten Einlagenzinsen. Ein Teil der Produktion wird exportiert; aus der Vermögensbilanz der FM ergibt sich folgende Tabelle:
FISIM-Exporte werden anhand des externen Interbanken-Referenzzinssatzes für Kredite an Gebietsfremde (ohne FM) geschätzt als empfangene Zinsen abzüglich (Kreditbestand multipliziert mit dem externen Referenzzinssatz). Exporte von FISIM auf Einlagen Gebietsfremder (ohne FM) werden geschätzt als (Einlagenbestand multipliziert mit dem externen Referenzzinssatz) abzüglich gezahlter Zinsen. Werden mehrere Referenzzinssätze für verschiedene Währungen oder Währungsgruppen verwendet, so werden die Kredite und Einlagen sowohl nach verwendenden institutionellen Sektoren als auch nach den Währungen (oder Währungsgruppen), auf die sie lauten, aufgegliedert. |
Untergliederung der den privaten Haushalten zugeordneten FISIM in Vorleistungen und Konsum
|
14.12 |
Die den privaten Haushalten zuzuordnenden FISIM werden in folgende Kategorien aufgegliedert:
Die Schätzmethode macht eine Untergliederung der Kredite an die privaten Haushalte (Bestände und Zinsen) in folgende Kategorien erforderlich:
Die Kredite an die privaten Haushalte in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und die Wohnungsbaukredite werden in den verschiedenen Aufgliederungen der Ausleihungen in den Geld- und Finanzstatistiken im Allgemeinen getrennt ausgewiesen. Die sonstigen Kredite an private Haushalte ergeben sich als Saldo aus der Subtraktion der beiden vorgenannten Kreditkategorien vom Gesamtwert. Die FISIM auf Kredite an die privaten Haushalte sind auf die drei Kategorien aufzuteilen, und zwar anhand von Angaben über Bestände und Zinsen jeder der drei Gruppen. Wohnungsbaukredite sind nicht identisch mit Hypothekarkrediten, da Letztere auch anderen Zwecken dienen können. Die Einlagen der privaten Haushalte werden aufgegliedert in:
In Ermangelung statistischer Daten über die Einlagen der privaten Haushalte in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit werden Einlagenbestände nach einer der folgenden Methoden berechnet:
FISIM auf Einlagen der privaten Haushalte sind in FISIM auf Einlagen der privaten Haushalte in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und FISIM auf Einlagen der privaten Haushalte in ihrer Eigenschaft als Konsumenten aufzuteilen, und zwar anhand der durchschnittlichen Bestände dieser beiden Kategorien, für die in Ermangelung näherer Angaben derselbe Zinssatz angewandt werden darf. Wenn genauere Angaben über die Kredite und Einlagen der privaten Haushalte fehlen, werden FISIM für die privaten Haushalte alternativ den Vorleistungen und dem Konsum zugeordnet, wobei davon ausgegangen wird, dass alle Kredite den privaten Haushalten in ihrer Eigenschaft als Produzenten oder Wohnungseigentümer und alle Einlagen den privaten Haushalten in ihrer Eigenschaft als Konsumenten zuzuordnen sind. |
BERECHNUNG VON FISIM-IMPORTEN
|
14.13 |
Gebietsfremde FM gewähren Gebietsansässigen Kredite und nehmen Einlagen von Gebietsansässigen herein. Für jeden institutionellen Sektor werden Daten nach der folgenden Tabelle benötigt.
FISIM-Importe für die einzelnen institutionellen Sektoren werden wie folgt berechnet:
Es wird empfohlen, mehrere externe Referenzzinssätze nach Währungen oder Währungsgruppen zu verwenden (siehe 14.10). |
FISIM ZU VORJAHRESPREISEN
|
14.14 |
Zur Schätzung von FISIM zu Vorjahrespreisen werden die durch Deflationierung mit einem allgemeinen Preisindex, etwa dem impliziten Preisdeflator für die Inlandsnachfrage, auf Preise der Basisperiode umgerechneten Bestände an Krediten und Einlagen zugrunde gelegt. Der Preis der FISIM setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: erstens der Differenz zwischen dem Bankzinssatz und dem Referenzzinssatz (bzw. umgekehrt im Fall von Einlagen), die der Gewinnspanne des Finanzmittlers entspricht, und zweitens dem für die Deflationierung der Kredit- und Einlagenbestände auf Preise der Basisperiode verwendeten Preisindex. FISIM zu Vorjahrespreisen wird wie folgt berechnet:
Die Basisperiodenspanne für Kredite ist gleich dem effektiven Zinssatz für Kredite abzüglich des Referenzzinssatzes. Die Basisperiodenspanne für Einlagen ist gleich dem Referenzzinssatz abzüglich des effektiven Zinssatzes für Einlagen. In nominalen Werten ist die effektive Spanne gleich dem Verhältnis der FISIM zu den Beständen; ersetzt man die effektive Spanne in den beiden vorstehenden Formeln durch diesen Ausdruck, so ergibt sich Folgendes:
|
BERECHNUNG VON FISIM NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN
|
14.15 |
Die Aufgliederung der FISIM auf die verwendenden Wirtschaftsbereiche erfolgt anhand der Kredit- und Einlagenbestände der einzelnen Wirtschaftsbereiche oder, wenn diese Informationen nicht zuverlässig sind, anhand des Produktionswerts der einzelnen Wirtschaftsbereiche. |
PRODUKTIONSWERT DER ZENTRALBANK
|
14.16 |
Der Produktionswert der Zentralbank wird vereinbarungsgemäß als Summe der Kosten gemessen, d. h. als Summe der Vorleistungen, des Arbeitnehmerentgelts, der Abschreibungen und sonstiger Produktionsabgaben abzüglich sonstiger Subventionen. Für die Zentralbank werden keine FISIM berechnet. Provisionen und Gebühren für direkt gemessene Dienstleistungen, die die Zentralbank gebietsansässigen oder gebietsfremden Einheiten in Rechnung stellt, sollten diesen Einheiten zugeordnet werden. Nur der Teil der Gesamtproduktion der Zentralbank (Summe der Kosten abzüglich Provisionen und Gebühren), der nicht verkauft wird, ist vereinbarungsgemäß den Vorleistungen der sonstigen FM, d. h. der Teilsektoren S.122 (Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)) und S.125 (Sonstige Finanzmittler (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)) zuzuordnen, und zwar anteilmäßig entsprechend der jeweiligen Wertschöpfung eines jeden dieser Teilsektoren. Zum Ausgleich der Konten der Teilsektoren S.122 und S.125 muss dem Betrag ihres jeweiligen Vorleistungsverbrauchs der von der Zentralbank erbrachten Dienstleistung ein von der Zentralbank empfangener laufender Transfer in gleicher Höhe (der unter D.759 „Übrige laufende Transfers a.n.g.“ ausgewiesen wird) gegenübergestellt werden. |
KAPITEL 15
NUTZUNGSRECHTE
EINLEITUNG
|
15.01 |
Verträge sind Vereinbarungen über die Bedingungen, zu denen Waren, Dienstleistungen und Vermögensgegenstände an Kunden abgegeben werden. Verträge über einfache Verkäufe von Waren, Dienstleistungen oder Vermögensgütern wirken sich nur auf den Wert der Transaktion und den Zeitpunkt ihrer Buchung aus, die beim Eigentumswechsel erfolgt. Der zeitliche Abstand zwischen Zahlung und Buchung wird im Finanzierungskonto bei den übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst. |
|
15.02 |
Verträge wie Miet- und Pachtverträge (Leasingverhältnisse), Lizenzvereinbarungen oder Genehmigungen legen die Klassifizierung der Zahlungen und das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgütern fest; einige Verträge stellen eine gesonderte nichtfinanzielle Vermögenskategorie dar. |
|
15.03 |
Im vorliegenden Kapitel werden in sieben Abschnitten die Buchung verschiedener Gruppen komplexer Verträge und die zugrunde liegenden Ströme und Bestände behandelt:
|
UNTERSCHEIDUNG VON OPERATING-LEASING, RESSOURCEN-LEASING UND FINANZIERUNGSLEASING
|
15.04 |
Es lassen sich drei Arten von Nutzungsrechten an Vermögensgütern unterschieden (siehe Tabelle 15.1):
Diese Nutzungsrechte richten sich jeweils auf ein nichtfinanzielles Vermögensgut:
|
|
15.05 |
Jeder Wert wie eine Ware oder Dienstleistung, Naturressource, Forderung oder Verbindlichkeit hat einen rechtlichen Eigentümer und einen wirtschaftlichen Eigentümer. In vielen Fällen sind wirtschaftlicher und rechtlicher Eigentümer identisch. Ist dies nicht der Fall, hat der rechtliche Eigentümer das Risiko und den Nutzen aus dem wirtschaftlichen Gebrauch der Leasing-Sache an den wirtschaftlichen Eigentümer übertragen. Im Gegenzug erhält der rechtliche Eigentümer vom wirtschaftlichen Eigentümer Zahlungen für ein anderes Risiko-Nutzen-Paket. Tabelle 15.1 — Buchung von drei Arten von Leasingverhältnissen
Tabelle 15.2 — Buchung von drei verschiedenen Arten von Leasing nach Transaktionsarten
|
|
15.06 |
Definition: Wirtschaftlicher Eigentümer von Werten wie einer Ware und Dienstleistungen, Naturressource, Forderung oder Verbindlichkeit ist die institutionelle Einheit, die den mit dem wirtschaftlichen Gebrauch dieser Werte verbundenen Nutzen beanspruchen kann, da sie auch die damit verbundenen Risiken trägt. |
|
15.07 |
Definition: Rechtlicher Eigentümer von Werten wie einer Ware und Dienstleistungen, Naturressource, Forderung oder Verbindlichkeit ist die institutionelle Einheit, die einen nachhaltigen Rechtsanspruch auf den mit den Werten verbundenen Nutzen besitzt. |
Operating-Leasing
|
15.08 |
Definition: Das Operating-Leasing ist ein Leasingverhältnis, bei dem der rechtliche Eigentümer auch wirtschaftlicher Eigentümer ist, die betrieblichen Risiken trägt und den wirtschaftlichen Nutzen aus dem Leasing-Objekt erhält, indem er im Rahmen einer produktiven Tätigkeit für dessen Gebrauch Entgelte erhebt. |
|
15.09 |
Ein Anzeichen dafür, dass ein Operating-Leasing vorliegt, ist der Umstand, dass der rechtliche Eigentümer für die erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung des Leasing-Objektes verantwortlich ist. |
|
15.10 |
Im Rahmen eines Operating-Leasing bleibt das betreffende Vermögensgut in der Bilanz des Leasinggebers. |
|
15.11 |
Die geleisteten Zahlungen für produzierte Vermögensgüter im Rahmen eines Operating-Leasingverhältnisses werden als Miet-/Pachtentgelt betrachtet und als Dienstleistungsentgelt gebucht (siehe Tabelle 15.2). Operating-Leasingverhältnisse lassen sich in Bezug auf Maschinen und Anlagen am besten beschreiben, da sie oftmals Fahrzeuge, Kräne, Bohrgeräte usw. betreffen, wobei sie jedoch alle Arten von nichtfinanziellen Vermögensgütern betreffen können. Die vom Leasinggeber (Vermieter) erbrachte Dienstleistung geht über die bloße Bereitstellung der Leasing-Sache hinaus. Sie umfasst andere Leistungselemente wie Annehmlichkeit und Sicherheit. Bei Maschinen und Anlagen hält der Leasinggeber bzw. Eigentümer der Anlagen normalerweise einen Bestand betriebstauglicher Maschinen und Anlagen vor, die nach Bedarf sofort oder kurzfristig angemietet werden können. Der Leasinggeber muss üblicherweise auf den Betrieb dieser Anlagen spezialisiert sein. Das ist bei komplizierterer Technik wie Computertechnik oftmals auch deshalb wichtig, weil der Leasingnehmer (Nutzer) möglicherweise weder das notwendige Sachwissen noch die erforderlichen Einrichtungen für die ordnungsgemäße Wartung und Pflege besitzt. Der Leasinggeber verpflichtet sich gegebenenfalls auch zum Austausch der Anlagen im Falle einer schwerwiegenden oder längeren Störung. Im Falle von Gebäuden ist der Leasinggeber für Statik und Standsicherheit des Gebäudes ebenso verantwortlich wie für etwaige Schäden aus Naturkatastrophen und trägt üblicherweise die Verantwortung für die Betriebstüchtigkeit von Aufzügen, Heizungsanlagen und Lüftungssystemen. |
|
15.12 |
Das Operating-Leasing entwickelte sich aus dem Bestreben, den Bedarf von Anwendern zu decken, die bestimmte Ausrüstungen nur zeitweise in regelmäßigen Zeitabständen benötigen. Viele Operating-Leasingverträge sind kurzfristig angelegt, obwohl der Leasingnehmer bei Ablauf der Leasingfrist eine Verlängerungsoption hat und den gleichen Ausrüstungsgegenstand mehrmals gebrauchen kann. Mit der Entwicklung immer komplizierterer Technik, besonders im Bereich der Elektronik, sind die Wartungs- und Sicherungsangebote eines Leasinggebers wesentliche Faktoren, die einen Nutzer veranlassen können, lieber zu leasen statt zu kaufen. Ein anderer möglicher Beweggrund ist die Vermeidung der Auswirkungen auf die Bilanz, den Cashflow und die Steuerpflicht. |
Finanzierungsleasing
|
15.13 |
Definition: Ein Finanzierungsleasing liegt vor, wenn der Leasinggeber der rechtliche Eigentümer eines Vermögensgutes ist, aber der Leasingnehmer als wirtschaftlicher Eigentümer die Betriebsrisiken trägt und den wirtschaftlichen Nutzen aus dem produktiven Gebrauch dieses Vermögensgutes erhält. Im Gegenzug erhält der Leasinggeber ein anderes Risiken/Chancen-Paket vom Leasingnehmer in Form von Tilgungszahlungen für einen Kredit. Oft gelangt der Leasinggeber, obwohl rechtlicher Eigentümer des Leasing-Objekts, nicht in den Besitz der Sache, sondern gestattet die Direktlieferung an den Leasingnehmer. Ein Anzeichen dafür, dass ein Finanzierungsleasing vorliegt, ist die Verantwortung des wirtschaftlichen Eigentümers für die Instandsetzung und Instandhaltung des Leasing-Objektes. |
|
15.14 |
Ein Finanzierungsleasing wird als Kredit ausgewiesen, den der rechtliche Eigentümer dem Leasingnehmer gewährt und den der Leasingnehmer dazu verwendet, das Vermögensgut zu erwerben. Danach erscheint das Vermögensgut in der Bilanz des Leasingnehmers und nicht des Leasinggebers; der entsprechende Kredit wird als Forderung des Leasinggebers und als Verbindlichkeit des Leasingnehmers ausgewiesen. Zahlungen aus einem Finanzierungsleasing werden nicht unter Miet-/Pachtentgelt gebucht, sondern als Zins- und Tilgungszahlung auf den gebuchten Kredit. Wenn es sich beim Leasinggeber um einen Finanzmittler handelt, wird ein Teil der Zahlung auch als Entgelt für unterstellte Bankgebühren (FISIM) gebucht. |
|
15.15 |
Sehr oft ist das Finanzierungsleasing-Objekt ganz anders beschaffen als die Vermögensgüter, die der Leasinggeber in seiner produktiven Tätigkeit nutzt, beispielsweise wenn eine Bank der rechtliche Eigentümer eines Verkehrsflugzeuges ist, dieses aber einem Luftverkehrsunternehmen zum Gebrauch überlässt. Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, das Flugzeug und die entsprechenden Abschreibungen in den Konten der Bank zu buchen oder aus den Konten des Luftverkehrsunternehmens zu nehmen. Das Instrument Finanzierungsleasing vermeidet diese irreführende Buchungsweise und ermöglicht eine sachgerechte Ausweisung des Reinvermögens beider Parteien über die gesamte Leasingdauer. |
|
15.16 |
Beim Finanzierungsleasing ist die Laufzeit gemeinhin identisch mit der gesamten wirtschaftlichen Nutzungsdauer der geleasten Sache. Der gebuchte Kreditwert entspricht in diesem Fall dem Gegenwartswert der zu leistenden Zahlungen aus dem Leasingvertrag. Dieser Wert umfasst die Kosten des Vermögensgutes und enthält gewöhnlich auch eine vom Leasinggeber in Rechnung gestellte Gebühr, die periodengerecht über die Leasingdauer gebucht wird. Regelmäßige Zahlungen an den Leasinggeber sind als vier Positionen auszuweisen, nämlich als Zinszahlungen, Tilgungen, Leasinggebühr und, wenn der Leasinggeber ein Finanzmittler ist, als unterstellte Bankgebühren (FISIM). Wenn die ersten drei der Positionen im Vertrag nicht festgeschrieben sind, gilt: Die Tilgung muss dem Wertverlust der Leasing-Sache entsprechen (d. h. Abschreibung), die Zinszahlung muss der Kapitalrendite der Leasing-Sache entsprechen und das Dienstleistungsentgelt muss der verbleibenden Differenz nach Abzug dieser beiden Elemente von der Gesamtverbindlichkeit entsprechen. |
|
15.17 |
Ein Finanzierungsleasing kann auch vorliegen, wenn die Leasinglaufzeit auch kürzer ist als die wirtschaftliche Nutzungsdauer der geleasten Sache. In diesem Fall umfasst der Kreditwert wiederum die Kosten für den Erwerb der Sache und die vom Leasinggeber berechnete Gebühr zuzüglich den Wert der vertraglich vereinbarten Dienstleistungsentgelte. Regelmäßige Zahlungen an den Leasinggeber sind als Zinszahlungen und Tilgungen, Leasinggebühr und, wenn der Leasinggeber ein Finanzmittler ist, als unterstellte Bankgebühren (FISIM) auszuweisen. Der Kreditwert kann auch Vorauszahlungen zur Finanzierung des Rückkaufs am Ende der Leasingdauer enthalten. Nach Ablauf der Leasingdauer kann die geleaste Sache in die Bilanz des Leasingnehmers übergehen, je nach vertraglicher Gestaltung. Die am Kredit noch ausstehenden Restbeträge sind gleich dem zum Leasing-Ende erwarteten Marktwert des Vermögensgutes (Restwert), wie zu Beginn des Leasingverhältnisses bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt könnte das Vermögensgut an den Leasinggeber zurückgehen, der Leasingnehmer eine Kaufoption ausüben oder eine neue Leasingvereinbarung getroffen werden. Bei einem Finanzierungsleasing muss der Leasingnehmer alle Risiken und Chancen aus dem Leasing-Objekt tragen. Deshalb gehen restwertbezogene Umbewertungsgewinne bzw. -verluste auf den Leasingnehmer. Wenn nun der Leasingnehmer die Sache am Ende der Laufzeit rechtlich erwirbt, werden die entsprechenden Barzahlungen als Tilgung verbucht, da sich das Vermögensgut bereits in der Bilanz des Leasingnehmers befindet. Fällt die geleaste Sache an den Leasinggeber zurück, wird dies als Kauf zum jeweiligen Marktwert behandelt. Die Erlöse aus dieser Transaktion werden für die Tilgung des Kreditrestbetrages verwendet, und sollte hier eine Differenz bestehen, wird dies als Vermögenstransfer gebucht. Die über den Leasingzeitraum geleisteten Zahlungen enthalten oft auch Vorauszahlungen für den Erwerb des Vermögensgutes, so dass die Transaktion ohne tatsächliche Gegenleistung erfolgt, da der Kredit bereits voll zurückgezahlt ist. Bei Einigung auf eine weitere Leasingfrist ist zu prüfen, ob der neu geschlossene Vertrag als Fortsetzung des Finanzierungsleasingverhältnisses oder als Operating-Leasing zu werten ist. |
|
15.18 |
Ein Finanzierungsleasing wird gewöhnlich über mehrere Jahre abgeschlossen, aber die Dauer allein erlaubt keine Rückschlüsse, ob es sich in einem speziellen Fall um ein Finanzierungsleasing oder ein Operating-Leasing handelt. Es gibt gelegentlich Verträge mit kurzen Laufzeiten, manchmal mit Fristen von nur jeweils einem Jahr, in denen dennoch vereinbart ist, dass der Leasingnehmer die komplette Verantwortung für die geleaste Sache übernimmt, einschließlich Instandhaltung und Versicherungsschutz für außergewöhnliche Schäden. Auch wenn die Laufzeit kurz und der Leasinggeber eventuell kein Finanzinstitut ist, wird so ein Leasingvertrag dennoch als Finanzierungsleasing und nicht als Operating-Leasing gebucht, soweit der Leasingnehmer die mit dem produktiven Gebrauch der Leasing-Sache verbundenen Risiken und Chancen übernimmt. Gleichwohl ist es in der Praxis schwierig, von der im Geschäftsleben üblichen Buchungsweise abzuweichen, die gemäß den internationalen Buchführungsnormen das Finanzierungsleasing auf Leasingverhältnisse begrenzt, die den wesentlichen Teil der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes umfassen. |
|
15.19 |
Eine auf das Finanzierungsleasing spezialisierte Kapitalgesellschaft, auch wenn sie sich als Immobilienfirma oder Flugzeug-Leasing-Gesellschaft bezeichnet, ist als Finanzmittler zu werten, der Kredite an die Leasingnehmer ausreicht. Ist der Leasinggeber kein Finanzmittler, werden die kreditbezogenen Zahlungen nur in Tilgung und Zinsen unterteilt; handelt es sich bei dem Leasinggeber um eine Finanzgesellschaft, so kommen noch die unterstellten Bankgebühren (FISIM) hinzu. |
|
15.20 |
Mietkauf ist eine Form von Finanzierungsleasing. Definition: Ein Mietkauf-Geschäft liegt vor, wenn ein langlebiges Gut gegen zukünftige Zahlungen an einen Käufer verkauft wird. Das Gut gelangt unmittelbar in den Besitz des Käufers, bleibt aber zur Besicherung der Forderungen rechtlich so lange im Eigentum des Leasinggebers, bis alle vereinbarten Zahlungen vom Leasingnehmer (Mietkäufer) geleistet wurden. |
|
15.21 |
Der Mietkauf beschränkt sich gewöhnlich auf langlebige Konsumgüter und die Mietkäufer sind meist Privathaushalte. Mietkaufvereinbarungen werden in der Regel mit gesonderten institutionellen Einheiten geschlossen, die eng mit den Verkäufern von dauerhaften Gütern zusammenarbeiten. |
|
15.22 |
Beim Mietkauf erfolgt die Buchung als Erwerb am Tag der Inbesitznahme zum marktüblichen Preis, d. h. zu dem Marktpreis, der in einer gleichwertigen Transaktion realisiert worden wäre. Der Käufer erhält einen Kredit in entsprechender Höhe. Die Zahlungen des Käufers an den Kreditgeber werden in gleicher Weise in Tilgungs- und Zinszahlungen untergliedert wie beim Finanzierungsleasing. Die vom Kreditgeber eines Mietkaufs ausgeführte produktive Tätigkeit ist die finanzielle Mittlertätigkeit. Da er seine Dienste normalerweise nicht unmittelbar in Rechnung stellt, werden als Produktionswert die unterstellten Bankgebühren (FISIM) angesetzt, berechnet als erhaltenes Vermögenseinkommen abzüglich geleisteter Zinszahlungen. Wie beim herkömmlichen Finanzierungsleasing ist die Höhe der Zinszahlungen mitunter schwer zu ermitteln und muss deshalb geschätzt werden. |
Ressourcen-Leasing
|
15.23 |
Definition: Ressourcen-Leasing liegt dann vor, wenn der Eigentümer einer natürlichen Ressource diese einem Leasingnehmer zum Gebrauch überlässt und als Gegenleistung eine Zahlung erhält, die unter Miet-/Pachteinnahmen verbucht wird. |
|
15.24 |
Bei einem Ressourcen-Leasing verbleibt das natürliche Vermögensgut in der Bilanz des Leasinggebers, obwohl es vom Leasingnehmer genutzt wird. Jeder Wertverlust einer natürlichen Ressource wird als Abbuchung nichtproduzierter Vermögensgüter behandelt (verbucht unter K.21 „Abbau natürlicher Ressourcen“). Er wird nicht als abschreibungsanaloge Transaktion gebucht, da hier keine Abschreibung vorliegt. Zu leistende Zahlungen aus einem Ressourcen-Leasing — und nur solche zu leistenden Zahlungen — werden unter Miete/Pacht verbucht. |
|
15.25 |
Der klassische Fall eines Ressourcen-Leasing ist die Verpachtung von Grundstücken. Aber auch der Gebrauch anderer natürlicher Ressourcen wird entsprechend gebucht, beispielsweise Holzvorkommen, Fischbestände, Wasser, Mineralvorkommen und Radiofrequenzen. |
Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen
|
15.26 |
Berechtigungen und Genehmigungen zum Gebrauch natürlicher Ressourcen können von staatlicher Seite, aber auch von Privateigentümern wie Landwirten und Unternehmen erteilt werden. |
|
15.27 |
Es gibt drei Möglichkeiten für die Buchung von Nutzungsrechten an natürlichen Ressourcen (siehe Tabelle 15.3):
Die erste Möglichkeit wird als Ressourcen-Leasing behandelt und unter Miete/Pacht verbucht. Die zweite Möglichkeit kann dazu führen, dass neben der Buchung als Miete/Pacht für den Nutzer auch ein eigenständiges, von der Ressource getrenntes Vermögensgut entsteht. Der Wert der Ressource und der Wert des Nutzungsrechts an der Ressource sind jedoch miteinander verknüpft. Dieses Vermögensgut (Kategorie AN.222) wird nur dann verbucht, wenn sein Wert, d. h. der über den Genehmigungswert hinausgehende Nutzen für den Berechtigten, durch Übertragung realisierbar ist. Die Ersteinstellung erfolgt über die Zubuchung von Vermögensgütern (Kategorie K.1; siehe 6.06 Buchstabe g). Wird der Wert des Vermögensgutes nicht realisiert, geht er bei Beendigung des Leasingverhältnisses in Richtung Null. Die dritte Option läuft auf den Verkauf der Naturressource selbst (eventuell auch auf Enteignung) hinaus. Tabelle 15.3 — Buchung von drei Arten von Nutzungsrechten an natürlichen Ressourcen
|
|
15.28 |
Hauptkriterium zur Unterscheidung von Miete/Pacht, Einstellung eines neuen Vermögenswertes und Verkauf der natürlichen Ressource ist die Übertragung der Risiken und Chancen. Wurden de facto alle Risiken und Chancen übertragen, liegt ein Verkauf der natürlichen Ressource vor. Ein neues Vermögensgut entsteht, wenn die Übertragung der Risiken und Chancen dazu führt, dass eine separate übertragbare Berechtigung mit einem realisierbaren Wert entsteht. Andere Kriterien wie Zahlungsvorvereinbarungen, Vorauszahlungen, Laufzeit der Berechtigung und Art der Verbuchung in den Geschäftskonten sind mitunter irreführend, da sie nicht zwangsweise den Übergang von Risiken und Chancen abbilden. |
|
15.29 |
Das Eigentum an natürlichen Ressourcen wie Grundstücken und mineralischen Bodenschätzen kann von gebietsfremden Einheiten erworben werden. Der Verkauf einer natürlichen Ressource ist jedoch nicht als Verkauf an einen Gebietsfremden zu buchen. In solchen Fällen wird eine fiktive gebietsansässige Einheit eingerichtet, die die Eigentümerin der Naturressource ist und deren Anteilskapital im Eigentum der gebietsfremden Einheit steht. Entsprechend wird mit gebietsansässigen Einheiten verfahren, die natürliche Ressourcen in der übrigen Welt erwerben. |
|
15.30 |
Staatliche Einnahmen aus einer speziellen Art von Naturvorkommen (z. B. Einnahmen aus Öl und Erdgas) können viele verschiedene Transaktionen umfassen. Beispiele hierfür sind:
|
Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten
|
15.31 |
Zusätzlich zu Nutzungsberechtigungen im Rahmen von Lizenzen und Leasingverhältnissen kann auch die Genehmigung zur Aufnahme einer bestimmten Tätigkeit erteilt werden, und zwar relativ unabhängig von den tätigkeitsbezogenen Vermögensgütern. Solche Genehmigungen sind nicht an Eignungs- oder Qualifizierungskriterien geknüpft (wie die Prüfung zum Erhalt der Fahrerlaubnis), sondern sollen die Anzahl von Einheiten im entsprechenden Tätigkeitsbereich beschränken. Solche Genehmigungen können von staatlichen oder privaten institutionellen Einheiten erteilt werden. Diese beiden Fälle werden unterschiedlich behandelt. Tabelle 15.4 — Buchung von Nutzung und Kauf von Vermögensgütern nach Transaktionsarten und Strömen
|
|
15.32 |
Staaten, die über Genehmigungen beispielsweise die Anzahl von Taxis oder Spielcasinos beschränken, schaffen Monopolgewinne für die Genehmigungsinhaber und schöpfen einen Teil dieser Gewinne über die Genehmigungsgebühr ab. Solche Gebühren werden als sonstige Abgaben verbucht. Dieser Grundsatz gilt für alle Fälle, in denen der Staat die Anzahl betrieblicher Einheiten in einem bestimmten Bereich über Genehmigungen begrenzt, soweit diese Begrenzung willkürlich erfolgt und nicht ausschließlich von Eignungskriterien abhängt. |
|
15.33 |
Hat die Genehmigung eine Gültigkeit von mehreren Jahren, so ist die Zahlung der Gebühr für die künftigen Jahre periodengerecht als gesonderte Forderung bzw. Verbindlichkeit zu buchen. |
|
15.34 |
Der Anreiz für den Genehmigungserwerber besteht darin, dass er sich den Anspruch auf Monopolgewinne sichert und sein künftiges Einkommen größer sein wird als die geleisteten Zahlungen. Der für den Genehmigungsinhaber entstehende, über den Genehmigungswert hinausgehende Nutzwert wird als Vermögenswert gebucht, wenn er durch Übertragung realisierbar ist. Dieser Aktivposten wird als Genehmigung zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten (AN.223) bezeichnet. |
|
15.35 |
Die Erstbuchung der Genehmigung zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten erfolgt im Konto der sonstigen realen Vermögensänderungen. Werterhöhungen und Wertverminderungen werden auf das Umbewertungskonto gebucht. |
|
15.36 |
Der Wert der Genehmigung als Vermögensgut bestimmt sich aus dem möglichen Verkaufswert und wird, falls dieser nicht bekannt ist, als Gegenwartswert der künftigen Monopolgewinne geschätzt. Bei Weiterverkauf der Genehmigung erhält der neue Inhaber einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Staat für den Fall, dass die Genehmigung aufgehoben wird, sowie das Recht auf die Erwirtschaftung von Monopolgewinnen. |
|
15.37 |
Eine staatlich erteilte Genehmigung zur Durchführung einer bestimmten Tätigkeit wird nur dann als Vermögensgut behandelt, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:
Ist auch nur eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt, werden die Zahlungen als Abgaben oder Dienstleistungsentgelte behandelt. |
|
15.38 |
Bei nichtstaatlichen Einheiten kommt es seltener vor, dass sie den Zugang zu einer bestimmten Tätigkeit beschränken können. Ein Beispiel ist, dass die Mitgliedschaft in einer Berufsvereinigung vorgeschrieben oder empfohlen wird, aber die Mitgliederzahl streng begrenzt ist. Ein anderes Beispiel ist gegeben, wenn ein Immobilieneigentümer nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten auf seinem Grundstück zulässt, beispielsweise wenn ein Hotel den Transport von Hotelgästen nur einer einzigen Taxifirma erlaubt. In diesen Fällen werden die Genehmigungen als Dienstleistungsentgelte gebucht. Grundsätzlich sind die Zahlungen periodengerecht entsprechend der Gültigkeitsfrist der Genehmigung abzugrenzen. Es spricht kein grundsätzliches Kriterium dagegen, solche Genehmigungen als Vermögenswert zu behandeln, sofern deren Marktfähigkeit gegeben ist, aber es ist davon auszugehen, dass dies nicht der Regelfall ist. |
|
15.39 |
Eine von einer nichtstaatlichen Einheit erteilte Genehmigung zur Durchführung einer bestimmten Tätigkeit wird nur dann als Vermögenswert behandelt, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:
Ist auch nur eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt, werden die entsprechenden Zahlungen als Dienstleistungsentgelte geführt. |
|
15.40 |
Zur Kontrolle des Gesamtschadstoffausstoßes erteilen Staaten Emissionsgenehmigungen. Diese betreffen nicht den Gebrauch eines natürlichen Vermögensgutes, da die Atmosphäre keinen ihr zugeschriebenen Wert hat und demnach kein Wirtschaftsgut ist, und fallen deshalb unter Abgaben. Diese Genehmigungen können gehandelt werden, und es wird einen aktiven Markt für dafür geben. Die Genehmigungen stellen deshalb Vermögensgüter dar und sind zu dem Marktpreis zu bewerten, zu dem sie veräußerbar sind. |
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP)
|
15.41 |
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sind langfristige Verträge zwischen zwei Einheiten, wobei eine Einheit ein Vermögensgut oder einen Satz von Vermögensgütern erwirbt oder baut, einige Zeit betreibt und anschließend an eine zweite Einheit übergibt. Solche Vereinbarungen bestehen gewöhnlich zwischen einem privatwirtschaftlichen Unternehmen und dem Staat, möglich sind aber auch andere Kombinationen, wie Vereinbarungen zwischen einer öffentlichen Kapitalgesellschaft mit einer privaten Organisation ohne Erwerbszweck als zweiter Vertragspartei. Die Beweggründe, warum sich Staaten für die Beteiligung an ÖPP entscheiden, sind vielfältig, wie etwa die Hoffnung, dass ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen die Produktion effektiver gestaltet und einen breiteren Zugang zu Finanzierungsquellen ermöglicht, sowie der Wunsch nach dem Abbau der Staatsschulden. Während der Laufzeit des ÖPP-Vertrages ist der Unternehmer der rechtliche Eigentümer. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Staat sowohl wirtschaftlicher als auch rechtlicher Eigentümer. Nähere Einzelheiten zur Behandlung öffentlich-privater Partnerschaften finden sich in Kapitel 20 (Die Konten des Sektors Staat). |
Dienstleistungslizenzverträge
|
15.42 |
Dienstleistungslizenzen gewähren einem Unternehmen das ausschließliche Recht zur Erbringung bestimmter Dienstleistungen. Bei öffentlichen Dienstleistungslizenzen schließt beispielsweise ein Privatunternehmen mit dem Staat einen Vertrag ab, der dem Unternehmen für einige Jahre das exklusive Betriebs-, Wartungs- und Investitionsrecht an einer öffentlichen Versorgungsleistung (wie an einem Wassernetz oder an einer Mautstraße) sichert. Dienstleistungslizenzverträge sind in der Regel nicht als Vermögensgüter zu buchen, da sie nicht übertragbar sind oder bei einer Übertragung kein Wert erzielt werden kann. |
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern (AN.221)
|
15.43 |
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern sind Eigentumsrechte Dritter, die sich auf Vermögensgüter (ohne natürliche Ressourcen) beziehen. Der wirtschaftliche Nutzen für den Berechtigten sollte die Höhe der gezahlten Nutzungsgebühr übersteigen und der Berechtigte diesen Nutzwert durch Übertragung realisieren können. Der Wert des Nutzungsrechtes für den Berechtigten ist der Überschussübertrag über dem Wert, der für die genehmigende Einheit erwächst. Vereinbarungen über Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern können alle Arten von Miet-, Pacht- und Operating-Leasingverträgen umfassen. Beispielsweise kann ein Mieter eine Wohnung an einen Dritten untervermieten. |
Exklusivrechte auf künftige Waren und Dienstleistungen (AN.224)
|
15.44 |
Auch Verträge über künftige Produktionen können Vermögensrechte Dritter begründen. Der Wert solcher Vereinbarungen für den Berechtigten ist der Überschussbetrag über dem Wert, der für denjenigen erwächst, der das Exklusivrecht gewährt hat. Beispiele hierfür sind:
|
KAPITEL 16
VERSICHERUNG
EINLEITUNG
|
16.01 |
Die Versicherung stellt eine Tätigkeit dar, bei der sich institutionelle Einheiten oder Gruppen von Einheiten vor den negativen finanziellen Konsequenzen spezifischer ungewisser Ereignisse schützen. Es können zwei Arten von Versicherungen unterschieden werden: Sozialschutz und sonstige Versicherungen. |
|
16.02 |
Der Sozialschutz deckt soziale Risiken und Bedürfnisse ab. Er erfolgt im Rahmen kollektiver Versorgungssysteme für eine Gruppe, für deren Mitglieder die Teilnahme in der Regel gesetzlich vorgeschrieben ist oder von Dritten gefördert wird. Sozialschutz umfasst: Sozialversicherungssysteme, die vom Staat vorgeschrieben, kontrolliert und finanziert werden, und beschäftigungsbezogene Systeme, die von Arbeitgebern im Namen ihrer Arbeitnehmer unterhalten werden. Der Sozialschutz wird in Kapitel 17 beschrieben. |
|
16.03 |
Die Versicherung mit Ausnahme des Sozialschutzes deckt Ereignisse wie den Tod, den Erlebensfall, Feuer, Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Verkehrsunfälle usw. ab. Versicherungen auf den Todes- oder Erlebensfall werden als Lebensversicherungen bezeichnet, und Versicherungen auf alle sonstigen Ereignisse gelten als Nichtlebensversicherungen. |
|
16.04 |
In diesem Kapitel geht es um die Lebens- und die Nichtlebensversicherung. In ihm wird beschrieben, wie die Versicherungstätigkeiten im ESVG verbucht werden. |
|
16.05 |
Die Rechte und Pflichten bei einer Versicherung werden in einer Versicherungspolice beschrieben. Die Police stellt eine Vereinbarung zwischen einem Versicherer und einer anderen institutionellen Einheit, die als Versicherungsnehmer bezeichnet wird, dar. Im Rahmen der Vereinbarung leistet der Versicherungsnehmer eine Zahlung, die so genannte Prämie, an den Versicherer, und falls ein bestimmtes Ereignis eintritt, zahlt der Versicherer eine Zahlung, den so genannten Anspruch, an den Versicherungsnehmer oder eine benannte Person aus. Auf diese Weise schützt sich der Versicherungsnehmer gegen bestimmte Formen von Risiken; durch eine gemeinsame Risikoübernahme strebt der Versicherer die Einnahme höherer Beträge in Form der Prämien an, als er zur Regelung von Ansprüchen auszahlen muss. |
|
16.06 |
In der Versicherungspolice werden ferner die Rollen der Beteiligten definiert, nämlich die folgenden:
In der Praxis kann es sich bei Versicherungsnehmer, Begünstigtem und Versichertem um ein und dieselbe Person handeln. In der Police sind diese Rollen aufgeführt und jeder Rolle die entsprechende Person zugeordnet. |
|
16.07 |
Die häufigste Form der Versicherung wird als Direktversicherung bezeichnet. Dabei versichern sich institutionelle Einheiten mithilfe eines Versicherers gegen die finanziellen Folgen bestimmter Risiken. Jedoch können sich sämtliche Direktversicherer selbst versichern, indem sie einen Teil der direkt versicherten Risiken bei anderen Versicherern versichern. Das nennt man Rückversicherung, und deren Anbieter werden als Rückversicherer bezeichnet. |
Direktversicherung
|
16.08 |
Es können zwei Arten der Direktversicherung unterschieden werden: die Lebensversicherung und die Nichtlebensversicherung. |
|
16.09 |
Definition: Bei einer Lebensversicherung leistet ein Versicherungsnehmer regelmäßige Zahlungen an einen Versicherer, und als Gegenleistung garantiert der Versicherer dem Begünstigten an einem bestimmten Datum oder, falls die versicherte Person vorher stirbt, schon früher die Auszahlung einer vereinbarten Summe oder Annuität. Eine Lebensversicherung kann Leistungen für eine Reihe von Risiken gewähren. So kann die Alterslebensversicherung eine Leistung gewähren, wenn der Versicherte das 65. Lebensjahr erreicht, und nach dem Tod der versicherten Person kann an den Ehegatten/die Ehegattin bis zu dessen/deren Tod eine Leistung gezahlt werden. |
|
16.10 |
Der Bereich der Lebensversicherung erstreckt sich auch auf ergänzende Versicherungen gegen Verletzung, einschließlich der Erwerbsunfähigkeit, Versicherungen gegen Unfalltod und Versicherungen gegen unfall- oder krankheitsbedingte Behinderungen. |
|
16.11 |
Einige Klassen von Lebensversicherungen bieten eine Entschädigung für den Fall, dass das versicherte Ereignis eintritt, z. B. eine Versicherung, die an ein Hypothekardarlehen gekoppelt ist und nur eine Leistung zur Zurückzahlung der Hypothek auszahlt, wenn der Verdiener vor Fälligkeit des entsprechenden Darlehens stirbt. Die meisten solcher Versicherungsklassen beinhalten ein beträchtliches Ansparelement in Verbindung mit einem Element der Risikoabdeckung. Aufgrund des ausgeprägten Ansparelements gelten Lebensversicherungen als Sparverträge, und die entsprechenden Transaktionen sind im Finanzierungskonto anzugeben. |
|
16.12 |
Definition: Bei einer Nichtlebensversicherung leistet ein Versicherungsnehmer regelmäßige Zahlungen an einen Versicherer, und als Gegenleistung garantiert der Versicherer dem Begünstigten bei Eintreten eines anderen Ereignisses als dem Tod eines Menschen die Auszahlung einer vereinbarten Summe. Beispiele für derartige Ereignisse sind Unfall, Krankheit, Brand usw. Unfallversicherungen, die Risiken für das Leben des Versicherten abdecken, werden in den meisten europäischen Ländern als Nichtlebensversicherungen eingestuft. |
|
16.13 |
Eine Lebensversicherung, die ausschließlich im Falle des Todes innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Leistung gewährt und im Allgemeinen als Risikolebensversicherung bezeichnet wird, gilt in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Nichtlebensversicherung, weil nur dann ein Anspruch besteht, wenn ein spezielles Ereignis eintritt, und sonst nicht. In der Praxis ist es aufgrund der Rechnungsführung von Versicherern nicht immer möglich, Risikolebensversicherungen von der Lebensversicherung zu trennen. Wenn dies so ist, können Risikolebensversicherungen in derselben Weise behandelt werden wie Lebensversicherungen. |
|
16.14 |
Die Lebens- wie Nichtlebensversicherung beinhalten die Risikostreuung. Versicherer beziehen kleine regelmäßige Prämienzahlungen von Versicherungsnehmern und zahlen im Falle des Eintritts von Ereignissen, die von der Police versichert werden, größere Summen an den Geschädigten aus. Bei Nichtlebensversicherungen verteilt sich das Risiko auf alle Versicherungsnehmer, die eine entsprechende Versicherung abgeschlossen haben. So bestimmt ein Versicherer die Prämien für die Erbringung einer jährlichen Versicherungsdienstleistung in Abhängigkeit von den im selben Jahr voraussichtlich anfallenden Erstattungsbeträgen. Generell ist die Zahl der Geschädigten wesentlich niedriger als die Zahl der Versicherungsnehmer. Für den einzelnen Versicherungsnehmer stehen die gezahlten Prämien selbst über lange Zeiträume in keinem Verhältnis zum ersetzten Schaden, aber der Versicherer stellt für jede Klasse der Nichtlebensversicherung jährlich ein solches Verhältnis auf. Bei Lebensversicherungen ist ein Verhältnis zwischen Prämien und Schadenszahlungen im Zeitverlauf sowohl für die Versicherungsnehmer als auch den Versicherer von Bedeutung. Beim Abschluss einer Lebensversicherung wird davon ausgegangen, dass die Leistungen mindestens so hoch sind wie die bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Leistungen fällig werden, gezahlten Prämien, und dies eine Form des Sparens darstellt. Der Versicherer muss diesen Aspekt einer Versicherung bei den versicherungsmathematischen Berechnungen zur versicherten Bevölkerung und deren Lebenserwartung, einschließlich der Risiken in Bezug auf tödliche Unfälle, berücksichtigen, wenn er das Verhältnis zwischen Prämien und Leistungen festlegt. Zudem erwirtschaftet der Versicherer im Zeitraum zwischen dem Eingang der Prämien und der Auszahlung der Leistungen Einkommen durch die Investition eines Teils der eingenommenen Prämien. Dieses Einkommen wirkt sich ebenfalls auf die Höhe der vom Versicherer festgesetzten Prämien und Leistungen aus. |
|
16.15 |
Zwischen der Lebens- und der Nichtlebensversicherung bestehen erhebliche Unterschiede, die unterschiedliche Arten von Buchungen im ESVG zur Folge haben. Die Nichtlebensversicherung stellt eine Umverteilung zwischen sämtlichen Versicherungsnehmern und einigen wenigen Geschädigten im laufenden Rechnungszeitraum dar. Bei der Lebensversicherung werden hauptsächlich die über einen Zeitraum eingezahlten Prämien später als Leistungen an dieselben Versicherungsnehmer ausgezahlt. |
Rückversicherung
|
16.16 |
Definition: Ein Versicherer kann sich gegen eine unerwartet hohe Zahl von Schadensansprüchen oder außergewöhnlich hohe Schadensansprüche absichern, indem er eine Rückversicherung mit einem Rückversicherer abschließt. Rückversicherungsgesellschaften sind auf eine begrenzte Zahl von Finanzzentren konzentriert, so dass viele Rückversicherungsströme Transaktionen mit der übrigen Welt darstellen. Es ist üblich, dass Rückversicherer Rückversicherungen mit anderen Rückversicherern abschließen, um die Risiken weiter zu streuen. Diese Ausweitung der Rückversicherung wird als Retrozession bezeichnet. |
|
16.17 |
Risiken lassen sich auch dadurch begrenzen, dass eine Gruppe von Versicherern, die so genannten „Zeichner“, die mit einer einzigen Police verbundenen Risiken gemeinsam übernimmt. Dabei ist jeder einzelne Versicherer lediglich für seinen Anteil der Police verantwortlich; er erhält den entsprechenden Anteil der Prämie und zahlt denselben Anteil im Schadensfall bzw. als Leistung aus. Die Verwaltung der Police erfolgt entweder durch das federführende Institut oder den Versicherungsmakler. Lloyds of London ist ein Beispiel für einen Versicherungsmarkt, auf dem direkte und indirekte Risiken auf eine große Zahl von Zeichnern verteilt werden. |
|
16.18 |
Ein Direktversicherer hat verschiedene Möglichkeiten für eine indirekte Absicherung der vom Versicherer übernommenen Risiken. Folgende Rückversicherungsklassen werden unterschieden:
|
Die beteiligten Einheiten
|
16.19 |
Bei den an der Direktversicherung und Rückversicherung beteiligten institutionellen Einheiten handelt es sich in erster Linie um Versicherer. Auch andere Arten von Unternehmen können als Nebentätigkeit Versicherungsleistungen anbieten, doch üblicherweise sehen die rechtlichen Bestimmungen für Versicherungstätigkeiten vor, dass ein separates Kontensystem aufgestellt werden muss, das sämtliche Aspekte der Versicherungstätigkeit abdeckt. Folglich ist eine gesonderte institutionelle Einheit erkennbar, die den Teilsektoren Versicherungsgesellschaften (S.128) bzw. Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129) zugeordnet wird. Der Staat kann andere Versicherungstätigkeiten durchführen, aber auch hier ist wahrscheinlich eine gesonderte Einheit erkennbar. Nachdem festgestellt wurde, dass andere Sektoren beteiligt sein können, wird nachfolgend davon ausgegangen, dass sämtliche Versicherungstätigkeiten von gebietsansässigen oder gebietsfremden Versicherern durchgeführt werden. |
|
16.20 |
Einheiten, die hauptsächlich in enger Beziehung zur Versicherung stehende Tätigkeiten ausüben, selbst aber kein Risiko übernehmen, sind Einheiten, die Versicherungshilfstätigkeiten ausüben. Solche Einheiten werden dem Teilsektor Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126) zugeordnet und umfassen beispielsweise Folgendes:
|
PRODUKTION DER DIREKTVERSICHERUNG
|
16.21 |
Die Versicherungsgesellschaft erhält eine Prämie von einem Kunden und behält diese solange ein, bis ein Anspruch angemeldet wird oder der Versicherungszeitraum abgelaufen ist. In der Zwischenzeit investiert die Versicherungsgesellschaft die Prämie, und die Kapitalerträge stellen eine zusätzliche Quelle dar, aus der potenzielle Ansprüche gedeckt werden können. Die Versicherungsgesellschaft legt die Höhe der Prämien so fest, dass die Summe aus den Prämien plus die damit erwirtschaften Kapitalerträge abzüglich der erwarteten Leistungen für Versicherungsfälle eine Spanne ergeben, die die Gesellschaft einbehalten kann. Diese Spanne stellt die Produktion der Versicherungsgesellschaft dar. Die Messung der Produktion des Versicherungsgewerbes lehnt sich an die Prämienfestlegung der Versicherer an. Zu diesem Zweck sind vier Positionen zu definieren, und zwar:
Jede dieser Positionen wird erörtert, bevor die Produktion der direkten Nichtlebensversicherung, der direkten Lebensversicherung und der Rückversicherung gemessen wird. |
Verdiente Prämien
|
16.22 |
Definition: Bei den verdienten Prämien handelt es sich um den Anteil der gebuchten Prämien, die im Rechnungszeitraum verdient wurden, während sich die gebuchten Prämien auf den Zeitraum der Versicherungspolice erstrecken. Die Differenz zwischen gebuchten Prämien und verdienten Prämien sind Beträge, die zurückgestellt und in die Rückstellungen für Prämienüberträge aufgenommen werden. Solche Beträge werden als Vermögen der Versicherungsnehmer behandelt. Das Konzept der verdienten Prämien in der Versicherungsrechnungslegung stimmt mit dem Grundsatz der Rechnungsabgrenzung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen überein. |
|
16.23 |
Die Versicherungsprämie ist entweder regelmäßig monatlich oder jährlich zu zahlen oder einmalig, gewöhnlich zu Beginn der Versicherungslaufzeit. Einmalige Prämien sind vor allem für die Versicherung von Risiken in Verbindung mit großen Ereignissen üblich, etwa der Errichtung großer Gebäude oder Anlagen und dem Gütertransport per Straße, Schiene bzw. auf dem Wasser- oder Luftweg. |
|
16.24 |
Die im jeweiligen Jahr verdienten Prämien haben folgende Form: gebuchte Prämien
Oder anders dargestellt, haben sie folgende Form: gebuchte Prämien
|
|
16.25 |
Die Rückstellungen für Prämienüberträge und sonstige Rückstellungen sind Bestandteil der versicherungstechnischen Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen (AF.61) und versicherungstechnischen Rückstellungen bei Lebensversicherungen (AF.62). Die versicherungstechnischen Rückstellungen werden unter 16.43 bis 16.45 beschrieben. |
|
16.26 |
Häufig ist von Versicherungsnehmern eine spezielle Steuer auf die Zahlung der Versicherungsprämie zu entrichten. Lebensversicherungsprämien sind in vielen Ländern von dieser Versicherungssteuer ausgenommen. Da die Versicherer diese Steuer an den Staat abführen müssen, finden die entsprechenden Beträge keinen Eingang in den Jahresabschluss der Versicherer. Lediglich ein sehr geringer Betrag — der Restbetrag für das Jahr, der noch an den Staat abzuführen ist — könnte als Handelskredit in der Bilanz der Versicherer verbucht werden. Die Steuerzahlungen als solche werden in den Büchern der Versicherer nicht verbucht. Derartige Steuern gelten in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als eine Steuer auf Güter. Es wird unterstellt, dass die Versicherungsnehmer solche Beträge unmittelbar auf die Konten der Steuerbehörden einzahlen. |
Zusätzliche Prämien
|
16.27 |
Definition: Bei zusätzlichen Prämien handelt es sich um das Einkommen aus der Anlage versicherungstechnischer Rückstellungen der Versicherer, das eine Verbindlichkeit gegenüber den Versicherungsnehmern darstellt. |
|
16.28 |
Vor allem bei Lebensversicherungen, aber in geringerem Maße auch bei Nichtlebensversicherungen, übersteigt der Gesamtbetrag der in einem bestimmten Zeitraum fälligen Leistungen oder Ansprüche häufig die Höhe der verdienten Prämien. Die Prämien werden im Allgemeinen regelmäßig gezahlt, und zwar häufig zu Beginn des Versicherungszeitraums, während der Versicherungsfall später eintritt. Bei Lebensversicherungen werden die Leistungen oft erst nach vielen Jahren fällig. In der Zeit zwischen der Prämieneinzahlung und der zu zahlenden Leistung steht die entsprechende Summe dem Versicherer zur Verfügung, der diese gewinnbringend investieren kann. Solche Beträge werden als versicherungstechnische Rückstellungen bezeichnet. Die über die Rückstellungen erzielten Einnahmen gestatten es den Versicherern, niedrigere Prämien zu berechnen, als dies sonst der Fall wäre. Die Messung dieser Dienstleistung berücksichtigt sowohl die Höhe dieses Einkommens als auch die relative Höhe der Prämien und Leistungen. |
|
16.29 |
Bei Nichtlebensversicherungen ist zwar gegebenenfalls zu Beginn des Versicherungszeitraums eine Prämie zu zahlen, aber die Prämien werden kontinuierlich über den gesamten Zeitraum hinweg verdient. Der Versicherer hält zu jedem Zeitpunkt des Versicherungszeitraums einen dem Versicherungsnehmer in Bezug auf Dienstleistungen und potenzielle Leistungen in der Zukunft zustehenden Betrag bereit. Dabei handelt es sich um eine Art Kredit, den der Versicherungsnehmer dem Versicherer gewährt und der als Prämienübertrag bezeichnet wird. Andererseits muss der Versicherer bei Eintritt des versicherten Ereignisses zwar die so entstandenen Ansprüche begleichen, doch kann bis zur eigentlichen Auszahlung noch ein beträchtlicher Zeitraum vergehen, weil häufig noch über die Höhe der zu zahlenden Beträge verhandelt wird. Das ist eine weitere ähnliche Form des Kredits, die als Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle bezeichnet werden. |
|
16.30 |
Bei der Lebensversicherung gibt es ähnliche Rückstellungen, doch die Versicherungsrückstellungen weisen hier zusätzlich zwei weitere Elemente auf, und zwar Deckungsrückstellungen für die Lebensversicherung und Rückstellungen für Gewinnbeteiligung der Versicherten. Dabei handelt es sich um Summen, die für die künftige Zahlung von Leistungen zurückgelegt werden. Im Allgemeinen werden Rückstellungen in finanzielle Vermögenswerte investiert, und das Einkommen hat die Form von Kapitalerträgen. Sie können über eine separate Einrichtung oder über eine Nebentätigkeit zur Erwirtschaftung eines Nettobetriebsüberschusses, z. B. im Immobiliengeschäft, genutzt werden. |
|
16.31 |
Sämtliche den Versicherungsnehmern zugeschriebenen Kapitalerträge werden im Konto der primären Einkommensverteilung als an die Versicherungsnehmer zu zahlende ausgewiesen. Bei der Nichtlebensversicherung wird dann derselbe Betrag im Konto der sekundären Einkommensverteilung als zusätzliche Prämie an den Versicherer zurückgezahlt. Bei der Lebensversicherung werden Prämien und zusätzliche Prämien im Finanzierungskonto angegeben. |
Bereinigte eingetretene Versicherungsfälle und fällige Leistungen
|
16.32 |
Definition: Eingetretene Versicherungsfälle und fällige Leistungen bilden die finanziellen Verpflichtungen der Versicherer gegenüber den Begünstigten im Hinblick auf die Risiken, die durch das Ereignis im fraglichen und in der Police definierten Zeitraum eingetreten sind. |
|
16.33 |
Das Konzept von eingetretenen Versicherungsfällen in der Nichtlebensversicherung und der fälligen Leistungen in der Lebensversicherung stimmt mit dem Grundsatz der Rechnungsabgrenzung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen überein. |
Bereinigte eingetretene Versicherungsfälle in der Nichtlebensversicherung
|
16.34 |
Bei Versicherungsfällen wird unterschieden zwischen beglichenen und eingetretenen Versicherungsfällen. Die eingetretenen Versicherungsfälle beziehen sich auf die Beträge, die aufgrund der versicherten Risiken, die im entsprechenden Jahr eingetreten sind, geschuldet werden. Dabei ist es unerheblich, ob der Versicherungsnehmer das entsprechende Ereignis gemeldet hat. Ein Teil der Versicherungsfälle wird im Folgejahr oder noch später beglichen. Andererseits werden im laufenden Jahr Ansprüche beglichen, die das Ergebnis von Ereignissen sind, die in früheren Jahren eingetreten sind. Der nicht beglichene Teil der eingetretenen Versicherungsfälle wird zu den Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle hinzugerechnet. |
|
16.35 |
Ansprüche aus im Kalenderjahr eingetretenen Versicherungsfällen an die Nichtlebensversicherung haben folgende Form: beglichene Ansprüche
Oder anders dargestellt haben sie folgende Form: beglichene Ansprüche
|
|
16.36 |
Sämtliche Kosten in Verbindung mit Versicherungsansprüchen, die dem Versicherer intern oder extern entstehen, werden nicht in die Berechnung der eingetretenen Versicherungsfälle einbezogen. Dazu zählen gegebenenfalls: Kosten für Beschaffung, Policenverwaltung, Anlagemanagement sowie die Bearbeitung von Versicherungsfällen. Einige Kosten lassen sich in der Buchhaltungsdatenquelle u. U. nicht gesondert ermitteln. Die externen Kosten umfassen Ausgaben für Arbeiten, die der Versicherer einer anderen Einheit übertragen hat und die damit als Vorleistungen ausgewiesen werden. Die internen Kosten beinhalten Ausgaben für Arbeiten, die von den Beschäftigten des Versicherers ausgeführt werden und die damit als Lohnkosten ausgewiesen werden. |
|
16.37 |
Im Falle von Katastrophen darf sich der eingetretene Verlust nicht auf die Höhe des Versicherungsanspruchs auswirken. Katastrophenschäden sollten als Vermögenstransfer vom Versicherer an den Versicherungsnehmer gebucht werden. Der Vorteil einer solchen Buchung besteht darin, dass das verfügbare Einkommen des Versicherungsnehmers entgegen der Intuition nicht ansteigt, wie es bei einer anderen Buchung der Ansprüche der Fall wäre (siehe 16.92 und 16.93). |
|
16.38 |
Die Produktion von Versicherungsdienstleistungen ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht nur dann stattfindet, wenn ein Risiko auftritt. Doch die Höhe der Schadensansprüche im Falle von Versicherungsnehmern einer Nichtlebensversicherung schwankt von Jahr zu Jahr, und es können Ereignisse eintreten, die die Schadensansprüche besonders in die Höhe treiben. Weder das Volumen noch der Preis von Versicherungsdienstleistungen wird direkt vom unwägbaren Charakter der Risiken beeinflusst. Die Versicherer legen die Höhe der Prämien auf der Grundlage ihrer Schätzungen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Versicherungsfällen fest. Aus diesem Grund sollte bei der im ESVG zur Berechnung der Produktion verwendeten Formel mit bereinigten eingetretenen Versicherungsfällen gearbeitet werden, bei denen es sich um einen um die Unwägbarkeit der Versicherungsfälle korrigierten Schätzwert handelt. |
|
16.39 |
Der Schätzwert für bereinigte eingetretene Versicherungsfälle kann statistisch mithilfe eines Erwartungsansatzes ermittelt werden, dem frühere Erfahrungen in Bezug auf die Höhe der Versicherungsfälle zugrunde liegen. Bei der Untersuchung früherer eingetretener Versicherungsfälle ist jedoch der Anteil solcher Fälle zu berücksichtigen, der im Rahmen der Rückversicherung des Direktversicherers beglichen wird. Hat der Direktversicherer beispielsweise eine Schadenexzedentenrückversicherung, eine so genannte nichtproportionale Rückversicherung, abgeschlossen, so legt er die Höhe der Prämien so fest, dass sie Schäden bis zur maximalen Schadenshöhe, die durch diese Rückversicherung abgedeckt wird, abdecken, zuzüglich der von ihr zu zahlende Rückversicherungsprämie. Bei einer proportionalen Rückversicherung bestimmt sich die Höhe der Prämien nach dem Anteil der Ansprüche, für die der Direktversicherer aufkommt, zuzüglich Rückversicherungsprämie. |
|
16.40 |
Eine alternative Methode zur Bereinigung von eingetretenen Versicherungsfällen um deren Unwägbarkeit ist die Verwendung von Buchhaltungsdaten, die Auskunft über Veränderungen beim Eigenkapital und bei den Schwankungsrückstellungen geben. Schwankungsrückstellungen sind Rückstellungen, die Versicherer gemäß geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften einrichten, um unregelmäßige oder unvorhersehbare, besonders hohe Versicherungsansprüche abzudecken. Solche Beträge sind in den versicherungstechnischen Rückstellungen für Nichtlebensversicherungen (AF.61) enthalten. |
Fällige Leistungen im Bereich Lebensversicherung
|
16.41 |
Bei den fälligen Leistungen im Bereich Lebensversicherung handelt es sich um die im fraglichen Rechnungszeitraum gemäß Police zahlbaren Beträge. Im Falle von Lebensversicherungen ist keine Bereinigung um die Unwägbarkeiten erforderlich. |
|
16.42 |
In Verbindung zu den Leistungen stehende Kosten dürfen nicht bei den fälligen Leistungen aufgeführt, sondern als Vorleistung und Lohnkosten gebucht werden. |
Versicherungstechnische Rückstellungen
|
16.43 |
Definition: Versicherungstechnische Rückstellungen sind Beträge, die vom Versicherer in die Reserve eingestellt werden. Die Rückstellungen sind für die Versicherungsnehmer Forderungen und für die Versicherer Verbindlichkeiten. Bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kann zwischen Schaden- und Lebensversicherung sowie Annuitäten unterschieden werden. |
|
16.44 |
Gemäß der Richtlinie 91/674/EWG (1) werden sieben Arten von versicherungstechnischen Rückstellungen unterschieden. In jedem Falle sind in der Bilanz der Bruttobetrag der Rückversicherung, der an Rückversicherer abgetretene Betrag und der Nettobetrag auszuweisen. Nachfolgend die sieben Kategorien:
|
|
16.45 |
Bei der Ableitung der Veränderungen der versicherungstechnischen Rückstellungen (F.61 und F.62), die zur Berechnung der Produktion herangezogen werden, werden realisierte und nicht realisierte Umbewertungsgewinne oder -verluste nicht berücksichtigt. |
Definition der Versicherungsproduktion
|
16.46 |
Versicherer erbringen für ihre Kunden eine Versicherungsdienstleistung, die sie diesen nicht explizit in Rechnung stellen. |
|
16.47 |
Der Versicherer nimmt Prämien ein und gewährt den Begünstigten den Anspruch auf eine Leistung bei Eintreten eines versicherten Ereignisses. Der Anspruch oder die Leistung entschädigen den Begünstigten für die finanziellen Konsequenzen des versicherten Ereignisses. |
|
16.48 |
Bei den versicherungstechnischen Rückstellungen handelt es sich um Mittel, die von den Versicherern gewinnbringend investiert werden. Solche Mittel und die entsprechenden Kapitalerträge (zusätzliche Prämien) sind eine Verbindlichkeit gegenüber dem Begünstigten. |
|
16.49 |
In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Informationen zur Berechnung der Produktion im Bereich Direktversicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen erforderlich sind. |
Nichtlebensversicherungen
|
16.50 |
Die Produktion des Versicherers ist die für die Begünstigten erbrachte Dienstleistung. |
|
16.51 |
Unter Verwendung eines Erwartungsansatzes wird die Produktion mit folgender Formel berechnet: verdiente Prämien
wobei die bereinigten eingetretenen Versicherungsfälle mittels historischer Angaben oder Buchhaltungsdaten, die Auskunft über Veränderungen beim Eigenkapital und bei den Schwankungsrückstellungen geben, um die Unwägbarkeit der Versicherungsfälle korrigiert wurden. Zusätzliche Prämien sind weniger unwägbar als Versicherungsfälle, so dass eine solche Bereinigung überflüssig ist. Werden die bereinigten Versicherungsfälle geschätzt, so werden sie nach Produkt — also Kfz-Versicherung, Gebäudeversicherung usw. — aufgeschlüsselt. Liegen die für eine zuverlässige Schätzung der durchschnittlichen Produktion erforderlichen Buchhaltungsdaten nicht vor bzw. liegen keine ausreichenden historischen Angaben vor, kann die Produktion der Nichtlebensversicherung geschätzt werden als Summe der Kosten (einschließlich Kosten für Vorleistungen, Lohn- und Investitionskosten) zuzüglich einer Pauschale für den „normalen Gewinn“. |
Lebensversicherung
|
16.52 |
Die Produktion der Direktlebensversicherung wird separat wie folgt berechnet: verdiente Prämien
|
|
16.53 |
Liegen keine angemessenen Daten für die Berechnung der Lebensversicherung nach dieser Formel vor, so ist ein auf die Summe der Kosten bezogener Ansatz ähnlich dem für die Nichtlebensversicherung beschriebenen Ansatz zu verwenden. Wie bei der Nichtlebensversicherung wird eine Pauschale für den normalen Gewinn aufgenommen. |
|
16.54 |
Bei der Berechnung der Produktion dürfen Umbewertungsgewinne und -verluste nicht berücksichtigt werden. |
Rückversicherung
|
16.55 |
Die Produktion der Rückversicherung berechnet sich analog zur Produktion der Direktversicherung. Da jedoch das Hauptmotiv der Rückversicherung darin besteht, die Risikoexposition der Direktversicherer zu begrenzen, ist es üblich, dass Rückversicherer außergewöhnlich hohe Schadenersatzansprüche begleichen müssen. Aus diesem Grund und weil sich der Rückversicherungsmarkt weltweit auf relativ wenige große Firmen beschränkt, ist es bei Rückversicherern weniger wahrscheinlich, dass sie einen unerwartet großen Verlust erleiden, als bei Direktversicherern, insbesondere bei der Schadenexzedentenrückversicherung. |
|
16.56 |
Die Produktion der Rückversicherung wird in derselben Weise gemessen wie die Produktion der direkten Nichtlebensversicherung. Es gibt jedoch Zahlungen, die nur bei Rückversicherungen vorkommen. Diese Zahlungen sind Provisionen, die im Rahmen der proportionalen Rückversicherung und der Gewinnbeteiligung bei der Schadenexzedentenrückversicherung an den Direktversicherer zu zahlen sind. Nach Berücksichtigung dieser Elemente wird die Produktion der Rückversicherung wie folgt berechnet: verdiente Prämien abzüglich zu zahlender Provisionen
|
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT DER NICHTLEBENSVERSICHERUNG
|
16.57 |
In diesem Abschnitt werden sämtliche Buchungen beschrieben, die zur Verbuchung einer Nichtlebensversicherungspolice notwendig sind. Derartige Versicherungen können von Unternehmen, Haushalten als Einzelperson und Einheiten in der übrigen Welt abgeschlossen werden. Gilt eine von einem Mitglied eines privaten Haushalts abgeschlossene Versicherung als Versicherung im Sinne des Sozialschutzes, so sind die Buchungen gemäß Kapitel 17 vorzunehmen. |
Aufteilung der Versicherungsproduktion auf die Verwender
|
16.58 |
Die Produktion von Nichtlebensversicherern ist im Abschnitt 16.51 beschrieben. Der Wert der Produktion von Versicherern wird wie folgt verbucht:
|
|
16.59 |
Der Produktionswert wird nach Art der Versicherung auf die Verwender aufgeteilt. |
|
16.60 |
Alternativ kann der Produktionswert den Versicherungsnehmern als Verwendungen gemäß dem Anteil der von ihnen tatsächlich zu zahlenden Prämien zugeordnet werden. |
|
16.61 |
Die den Vorleistungen zugeordnete Produktion wird nach Wirtschaftsbereichen aufgeschlüsselt. |
Versicherungsdienstleistungen für die übrige und aus der übrigen Welt
|
16.62 |
Gebietsansässige Versicherer können Haushalten und Unternehmen in der übrigen Welt Versicherungsschutz gewähren, und gebietsansässige Haushalte und Unternehmen können Versicherungsschutz von Versicherern in der übrigen Welt erwerben. Die den Versicherungsnehmern von den gebietsansässigen Versicherern zugeordneten Kapitalerträge betreffen auch Versicherungsnehmer in der übrigen Welt. Diese gebietsfremden Versicherungsnehmer zahlen dann auch zusätzliche Prämien an den gebietsansässigen Versicherer. |
|
16.63 |
Ähnliche Überlegungen gelten auch für die Behandlung von gebietsansässigen Unternehmen und Haushalten, die Versicherungen bei gebietsfremden Versicherern abschließen. Gebietsansässige Versicherungsnehmer erhalten unterstellte Kapitalerträge aus dem Ausland und zahlen Prämien und zusätzliche Prämien ins Ausland. Die Schätzung des Umfangs solcher Ströme gestaltet sich schwierig, vor allem wenn es keinen gebietsansässigen Versicherer gibt, mit dem Vergleiche angestellt werden können. Daten von Partnersektoren können zu Schätzungen für die eigene Volkswirtschaft herangezogen werden. Der Umfang der Transaktionen durch Gebietsansässige muss bekannt sein, und das Verhältnis von zusätzlichen zu tatsächlichen Prämien in der Volkswirtschaft, die die Dienstleistungen erbringt, kann zur Schätzung der anfallenden Kapitalerträge und der zu zahlenden zusätzlichen Prämien herangezogen werden. |
Die Buchungsposten
|
16.64 |
Insgesamt sind für die Nichtlebensversicherung, die nicht Bestandteil des Sozialschutzes ist, sechs Transaktionspaare zu verbuchen, von denen sich zwei Paare auf die Messung von Produktion und Verbrauch von Versicherungsdienstleistungen und drei Paare sich auf die Verteilung beziehen und ein Paar sich auf das Finanzierungskonto bezieht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine siebte, sich auf die Verteilung beziehende Transaktion im Vermögensbildungskonto verbucht werden. Der Produktionswert der Aktivität, die den Versicherungsnehmern zugeordneten Kapitalerträge und der Wert des Dienstleistungsentgelts werden gesondert für die Nichtlebensversicherung berechnet, wie nachfolgend beschrieben. |
|
16.65 |
Transaktionen in den Bereichen Produktion und Verbrauch:
|
|
16.66 |
Die Verteilungstransaktionen erstrecken sich auf Versicherungsnehmern zugerechnete Kapitalerträge in Bezug auf Nichtlebensversicherungen, Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen und Versicherungsleistungen:
|
|
16.67 |
Ein Beispiel für solche Buchungen wird in Tabelle 16.1 gegeben. Tabelle 16.1 Nichtlebensversicherung
|
TRANSAKTIONEN BEI DER LEBENSVERSICHERUNG
|
16.68 |
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie sich die Buchungen der Lebensversicherung von denen der Nichtlebensversicherung unterscheiden. Die Leistungen bei einer Lebensversicherungspolice werden als Vermögen behandelt und im Finanzierungskonto gebucht. Bei einer Police, die als Sozialschutz eingestuft werden kann, werden die Alterssicherungsleistungen als Einkommen im Konto der sekundären Einkommensverteilung ausgewiesen. Der Grund für die unterschiedliche Behandlung besteht darin, dass nicht unter den Sozialschutz fallende Versicherungen ausschließlich auf Initiative des Versicherungsnehmers abgeschlossen werden. Unter den Sozialschutz fallende Versicherungen beinhalten stets das Eingreifen Dritter, gewöhnlich des Staates oder des Arbeitgebers, die den Versicherungsnehmer auffordern oder verpflichten, Vorsorge für den Ruhestand zu treffen. Der Sozialschutz wird in Kapitel 17 beschrieben. |
|
16.69 |
Der Inhaber einer Lebensversicherungspolice ist eine Person, die dem Sektor der privaten Haushalte (S.143 oder S.144) zugeordnet ist. Schließt ein Unternehmen eine Versicherung auf das Leben eines Mitarbeiters ab, so ist diese eine Risikolebensversicherung und keine Lebensversicherung. Folglich finden Lebensversicherungstransaktionen nur zwischen Versicherern (des Teilsektors Versicherungsgesellschaften (S.128)) und gebietsansässigen Haushalten als Einzelpersonen (S.143 und S.144) statt, sofern sie nicht an gebietsfremde Haushalte (des Sektors übrige Welt (S.2)) exportiert werden. Der Produktionswert der Lebensversicherung entspricht dem Wert der Konsumausgaben der Haushalte und den Dienstleistungsexporten, wobei derselbe Ansatz gilt wie für die Nichtlebensversicherung. Die den Versicherungsnehmern zugeordneten Kapitalerträge werden als zusätzliche Prämien behandelt. Prämien und Leistungen werden im Falle der Lebensversicherung jedoch nicht getrennt ausgewiesen und nicht als laufende Transfers behandelt. Vielmehr bilden sie Komponenten einer im Finanzierungskonto gebuchten Nettotransaktion, deren finanzielle Aktiva Ansprüche aus Lebens- und Rentenversicherungen sind. |
|
16.70 |
Vier Transaktionspaare werden in der Gesamtrechnung gebucht; zwei Paare beziehen sich auf Produktion und Verbrauch von Versicherungsdienstleistungen, ein Paar weist die Zuordnung von Kapitalerträgen an die Versicherungsnehmer aus und ein Paar die Veränderung der Ansprüche aus Lebens- und Rentenversicherungen:
|
|
16.71 |
Die Rückstellungen für Lebens- und Rentenversicherungen resultieren aus Policen, bei denen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine einmalige Leistung fällig wird. Die einmalige Leistung kann zum Erwerb einer Annuität genutzt werden, die wiederum die einmalige Leistung in einen Zahlungsstrom verwandelt. Die an Voraussetzungen gebundenen Ansprüche des einzelnen Versicherungsnehmers — der Betrag, der ihm bei oder nach Ablauf der Versicherung als einmalige Leistung oder als Annuität zusteht — ergeben nicht den Wert der Verpflichtungen der Versicherers. Die entsprechende Differenz ergibt sich aus der Konditionalität und der Berechnung des Gegenwartswertes. Die Höhe der in Bezug auf Ansprüche aus Rückstellungen bei Lebens- und Rentenversicherungen zu buchenden Beträge richtet sich nach den Buchführungsgrundsätzen der Versicherer. |
|
16.72 |
Ein Beispiel für solche Ströme wird in Tabelle 16.2 gegeben. Tabelle 16.2 Lebensversicherung
|
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT DER RÜCKVERSICHERUNG
|
16.73 |
Die Verbuchung von Rückversicherungen ist weitgehend die gleiche wie die der Direktversicherer. Der einzige Unterschied besteht darin, dass aus Direktversicherungstransaktionen mit versicherungsfremden Versicherungsnehmern Versicherungstransaktionen zwischen einem Rückversicherer und einem Direktversicherer werden. |
|
16.74 |
Die Versicherungstransaktionen sind ohne Abzug der Rückversicherung zu buchen. Prämien sind zunächst an die Direktversicherer zu zahlen, die dann ggf. einen Teil der Prämie an den Rückversicherer zahlen (Zession), der wiederum einen geringeren Betrag an einen weiteren Rückversicherer zahlt usw. (Retrozession). Dasselbe gilt analog für Versicherungsfälle/Leistungen. Die Bruttobuchung befindet sich im Einklang mit dem Blickwinkel des ursprünglichen Versicherungsnehmers. Dem Versicherungsnehmer ist im Normalfall nicht bekannt, dass die Direktversicherung Beträge an einen Rückversicherer abtritt, und sollte der Rückversicherer in Konkurs gehen, bleibt die Direktversicherung für den gesamten Betrag der Leistungen für die abgetretenen Risiken haftbar. |
|
16.75 |
Die Produktion der Direktversicherung wird ohne Abzug der Rückversicherung berechnet. Bei der alternativen Berechnung unter Abzug der Rückversicherung würde ausgewiesen, welcher Anteil der von den Versicherungsnehmern gezahlten Prämien unmittelbar an den Direktversicherer fließt und welcher Anteil an den Rückversicherer; allerdings ist diese so genannte „Nettoverbuchung“ nicht gestattet. Im Diagramm 1 ist dieser Ablauf dargestellt. Diagramm 1 — Ströme zwischen Versicherungsnehmern, Direktversicherern und Rückversicherern
|
|
16.76 |
Diagramm 1 zeigt folgende Ströme:
|
|
16.77 |
Sämtliche Bruttoströme zwischen Versicherungsnehmer und Direktversicherer umfassen die entsprechenden Beträge der Ströme zwischen dem Direktversicherer und dem Rückversicherer; deshalb sind diese Pfeile im Diagramm dicker dargestellt. |
|
16.78 |
Analog zur Direktversicherung wird ein Teil der Rückversicherungsleistungen nach Katastrophenschäden als sonstige Vermögenstransfers und nicht als laufende Transfers gebucht. |
|
16.79 |
Die Gesamtheit der Produktion des Rückversicherers stellt Vorleistung des Direktversicherers dar, der die Rückversicherung abgeschlossen hat. Wie oben erwähnt, werden viele Rückversicherungsverträge von Versicherern geschlossen, die in unterschiedlichen Volkswirtschaften ansässig sind. Folglich repräsentiert der Wert der Produktion in solchen Fällen Einfuhren durch den Versicherer, der die Rückversicherung abschließt, und Ausfuhren durch den Rückversicherer. |
|
16.80 |
Die Buchung der mit der Rückversicherung verbundenen Ströme ähnelt der Buchung im Falle der Nichtlebensversicherung mit dem Unterschied, dass es sich beim Versicherungsnehmer einer Rückversicherung stets um einen anderen Versicherer handelt. |
|
16.81 |
Transaktionen in den Bereichen Produktion und Verbrauch:
|
|
16.82 |
Die Verteilungstransaktionen erstrecken sich auf Versicherungsnehmern zugerechnete Kapitalerträge in Bezug auf Rückversicherungen, Nettoprämien für Rückversicherungen und Rückversicherungsleistungen:
|
|
16.83 |
Von Rückversicherern an Versicherer als Rückversicherungsnehmer zu zahlende Provisionen werden als Kürzung der an die Rückversicherer zu zahlenden Prämien behandelt. Die vom Rückversicherer an den Direktversicherer zu zahlende Gewinnbeteiligung wird als laufender Transfer gebucht. Auch wenn sie unterschiedlich gebucht werden, führen zu zahlende Provisionen und Gewinnbeteiligungen dazu, dass die Produktion der Rückversicherer sinkt. |
|
16.84 |
Wenn Leistungen der Direktversicherung als Vermögenstransfers und nicht als laufende Transfers behandelt werden, so sind Leistungen der Rückversicherung, die sich auf dasselbe Ereignis beziehen, ebenfalls als sonstige Vermögenstransfers zu behandeln (D.99). |
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT VERSICHERUNGSHILFSTÄTIGKEITEN
|
16.85 |
Die Produktion von Versicherungshilfstätigkeiten wird auf der Grundlage der in Rechnung gestellten Gebühren oder Provisionen bewertet. Im Falle von Organisationen ohne Erwerbszweck, die als Wirtschaftsverbände im Dienst von Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen tätig sind, wird die Produktion anhand der von den Mitgliedern dieser Verbände gezahlten Mitgliedsbeiträge bewertet. Diese Produktion gilt für die Mitglieder der Verbände als Vorleistung. |
ANNUITÄTEN
|
16.86 |
Die einfachste Form der Lebensversicherung ist eine Police, bei der der Versicherungsnehmer über einen bestimmten Zeitraum kontinuierliche Zahlungen an den Versicherer leistet und an einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt als Gegenleistung eine einmalige Zahlung erhält. Bei der einfachsten Form der Annuität leistet der hier als Rentenempfänger bezeichnete Versicherungsnehmer eine einmalige Zahlung an den Versicherer und erhält als Gegenleistung regelmäßige Zahlungen für einen festgelegten Zeitraum oder für die Lebensdauer des Rentenempfängers (oder möglicherweise für die Lebensdauer des Rentenempfängers und einer anderen benannten Person). |
|
16.87 |
Annuitäten werden von Versicherern angeboten und stellen eine Art des Risikomanagements dar. Der Rentenempfänger schaltet das Risiko aus, indem er sich bereit erklärt, als Gegenleistung für einen von ihm einmal zu zahlenden Betrag einen (entweder in absoluter Höhe bekannten oder nach einer Formel — z. B. Indexbindung —berechneten) Zahlungsstrom zu erhalten. Der Versicherer übernimmt das Risiko, bei der Anlage der Einmalzahlung mehr zu verdienen, als dem Rentenempfänger zusteht. Bei der Festlegung des Zahlungsstroms wird die Lebenserwartung berücksichtigt. |
|
16.88 |
Zu Beginn eines Rentenvertrags transferiert ein Haushalt einen bestimmten Betrag an einen Versicherer. In vielen Fällen handelt es sich dabei jedoch einfach um die unverzügliche Übertragung eines von diesem oder einem anderen Versicherer aufgrund der Fälligkeit einer normalen Lebensversicherung zu zahlenden Pauschalbetrages in einen Rentenvertrag. In solchen Fällen ist es nicht nötig, die Zahlung eines Einmalbetrages und den Erwerb der Annuität auszuweisen; es findet lediglich im Teilsektor der Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen ein Wechsel statt von den Rückstellungen der Lebensversicherung zu den Rückstellungen der Altersicherungssysteme. Wird eine Annuität unabhängig von einer fällig werdenden Lebensversicherung erworben, so wird dieser Vorgang als ein finanzielles Transaktionspaar zwischen dem Haushalt und dem Versicherer gebucht. Der Haushalt leistet eine Zahlung an den Versicherer und hat im Gegenzug und gemäß den Bestimmungen des Rentenvertrags Anspruch auf einen Vermögenswert. Der Versicherer erhält vom Haushalt Aktiva und geht gegenüber dem Haushalt eine Verbindlichkeit ein. |
|
16.89 |
Annuitäten enden mit dem Tod, und die zu diesem Zeitpunkt für den Rentenempfänger verbleibenden Rückstellungen gehen an den Versicherer über. Angenommen, der Versicherer hat die Lebenserwartung für die Gruppe der Rentenempfänger als Ganzes präzise vorhergesagt, so belaufen sich die zum Zeitpunkt des Todes verbleibenden Mittel auf null. Verändern sich die Lebenserwartungen müssen Veränderungen an den Rückstellungen vorgenommen werden. Bei laufenden Rentenverträgen haben höhere Lebenserwartungen eine Reduzierung des Betrages zur Folge, der dem Versicherer als Dienstleistungsentgelt zur Verfügung steht und der dabei in den Negativbereich absinken kann. In einem solchen Fall muss der Versicherer seine Eigenmittel in Anspruch nehmen und hoffen, dass er diese durch Berechnung höherer Dienstleistungsentgelte bei Neuabschlüssen von Rentenverträgen wieder aufstocken kann. |
BUCHUNG VON NICHTLEBENSVERSICHERUNGSLEISTUNGEN
Behandlung von bereinigten Versicherungsfällen
|
16.90 |
Der Zeitpunkt der Buchung von eingetretenen Versicherungsfällen ist gewöhnlich dann, wenn das Versicherungsereignis eintritt. Dieser Grundsatz wird auch dann angewendet, wenn in strittigen Fällen die Abwicklung gegebenenfalls Jahre nach Eintritt des entsprechenden Ereignisses erfolgt. Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen die Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen, erst lange nach dem Eintritt des Ereignisses anerkannt wird. So wurde beispielsweise eine wichtige Reihe von Versicherungsansprüchen erst anerkannt, als die Exposition gegenüber Asbest als Ursache für schwere Erkrankungen anerkannt und festgestellt worden war, dass die Möglichkeit besteht, Ansprüche aus zum Zeitpunkt der Exposition bestehenden Versicherungen geltend zu machen. In solchen Fällen wird der Anspruch zu dem Zeitpunkt gebucht, an dem die Versicherungsgesellschaft die Haftung akzeptiert. Das geschieht möglicherweise nicht zum selben Zeitpunkt, zu dem die Höhe des Anspruchs vereinbart oder die entsprechende Leistung ausgezahlt wird. |
|
16.91 |
Da in der Formel für die Produktion mit bereinigten Versicherungsfällen und nicht mit tatsächlichen Versicherungsansprüchen gearbeitet wird, stimmen Nettoprämien und Leistungen für einen bestimmten Zeitraum nur dann überein, wenn die tatsächlichen Leistungen denselben Wert haben wie die erwarteten Leistungen. Beide Werte sollten über einen mehrjährigen Zeitraum mit Ausnahmen von Jahren, in denen eine Katastrophe verbucht wird, annähernd gleich sein. |
Behandlung von Katastrophenschäden
|
16.92 |
Leistungen werden als laufende Transfers gebucht, die dem Versicherungsnehmer vom Versicherer geschuldet werden. Es gibt einen Fall, in dem Leistungen als sonstige Vermögenstransfers (D.99) und nicht als laufende Transfers behandelt werden, und zwar nach einer großen Katastrophe. Die Kriterien dafür, wann die Auswirkungen einer Katastrophe in dieser Form zu behandeln sind, richten sich nach den einzelstaatlichen Umständen, wobei die Zahl der betroffenen Versicherungsnehmer und der Umfang der Schäden gegebenenfalls eine Rolle spielen. Die Buchung der Leistungen als Vermögenstransfers ist in diesem Fall deshalb gerechtfertigt, weil viele der Versicherungsfälle die Zerstörung oder schwere Beschädigung von Vermögenswerten wie Wohnbauten und Nichtwohnbauten betreffen. |
|
16.93 |
Nach einer Katastrophe wird der Gesamtwert der über die Prämien hinausgehenden Leistungen als Vermögenstransfer vom Versicherer an den Versicherungsnehmer gebucht. Informationen über die Höhe der im Rahmen der entsprechenden Versicherungspolicen zu begleichenden Ansprüche werden vom Versicherungsgewerbe eingeholt. Kann das Versicherungsgewerbe derartige Informationen nicht bereitstellen, besteht ein Ansatz zur Schätzung der Höhe der aus der Katastrophe resultierenden Ansprüche darin, die Differenz zwischen den bereinigten und den tatsächlichen Versicherungsfällen während des Zeitraums der Katastrophe zu bilden. |
(1) Richtlinie 91/674/EG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7).
KAPITEL 17
SOZIALSCHUTZSYSTEME EINSCHLIESSLICH ALTERSSICHERUNG
EINFÜHRUNG
|
17.01 |
Definition: Sozialschutzsysteme sind Systeme, bei denen die Teilnehmer durch einen Dritten dazu verpflichtet oder ermutigt werden, eine Versicherung gegen bestimmte soziale Risiken oder Umstände abzuschließen, die das Wohlergehen der Teilnehmer oder ihrer Angehörigen beeinträchtigen können. In solche Systeme zahlen Arbeitnehmer und andere Personen, bzw. Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer, Sozialbeiträge ein, um für die Arbeitnehmer und sonstigen Einzahler, deren Angehörige oder Hinterbliebene den Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen sicherzustellen. Beiträge zu Sozialschutzsystemen können auch durch bzw. für Selbständige und Nichterwerbstätige gezahlt werden. |
|
17.02 |
Es gibt zwei Gruppen von Sozialschutzsystemen:
|
|
17.03 |
Der Umfang von Sozialschutzsystemen variiert von Land zu Land und von System zu System innerhalb desselben Landes. Beispiele solcher Systeme sind:
Tabelle 17.1 — Sozialschutzsysteme
|
Sozialschutzsysteme, Sozialhilfe und Einzelversicherungsverträge
|
17.04 |
Die Sozialhilfe ist kein Bestandteil des Sozialschutzes. Sie wird unabhängig von der Teilnahme an einem Sozialschutzsystem geleistet, d. h. ohne dass beispielsweise anspruchsbegründende Beitragszahlungen an ein Sozialschutzsystem erfolgt sind. |
|
17.05 |
Die Sozialhilfe unterscheidet sich von der Sozialversicherung hinsichtlich des Leistungsanspruchs gegenüber dem Staat und ist nicht von der durch Beitragszahlungen belegten Teilnahme an einem System abhängig. Üblicherweise können sämtliche Mitglieder gebietsansässiger privater Haushalte Sozialhilfe beantragen; allerdings ist die Gewährung häufig mit Einschränkungen verbunden. Oft wird das verfügbare Einkommen einschließlich der Sozialschutzleistungen mit dem ermittelten Bedarf des Haushalts verglichen. Nur bei Haushalten, deren Einkommen unterhalb einer bestimmten Bemessungsgrenze liegt, kann ein Anspruch auf Sozialhilfe vorliegen. |
|
17.06 |
Einzelversicherungsverträge kommen als Sozialschutzsysteme in Betracht, wenn sie soziale Risiken und Bedürfnisse wie Krankheit und Alter abdecken. Ein Einzelversicherungsvertrag wird nur dann als Teil eines Sozialschutzsystems behandelt, wenn die Eventualitäten und Umstände, gegen die sich die Teilnehmer versichern, den unter 4.84 aufgelisteten Risiken und Bedürfnissen entsprechen und wenn darüber hinaus eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
|
|
17.07 |
Leistungsansprüche aus kollektiven Versicherungsverträgen, die mit dem alleinigen Ziel der Erzielung eines Rabatts abgeschlossen werden, bleiben vom Sozialschutz ausgeschlossen. Solche Einzelversicherungsverträge werden als Lebens- und Schadensversicherungen gebucht. Vom Sozialschutz ausgeschlossen bleiben auch Leistungsansprüche aus Versicherungsverträgen, die der Versicherte aus alleiniger Initiative unabhängig vom Arbeitgeber oder Staat abschließt. |
Sozialleistungen
|
17.08 |
Sozialleistungen werden bei Eintritt bestimmter Ereignisse oder bei Vorliegen bestimmter Umstände gezahlt, die insofern das Wohlergehen der betroffenen Haushalte beeinträchtigen könnten, als ihnen zusätzliche finanzielle Belastungen entstehen oder ihr Einkommen sinkt. Sozialleistungen können in Form von Bar- und Sachleistungen erbracht werden und müssen bei Vorliegen bestimmter Umstände gezahlt werden. Dazu zählen folgende Sachverhalte:
|
Sozialleistungen des Staates
|
17.09 |
Der Staat erbringt Sozialleistungen durch Zahlungen aus der Sozialversicherung sowie in Form sozialer Geld- und Sachleistungen. |
|
17.10 |
Unter Sozialversicherung sind die Sozialschutzsysteme des Staates zu verstehen. |
|
17.11 |
Die Definition des Begriffs "Sozialleistungen" beinhaltet die Bereitstellung von Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen. Üblicherweise stellt der Staat Dienstleistungen dieser Art allen Mitgliedern der Gesellschaft zur Verfügung, ohne dass die Teilnahme an einem System erforderlich ist oder anspruchsbegründende Bedingungen erfüllt sein müssen. Die Dienstleistungen werden als soziale Sachtransfers behandelt und nicht als Bestandteil der Sozialversicherung oder als Sozialhilfe. Neben dem Staat können auch private Organisationen ohne Erwerbszweck Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen für Einzelpersonen bereitstellen. Solche Leistungen werden ebenfalls als soziale Sachtransfers und nicht als Bestandteil von Sozialschutzsystemen behandelt. |
Sozialleistungen anderer institutioneller Einheiten
|
17.12 |
Sozialleistungen können auch von Arbeitgebern für ihre Arbeitnehmer und deren Angehörige bzw. von anderen Einheiten wie Gewerkschaften erbracht werden. Sämtliche Sozialleistungen anderer Einheiten werden im Rahmen eines Sozialschutzsystems bereitgestellt. |
Alterssicherungsleistungen und sonstige Leistungen
|
17.13 |
Die Sozialschutzleistungen und die entsprechenden Beiträge sind in die Bereiche "Alterssicherungsleistungen" und "Sonstige Leistungen" untergliedert. Die wichtigste Alterssicherungsleistung aus Sozialschutzsystemen sind die Altersbezüge, wobei es jedoch auch andere Beispiele gibt. Dazu gehören beispielsweise Witwen- und Witwerrenten sowie Rentenzahlungen an Personen, die nach einem Arbeitsunfall erwerbsunfähig sind. Da der Hauptverdiener hier aufgrund von Tod oder Erwerbsunfähigkeit kein Einkommen mehr erzielen kann, werden die Zahlungen als Alterssicherungsleistungen erbracht und gebucht. |
|
17.14 |
Alle übrigen Leistungen werden der Kategorie "Sonstige Leistungen" zugeordnet. Die Unterscheidung zwischen Alterssicherungsleistungen und sonstigen Leistungen ist wichtig, weil Ansprüche gegenüber Altersvorsorgeeinrichtungen unabhängig davon ausgewiesen werden, ob tatsächlich Rücklagen zur Erfüllung von Ansprüchen gebildet werden oder nicht, während im Falle sonstiger Leistungen nur tatsächlich vorhandene Rückstellungen gebucht werden. |
SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR SOZIALEN SICHERUNG OHNE ALTERSSICHERUNGSLEISTUNGEN
|
17.15 |
Definition: Sonstige Sozialschutzleistungen (ohne Alterssicherungsleistungen) sind Leistungen, die Anspruchsberechtigte direkt oder indirekt bei Eintritt bestimmter Ereignisse und üblicherweise unter bestimmten rechtlichen oder vertraglichen Bedingungen erhalten. Mit Ausnahme der Alterssicherungsleistungen sind zahlreiche andere Sachverhalte abgedeckt. Beispiele sind Leistungen der Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie Leistungen der Langzeitpflege. |
|
17.16 |
Sonstige Sozialschutzleistungen werden Anspruchsberechtigten im Rahmen von Systemen der Sozialversicherung und durch betriebliche Systeme (ohne Sozialversicherung) gewährt. |
Systeme der Sozialversicherung ohne Alterssicherung
|
17.17 |
Definition: Sozialversicherungssysteme (ohne Alterssicherung) sehen vor, dass den Versorgungsberechtigten in ihrer Eigenschaft als Mitglied eines Sozialschutzsystems vom Staat die Pflicht zur Absicherung von Risiken (ohne Alter und altersbedingte Risiken) auferlegt wird. Leistungen der Sozialversicherung (ohne Alterssicherungsleistungen) werden für die Versorgungsberechtigten durch den Staat erbracht. |
|
17.18 |
Gewöhnlich zahlen die Versicherten Pflichtbeiträge in ein häufig umlagefinanziertes Sozialversicherungssystem (ohne Alterssicherung) ein. Die in einem bestimmten Zeitraum empfangenen Beiträge werden zur Finanzierung der im selben Zeitraum fälligen Leistungen verwendet. Eine Bildung von Rückstellungen ist weder aufseiten des Staates oder des Arbeitgebers, der das System betreibt, noch aufseiten der teilnehmenden Versorgungsberechtigten vorgesehen. Im Allgemeinen fallen also keine Überschüsse an, und bei Finanzierungsproblemen ist der Staat befugt, Änderungen bei den Leistungszusagen nicht nur im Hinblick auf künftige Beschäftigungszeiten, sondern auch auf zurückliegende Beschäftigungszeiten vorzunehmen. In einigen Ländern können Sozialversicherungssysteme (ohne Alterssicherung) jedoch Rückstellungen bilden, die auch als Pufferfonds bezeichnet werden. |
|
17.19 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen gegenüber einem Sozialversicherungssystem ohne Alterssicherungsansprüche werden in den Hauptkonten des ESVG nicht ausgewiesen. Schätzungen offener Ansprüche aus Sozialversicherungssystemen (ohne Alterssicherung) sowie etwaigen sonstigen betrieblichen Rentensystemen des Staates werden weder in den Hauptkonten noch in der Tabelle 17.5 erfasst. |
Sonstige betriebliche Sozialschutzsysteme
|
17.20 |
Definition: Sonstige betriebliche Sozialschutzsysteme sind Versicherungen, die entweder gesetzlich vorgeschrieben sind oder von Dritten gefördert werden. In sonstigen betrieblichen Sozialschutzsystemen kann der Arbeitgeber ein Beschäftigungsverhältnis davon abhängig machen, dass sich Arbeitnehmer an einem vom ihm bestimmten Sozialschutzsystem beteiligen, um sich über Alterssicherung und altersbedingte Risiken hinaus gegen weitere Risiken abzusichern. Solche betrieblichen Systeme werden für Versorgungsberechtigte entweder vom Arbeitgeber oder von anderen Einheiten im Namen des Arbeitgebers bereitgestellt. |
|
17.21 |
Sonstige betriebliche Sozialschutzsysteme werden ebenso wie die entsprechenden Altersvorsorgeeinrichtungen als Bestandteil der Gesamtvergütung betrachtet, wobei die aktuellen Beschäftigungsbedingungen und Lohngruppen ein Schwerpunkt von Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein können. Häufig erbringen Arbeitgeber aus der Privatwirtschaft Sozialschutzleistungen (ohne Alterssicherungsleistungen) im Rahmen von Systemen, die sie selbst betreiben oder mit dessen Verwaltung sie Dritte wie zum Beispiel eine Versicherungsgesellschaft beauftragen, die Sozialleistungen wie private medizinische Versorgungsleistungen erbringt. |
Buchung von Strom- und Bestandsgrößen nach Art des Sozialschutzsystems (ohne Alterssicherung)
Sozialversicherungssystem
|
17.22 |
Da die Sozialversicherung in der Regel ein umlagefinanziertes System ist, werden aus diesem System erworbene Ansprüche, wie Sozialleistungen einschließlich Renten, nicht in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesen. |
|
17.23 |
Während Alterssicherungsansprüche aus Sozialversicherungssystemen in der Ergänzungstabelle zu im Rahmen der Sozialversicherung aufgelaufene Rentenansprüchen erscheinen, trifft dies auf alle anderen Ansprüche aus diesen Systemen (ohne Alterssicherung) nicht zu. |
|
17.24 |
Die Buchung der Stromgrößen von Sozialversicherungssystemen (ohne Alterssicherung) betrifft die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie Leistungen der Sozialversicherung. |
|
17.25 |
Sämtliche Arbeitgeberbeiträge werden als Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts behandelt und als vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer geleistete Verteilungstransaktion ausgewiesen. Der Arbeitnehmer entrichtet dann einen Betrag in der gleichen Höhe wie vom Arbeitgeber empfangen zuzüglich etwaiger eigener Sozialversicherungsbeiträge an die Sozialversicherung. Dieser Betrag wird als Verwendung privater Haushalte und als Aufkommen beim Staat gebucht. |
|
17.26 |
Beitragszahlungen von Selbständigen und Nichterwerbstätigen werden ebenfalls den von privaten Haushalten an den Staat abgeführten Beiträgen zugeordnet. |
|
17.27 |
Leistungen der Sozialversicherung werden als Verteilungstransaktionen gebucht, die vom Staat an private Haushalte geleistet werden. |
|
17.28 |
Tabelle 17.2 zeigt die Transaktionen im Zusammenhang mit einer Altersvorsorgeeinrichtung der Sozialversicherung. Diese entsprechen den Transaktionen im Zusammenhang mit Sozialversicherungssystemen ohne Alterssicherung. |
Sonstige betriebliche Sozialschutzsysteme (ohne Alterssicherung)
|
17.29 |
Für die sonstigen betrieblichen Sozialschutzsysteme gilt, dass die Ansprüche der Teilnehmer in der Regel bei ihrer Entstehung gebucht werden. Kapitalerträge aus bestehenden Ansprüchen werden als an die Begünstigten ausgeschüttet und von diesen in das System reinvestiert ausgewiesen. |
|
17.30 |
Der vom Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer an ein Sozialschutzsystem abgeführte Beitrag wird als Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts behandelt. |
|
17.31 |
Kapitalerträge aus erworbenen Ansprüchen werden als Ausschüttungen des Systems an die privaten Haushalte dargestellt. Die Kapitalerträge schließen Zinsen und Dividenden ein; zu diesen kommen die ausgeschütteten Erträge aus gemeinschaftlichen Kapitalanlagesystemen, wenn die institutionelle Einheit Anteile daran hält. Das System kann Immobilien besitzen und damit einen Nettobetriebsüberschuss erwirtschaften, der mit den Kapitalerträgen als an die Begünstigten ausgeschüttet erfasst wird. In diesem Fall ist der Begriff "Kapitalerträge" so auszulegen, dass er diese Einkommensquelle mit einschließt. Umbewertungsgewinne und -verluste, die durch die Anlage der erworbenen Ansprüche entstehen, werden nicht den Kapitalerträgen zugerechnet, sondern als sonstige Vermögensänderungen aufgrund von Umbewertungen gebucht. |
|
17.32 |
Ein Teil der an die privaten Haushalte ausgeschütteten Erträge wird verwendet, um die Kosten für das Betreiben des Systems zu bestreiten. Diese Kosten werden als Produktionswert des Systems und Konsumausgabe der privaten Haushalte ausgewiesen. Der verbleibende Teil der ausgeschütteten Erträge wird als zusätzlicher Sozialbeitrag aus Kapitalerträgen behandelt, den die privaten Haushalte wieder in das System einzahlen. |
|
17.33 |
Sozialbeiträge werden als von den privaten Haushalten an das System geleistet gebucht. Die Sozialbeiträge bestehen aus den tatsächlichen Beiträgen der Arbeitgeber, die Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts sind, den tatsächlichen Beiträgen von Arbeitnehmern und Einzelpersonen, Selbständigen und Nichterwerbstätigen sowie Ruheständlern, die zuvor an einem System teilgenommen haben, sowie aus den unter 17.32 genannten zusätzlichen Beiträgen. |
|
17.34 |
Bei denjenigen, die nicht als Arbeitnehmer in ein Sozialschutzsystem einzahlen, kann es sich um Selbständige und Nichterwerbstätige handeln, die aufgrund ihres Berufs oder ihres früheren Beschäftigungsstatus teilnehmen. |
|
17.35 |
Die vom Systemverwalter an die privaten Haushalte ausgezahlten Leistungen werden als Verteilungstransaktionen unter "Sonstige Sozialschutzleistungen" ausgewiesen. |
|
17.36 |
Das Entgelt für die vom Systemverwalter erbrachte Dienstleistung, dessen Höhe sich am Produktionswert des Systems bemisst, wird als Konsumausgabe privater Haushalte gebucht. |
|
17.37 |
Eine Zunahme von Versorgungsansprüchen aufgrund eines Überschusses der Beiträge über die Leistungen wird als geleistete Zahlung des Sozialschutzsystems an die privaten Haushalte ausgewiesen. Dieses Verfahren wurde gewählt, da sich die Zunahme von Ansprüchen direkt auf das Reinvermögen der privaten Haushalte auswirkt und deshalb den Ersparnissen des Sektors private Haushalte zugeordnet werden sollte. |
|
17.38 |
Die Zunahme der Ansprüche der privaten Haushalte wird als Forderung der privaten Haushalte gegen das System gebucht. |
|
17.39 |
In Tabelle 17.3 sind die Transaktionen für eine betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung aufgezeigt. Diese entsprechen den Transaktionen im Zusammenhang mit Sozialschutzsystemen (ohne Alterssicherung). |
ALTERSSICHERUNGSLEISTUNGEN
|
17.40 |
Definition: Alterssicherungsleistungen aus Sozialschutzsystemen sind Leistungen, die Anspruchsberechtigte bei Eintritt in den Ruhestand erhalten, wobei üblicherweise bestimmte rechtliche oder vertragliche Bedingungen erfüllt sein müssen und die Leistung in Form einer garantierten Rentenzahlung erbracht wird. Die wichtigste Alterssicherungsleistung aus Sozialschutzsystemen sind die Altersbezüge, wobei es jedoch auch eine Reihe andere Fälle gibt. Dazu gehören beispielsweise Witwen- und Witwerrenten sowie Rentenzahlungen an Personen, die nach einem Arbeitsunfall erwerbsunfähig sind. Alle Ereignisse, die einen Anspruch auf Zahlungen begründen, weil der Verdiener aufgrund von Tod oder Erwerbsunfähigkeit nicht mehr in der Lage ist, ein Einkommen für sich selbst und unterhaltsberechtigte Angehörige zu erzielen, werden als Alterssicherungsleistungen behandelt. |
Arten von Altersvorsorgeeinrichtungen
|
17.41 |
Alterssicherungsleistungen an Anspruchsberechtigte können folgende Formen annehmen:
Diese werden in der Regel von der Sozialversicherung, anderen öffentlichen Körperschaften, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen oder institutionellen Einheiten wie Arbeitgebern gezahlt. Je nach Gegebenheiten in den einzelnen Ländern können jedoch auch andere Institutionen beteiligt sein. Der Begriff "Sozialversicherung" wird hier unabhängig von der Form der Ausgestaltung gebraucht. Insofern sind die Begriffe Sozialversicherung und Sozialversicherungssystem im Gebrauch gleichbedeutend. Spezielle Deckungsmittel müssen nicht vorhanden sein. |
|
17.42 |
Alterssicherungsleistungen aus Sozialschutzsystemen erhalten Anspruchsberechtigte als Teilnehmer derartiger Systeme. Der vom Staat bereitgestellte Teil wird als Sozialversicherungsrente (einschließlich Sozialversicherung) bezeichnet, der von anderen Einheiten aufgebrachte Teil als sonstige Leistung zur sozialen Alterssicherung oder Betriebsrente. Die Untergliederung in Renten der Sozialversicherung und Betriebsrenten variiert von Land zu Land erheblich, was zur Folge hat, dass auch der Erfassungsbereich und somit die Ansichten darüber, was unter dem Begriff "Sozialversicherung" zu verstehen ist, sich deutlich unterscheidet. |
Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung
|
17.43 |
Definition: Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung sehen vor, dass den Versorgungsberechtigten in ihrer Eigenschaft als Versicherte eines Sozialschutzsystems vom Staat die Pflicht zur Alterssicherung und zur Absicherung weiterer altersbedingter Risiken wie Erwerbsunfähigkeit, Krankheit usw. auferlegt wird. Alterssicherungsleistungen der Sozialversicherung werden für die Versorgungsberechtigten durch den Staat erbracht. |
|
17.44 |
Ist der Staat für Rentenzahlungen an große Teile der Bevölkerung zuständig, übernimmt die soziale Sicherung die Funktion eines Systems mehrerer Arbeitgeber. |
|
17.45 |
Gewöhnlich zahlen Versicherte Pflichtbeiträge in eine häufig umlagefinanzierte Altersvorsorgeeinrichtung der Sozialversicherung ein. Die in einem bestimmten Zeitraum empfangenen Beiträge werden zur Finanzierung der im selben Zeitraum fälligen Leistungen verwendet. Eine Bildung von Rückstellungen ist weder aufseiten des Staates oder des Arbeitgebers, der das System betreibt, noch aufseiten der teilnehmenden Versorgungsberechtigten vorgesehen. So gibt es keine Überschüsse im System und bei Finanzierungsproblemen ist der Staat befugt, Änderungen bei den Rentenzusagen nicht nur im Hinblick auf künftige Beschäftigungszeiten, sondern auch rückwirkend vorzunehmen. In einigen Ländern können Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung jedoch Rückstellungen bilden, die als Pufferfonds bezeichnet werden. |
|
17.46 |
Die niedrigste Stufe der Sozialversicherungsrente ist nicht mehr als eine Grundsicherung. Deren Höhe kann unabhängig von den geleisteten Beitragszahlungen bestimmt werden, wenn auch nicht unabhängig von der Tatsache, dass Beiträge für einen bestimmten Zeitraum oder unter sonstigen spezifischen Bedingungen geleistet wurden. Der von einem Arbeitnehmer erworbene Anspruch auf Alterssicherungsleistungen der Sozialversicherung ist bei einem Arbeitgeberwechsel oftmals übertragbar. |
|
17.47 |
In manchen Ländern erfolgen Rentenzahlungen überwiegend oder sogar vollständig durch die Sozialversicherung. Dann fungiert der Staat als Mittler der Arbeitgeber; sobald er deren Beiträge und die der privaten Haushalte erhalten hat, trägt er das etwaige Zahlungsrisiko. Der Staat entlastet den Arbeitgeber von dem Risiko, dass sein Unternehmen die Ansprüche gegebenenfalls nicht tragen kann und garantiert der Bevölkerung die Alterssicherungsleistungen, allerdings mit der Einschränkung, dass sich deren Höhe auch rückwirkend ändern kann. |
|
17.48 |
Offene Alterssicherungsansprüche gegenüber einer Altersvorsorgeeinrichtung der Sozialversicherung werden in den Hauptkonten des ESVG nicht ausgewiesen. Schätzungen offener Ansprüche aus Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung sowie etwaigen sonstigen betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtungen des Staates mit Leistungszusage werden nicht in den Hauptkonten gebucht, sondern in der Ergänzungstabelle für in der Sozialversicherung aufgelaufene Rentenansprüche in Tabelle 17.5 ausgewiesen. |
Sonstige betriebliche Altersvorsorgeeinrichtungen
|
17.49 |
Definition: Sonstige betriebliche Altersvorsorgeeinrichtungen sind Versicherungen, die entweder gesetzlich vorgeschrieben sind, vom Staat gefördert werden oder bei denen der Arbeitgeber ein Beschäftigungsverhältnis davon abhängig macht, dass sich Arbeitnehmer (als die Versorgungsberechtigten) zwecks Alterssicherung und Absicherung anderer altersbedingter Risiken an einem vom ihm bestimmten Sozialschutzsystem beteiligen. Diese betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtungen werden für Versorgungsberechtigte entweder vom Arbeitgeber oder von anderen Einheiten im Namen des Arbeitgebers bereitgestellt. |
|
17.50 |
Üblicherweise erfolgen bei Altersvorsorgeeinrichtungen, die von Arbeitgebern der Privatwirtschaft betrieben werden, nur dann rückwirkende Anpassungen der Höhe der Zahlungen, wenn Arbeitgeber und Versorgungsberechtigte dies vereinbaren. Allerdings besteht das Risiko, dass der Arbeitgeber wegen Einstellung der Geschäftstätigkeit keine Zahlungen leisten kann. Zunehmend setzt sich die Absicherung von Alterssicherungsansprüchen durch. Die bei einem Arbeitgeber erworbenen Ansprüche sind möglicherweise nicht auf einen neuen Arbeitgeber übertragbar. In der betrieblichen Altersversorgung ist immer häufiger davon auszugehen, dass Rückstellungen gebildet werden. Doch selbst ohne Rückstellungen kann es aufgrund von Buchführungsvorschriften erforderlich sein, die Alterssicherungsansprüchen gegenwärtig und früher beschäftigter Arbeitnehmer in den Unternehmensabschlüssen auszuweisen. |
|
17.51 |
Betriebsrenten werden als Bestandteil der Gesamtvergütung betrachtet, wobei die aktuellen Beschäftigungsbedingungen, Lohngruppen und Alterssicherungsansprüche ein Schwerpunkt von Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein können. Häufig erbringen Arbeitgeber aus der Privatwirtschaft Alterssicherungsleistungen im Rahmen von Systemen, die sie selbst betreiben oder mit dessen Verwaltung sie Dritte wie zum Beispiel eine Versicherungsgesellschaft beauftragen. Auch die Übernahme der Finanzierungsverantwortung durch Dritte, gegen die Bereitstellung entsprechender Deckungsmittel, ist möglich. Eine solche Vereinbarung wird als System mehrerer Arbeitgeber bezeichnet. |
|
17.52 |
Sowohl gegenwärtig als auch früher beschäftigte Arbeitnehmer, die zu den Versicherten zählen, können in das System einzahlen und Vermögenseinkommen aus diesem System erzielen. Dieses Vermögenseinkommen wird als zusätzlicher Beitrag behandelt, zahlbar durch die Versicherten. |
|
17.53 |
Je nach Art der Altersvorsorgeeinrichtungen werden Systeme mit Beitragszusagen und Systeme mit Leistungszusagen unterschieden. |
Systeme mit Beitragszusagen
|
17.54 |
Definition: Ein System mit Beitragszusage ist ein Alterssicherungssystem, bei dem sich die Leistungen ausschließlich durch die Höhe des während des Erwerbslebens des Arbeitnehmers aus Beitragszahlungen gebildeten Kapitals und Wertsteigerungen, die durch Anlage solchen Kapitals durch den Verwalter der Altersvorsorgeeinrichtung erzielt werden, bestimmen. |
|
17.55 |
Das Risiko für ein angemessenes Einkommen im Ruhestand trägt hierbei allein der Arbeitnehmer. |
|
17.56 |
Angaben zu Systemen mit Beitragszusagen lassen sich relativ leicht bereitstellen, denn es muss eine umfassende Buchführung verfügbar sein und es ist keine versicherungsmathematische Schätzung erforderlich. Diese Systeme sind überwiegend im Sektor der Kapitalgesellschaften (Spalte A von Tabelle 17.5) angesiedelt, es können jedoch auch Fälle auftreten, in denen der Staat als Träger der Altersvorsorgeeinrichtung auftritt. Die Alterssicherungsansprüche aus allen Systemen mit Beitragszusagen erscheinen in den Hauptkonten. |
Systeme mit Leistungszusagen
|
17.57 |
Definition: Ein System mit Leistungszusage ist ein Alterssicherungssystem, bei dem die an den Arbeitnehmer im Ruhestand zu zahlenden Leistungen mithilfe einer Formel ermittelt werden, und zwar entweder für sich genommen oder in Kombination mit einer garantierten Mindestleistung. |
|
17.58 |
Das Risiko für angemessene Altersbezüge trägt hierbei der Arbeitgeber oder die in seinem Namen handelnde Einheit. |
Fiktive Systeme mit Beitragszusagen und Hybridmodelle
|
17.59 |
Fiktive Systeme mit Beitragszusagen und Hybridmodelle werden den Systemen mit Leistungszusagen zugerechnet. |
|
17.60 |
Definition: Ein fiktives System mit Beitragszusage ähnelt einem System mit Beitragszusage, garantiert jedoch eine Mindestleistung. |
|
17.61 |
Bei einem solchen System werden die Beiträge (sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers) individuellen Konten gutgeschrieben und dort angesammelt. Dabei handelt es sich in dem Sinne um fiktive Einzelkonten, dass die gezahlten Beiträge unmittelbar für Rentenzahlungen an die derzeitigen Pensionäre verwendet werden. Beim Eintritt in den Ruhestand wird das angesammelte Guthaben mithilfe einer Formel in eine Rente umgerechnet, wobei unter anderem die Lebenserwartung herangezogen wird. Die Leistungshöhe wird jährlich unter Berücksichtigung der Entwicklung des Lebensstandards überprüft. |
|
17.62 |
Hybridmodelle sind Systeme, die sowohl das Element "Leistungszusage" als auch das Element "Beitragszusage" enthalten. Eine Einstufung als Hybridmodell erfolgt entweder, weil Rückstellungen für Leistungszusagen und Beitragszusagen gleichermaßen vorhanden sind oder weil das Modell zugleich ein fiktives System mit Beitragszusagen und eine Rückstellung für Leistungszusagen oder Beitragszusagen einschließt. Die Rückstellung kann kombiniert für einen einzelnen Versorgungsberechtigten gestaltet oder nach Gruppen von Versorgungsberechtigten differenziert sein, je nach Art des Vertrags, der Rentenart usw. |
|
17.63 |
Das Risiko für die Absicherung eines angemessenen Ruhestandseinkommens tragen bei einem fiktiven System mit Beitragszusage und beim Hybridmodell Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam. |
|
17.64 |
In bestimmten Fällen kann das Risiko des Arbeitgebers von einem System mehrerer Arbeitgeber übernommen werden, das die Altersvorsorgeeinrichtung mit Leistungszusage im Auftrag des Arbeitgebers betreibt. |
Vergleich der Systeme mit Leistungszusagen und mit Beitragszusagen
|
17.65 |
Mit Blick auf die Bestimmung der Alterssicherungsansprüche besteht der grundlegende Unterschied zwischen Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen und entsprechenden Systemen mit Beitragszusagen darin, dass im erstgenannten Fall die Leistung an den Arbeitnehmer im laufenden Rechnungszeitraum anhand der Leistungszusagen des Arbeitgebers bestimmt wird, während beim System mit Beitragszusage die Leistung an den Arbeitnehmer im laufenden Rechnungszeitraum anhand der in das System eingezahlten Beiträge sowie der Kapitalerträge und der mit diesen und früheren Beiträgen erwirtschafteten Umbewertungsgewinne und -verluste ermittelt wird. Das bedeutet, dass zwar genaue Angaben über die Leistungen verfügbar sind, auf die Teilnehmer eines Alterssicherungssystems mit Beitragszusage Anspruch haben, die Leistungen für Teilnehmer an einer Altersvorsorgeeinrichtung mit Leistungszusage jedoch versicherungsmathematisch ermittelt werden müssen. |
|
17.66 |
Im Falle von Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen gibt es vier Gründe für Veränderungen bei den Alterssicherungsansprüchen. Als erstes ist die Zunahme laufender Versorgungsansprüche zu nennen, d. h. der Ansprüche, die mit dem im laufenden Rechnungszeitraum erzielten Verdienst in Verbindung stehen. Ein zweiter Grund ist die Zunahme bei in der Vergangenheit erworbenen Versorgungsansprüchen, d. h. die Steigerung des Wertes des Anspruchs aufgrund der Tatsache, dass für alle Teilnehmer an dem System der Ruhestand (bzw. Tod) ein Jahr näher gerückt ist. Die dritte Veränderung bei den Versorgungsansprüchen betrifft eine Abnahme aufgrund der Auszahlung von Leistungen an Ruheständler. Der vierte Grund für Veränderungen resultiert aus anderen Faktoren, die sich im Konto sonstiger Vermögensänderungen widerspiegeln. |
|
17.67 |
Ebenso wie bei einer Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusagen können der Arbeitgeber und/oder der Arbeitnehmer im laufenden Rechnungszeitraum tatsächliche Beitragszahlungen an das System leisten. Solche Einzahlungen reichen aber möglicherweise nicht aus, um die Zunahme bei den Leistungsansprüchen abzudecken, die im laufenden Jahr erworben wurden. Daher wird ein zusätzlicher Beitrag des Arbeitgebers unterstellt, um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den (tatsächlichen und unterstellten) Beiträgen und der Zunahme laufender Versorgungsansprüche zu erreichen. Solche unterstellten Beiträge sind in der Regel positiv, können aber auch negativ sein, wenn die Summe der Beitragseinnahmen die Zunahme laufender Versorgungsansprüche übersteigt. |
|
17.68 |
Am Ende einer Rechnungsperiode kann die Höhe der Alterssicherungsansprüche gegenwärtig und früher beschäftigter Arbeitnehmer errechnet werden, indem der Gegenwartswert der im Ruhestand fälligen Summen mithilfe versicherungsmathematischer Berechnungen ermittelt wird. Ein Grund für den alljährlichen Anstieg dieser Summe ist die Tatsache, dass der Gegenwartswert der zu Beginn eines Jahres bestehenden Ansprüche, die auch am Jahresende noch zu erfüllen sind, gestiegen ist, weil die Zukunft ein Jahr näher gerückt ist und demzufolge bei der Berechnung des Gegenwartswert ein niedrigerer Abzinsungsfaktor zugrunde gelegt werden muss. Dies bewirkt eine Zunahme von in der Vergangenheit erworbenen Versorgungsansprüchen. |
|
17.69 |
Ein weiterer grundlegender Unterschied zwischen Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen und entsprechenden Systemen mit Beitragszusagen betrifft die Kosten, die das Betreiben des jeweiligen Systems verursacht. Beim System mit Beitragszusagen geht das Risiko vollständig zulasten der Versorgungsberechtigten. Die Altersvorsorgeeinrichtung wird für sie betrieben, und sie tragen die diesbezüglichen Kosten. Da für den Betrieb des Systems anstelle des Arbeitgebers eine andere Einheit zuständig sein kann, ist die Zuordnung der Kosten zum Vermögenseinkommen, das von dem System einbehalten wird, um diese Kosten zu bestreiten (und einen Gewinn zu erwirtschaften), angebracht. Unter Beachtung der Buchungsregeln für Versicherungen wird das Vermögenseinkommen als vollständig den Versicherten zugeflossen angesehen, wobei ein Teil davon für das Bestreiten der Kosten verwendet und der restliche Betrag in das System reinvestiert wird. |
|
17.70 |
Bei Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen ist die Situation anders. Das Risiko, dass Alterssicherungsansprüche nicht in ausreichendem Maße befriedigt werden können, tragen nicht ausschließlich die Versorgungsberechtigten, sondern teilweise oder vollständig der Arbeitgeber bzw. die in seinem Auftrag handelnde Einheit. Das System kann direkt vom Arbeitgeber kontrolliert werden, es kann Teil derselben institutionellen Einheit bzw. rein fiktiver Art sein. Selbst in diesem Fall ist das Betreiben des Systems mit Kosten verbunden. Obwohl solche Kosten anfangs der Arbeitgeber trägt, ist es angebracht, sie als eine Form von Sachleistung zu betrachten, die Arbeitnehmer erhalten, und der Einfachheit halber können die Kosten in die Arbeitgeberbeiträge einbezogen werden. Dies basiert auf der Annahme, dass sämtliche Kosten von den gegenwärtig beschäftigten Arbeitnehmern und in keiner Weise von den Rentenbeziehern getragen werden. Ferner wird angenommen, dass die Zuordnung, die bei fiktiven Systemen erfolgen muss, auch unter anderen Umständen angewendet werden kann. |
|
17.71 |
In Systeme mit Leistungszusagen dürften Selbständige und Nichterwerbstätige derzeit kaum einzahlen, wenngleich diese Möglichkeit besteht, sofern sie früher abhängig beschäftigt waren, dadurch einen Anspruch auf eine leistungsorientierte Alterssicherung erworben haben und zur weiteren Teilnahme berechtigt sind. Zuvor abhängig Beschäftigte erhalten Vermögenseinkommen und entrichten zusätzliche Beiträge, unabhängig davon, ob sie eine Rente beziehen oder nicht. |
Verwalter und Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen und Altersvorsorgeeinrichtung mehrerer Arbeitgeber
|
17.72 |
Sozialschutzsysteme können vom Arbeitgeber oder Staat organisiert werden, sie können von Versicherungsgesellschaften für Arbeitnehmer organisiert werden oder es können separate institutionelle Einheiten errichtet werden, die das für die Erfüllung der Ansprüche und Ausschüttung der Rentenzahlungen zu verwendende Vermögen halten und verwalten. Der Teilsektor Alterssicherungssysteme besteht nur aus denjenigen Altersvorsorgeeinrichtungen der sozialen Sicherung, die separate institutionelle Einheiten darstellen. |
|
17.73 |
Arbeitgeber können eine andere Einheit mit der Verwaltung der Altersvorsorgeeinrichtung und der Durchführung von Auszahlungen an die Versorgungsberechtigten beauftragen. Dafür können verschiedene Möglichkeiten genutzt werden. |
|
17.74 |
Erste Möglichkeit: Der Verwalter der Altersvorsorgeeinrichtung handelt als Betreiber lediglich als Beauftragter des Arbeitgebers und übernimmt die routinemäßige Verwaltung des Systems, wobei der Arbeitgeber weiterhin für etwaige Defizite haftet bzw. die etwaigen Überschüssen erhält. |
|
17.75 |
Zweite Möglichkeit: Der Träger einer Altersvorsorgeeinrichtung ist auch für die Festlegung der Bedingungen für eine betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung zuständig und trägt die endgültige Verantwortung für die Alterssicherungsansprüche. Der Träger eines Alterssicherungssystems ist zudem in erheblichem Umfang für die langfristige Strategie im Anlagebereich zuständig, darunter für die Auswahl von Anlagemöglichkeiten und die Anbieterstruktur. Obwohl ein und dieselbe Einheit häufig gleichzeitig als Träger und als Verwalter eines Alterssicherungssystems fungieren kann, obliegen diese Aufgaben in manchen Fällen verschiedenen Einheiten. |
|
17.76 |
Drittens ist es nicht unüblich, dass eine einzige Einheit im Auftrag mehrerer Arbeitgeber handelt und deren Altersvorsorgeeinrichtungen im Rahmen eines Systems mehrerer Arbeitgeber verwaltet. Dabei übernimmt die Altersvorsorgeeinrichtung mehrerer Arbeitgeber die Verantwortung für etwaige Deckungslücken und erhält dafür im Gegenzug das Recht, etwaige Überschüsse einzubehalten. Von der Risikogemeinschaft erhofft man sich einen Ausgleich zwischen Unter- und Überfinanzierung, so dass mit allen Systemen zusammengenommen — ähnlich wie bei der viele Kunden umfassenden Risikogemeinschaft einer Versicherungsgesellschaft — ein Überschuss erwirtschaftet wird. In diesem Fall handelt das System mehrerer Arbeitgeber als Träger der Altersvorsorgeeinrichtung. |
|
17.77 |
Ist der Staat für Rentenzahlungen an große Teile der Bevölkerung zuständig, übernimmt die Sozialversicherung die Funktion eines Systems mehrerer Arbeitgeber. Wie bei einer Versicherungsgesellschaft haftet dann der Staat für etwaige Deckungslücken oder kann das Recht auf Einbehaltung etwaiger Überschüsse erhalten. Es kommt jedoch häufig vor, dass die Sozialversicherung umlagefinanziert wird, so dass im Allgemeinen keine Überschüsse anfallen, und bei Finanzierungsproblemen ist der Staat befugt, Änderungen bei den Rentenzusagen nicht nur im Hinblick auf künftige Beschäftigungszeiten, sondern auch rückwirkend vorzunehmen. |
|
17.78 |
Die Verantwortung des Trägers eines Alterssicherungssystems für eine Unterfinanzierung bzw. eine Überfinanzierung eines Alterssicherungssystems wird als Verbindlichkeit bzw. Forderung gegenüber dem Verwalter des Systems ausgewiesen. Die Veränderung der Verbindlichkeiten zwischen dem Träger und dem Verwalter eines Alterssicherungssystems wird periodenweise ausgewiesen. Die auf den Träger der Altersvorsorgeeinrichtung entfallenden Verbindlichkeiten sind nicht die gesamten Alterssicherungsansprüche aus dem Alterssicherungssystem, sondern die Differenz zwischen den Alterssicherungsansprüchen und den Anlagen des Alterssicherungssystems. Soweit die Aktiva der Altersvorsorgeeinrichtung über die Alterssicherungsansprüche hinausgehen, also eine Überfinanzierung vorliegt, wird ein Anspruch beim Träger der Altersvorsorgeeinrichtung gebucht, wodurch gesichert ist, dass eine etwaige Überfinanzierung im Falle der Liquidation der Altersvorsorgeeinrichtung in das Vermögen des Trägers dieses Systems übergeht. |
|
17.79 |
Umbewertungsgewinne und -verluste bei den vom Verwalter verwalteten Kapitalanlagen werden dem Träger der Altersvorsorgeeinrichtung zugeschrieben, sodass das Reinvermögen der Altersvorsorgeeinrichtung stets genau Null beträgt. |
Buchung von Strom- und Bestandsgrößen nach Art der Altersvorsorgeeinrichtung im Sozialschutz
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung
|
17.80 |
Da die Sozialversicherung in der Regel ein umlagefinanziertes System ist, werden aus diesem System erworbene Alterssicherungsansprüche nicht in den Hauptkonten ausgewiesen. Wenn alle Länder durchweg vergleichbare Leistungen im Rahmen von Sozialversicherungs- und Sozialschutzsystemen bieten würden, könnten internationale Vergleiche relativ problemlos angestellt werden. Das ist aber nicht der Fall und die Auffassungen der einzelnen Länder, was genau durch die Sozialversicherung abgedeckt wird, gehen erheblich auseinander. |
|
17.81 |
Die Alterssicherungsansprüche aus Sozialversicherungssystemen sind in den Hauptkonten nicht enthalten. Sozialversicherungssysteme und die betriebliche Altersversorgung sind in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Alterssicherungsansprüche aus Sozialversicherungssystemen werden in die Ergänzungstabelle für in der Sozialversicherung aufgelaufene Rentenansprüche (Tabelle 17.5) aufgenommen, um die Vergleichbarkeit von Länderdaten zu ermöglichen. |
|
17.82 |
Die Buchung der Stromgrößen von Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung betrifft die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie Leistungen der Sozialversicherung. |
|
17.83 |
Ein vom Arbeitgeber geleisteter Beitrag wird als Teil des Arbeitnehmerentgeltes behandelt. Er wird als Verteilungstransaktion vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gebucht. Der Arbeitnehmer entrichtet dann einen Betrag in gleicher Höhe wie der Arbeitgeberbeitrag zuzüglich etwaiger eigener Beiträge an die Sozialversicherung. Dieser Betrag wird als Zahlung privater Haushalte an den Staat gebucht. |
|
17.84 |
Beitragszahlungen von Selbständigen und Nichterwerbstätigen werden ebenfalls den von privaten Haushalten an den Staat abgeführten Beiträgen zugeordnet. |
|
17.85 |
Leistungen der Sozialversicherung werden als Verteilungstransaktionen gebucht, die vom Staat an private Haushalte gehen. |
|
17.86 |
In Tabelle 17.2 werden die Transaktionen eines Alterssicherungssystems der Sozialversicherung abgebildet. Tabelle 17.2 — Konten für die Sozialbeiträge und Alterssicherungsleistungen der Sozialversicherung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen für sonstige betriebliche Alterssicherungssysteme
|
17.87 |
Für die sonstigen betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtungen werden die Alterssicherungsansprüche der Teilnehmer in der Regel bei ihrer Entstehung gebucht. Kapitalerträge aus bestehenden Alterssicherungsansprüchen werden als an die Begünstigten ausgeschüttet und von diesen in die Altersvorsorgeeinrichtung reinvestiert ausgewiesen. |
|
17.88 |
Die Ausweisung von Transaktionen ist bei einem System mit Beitragszusagen weniger kompliziert als im Falle eines Systems mit Leistungszusagen. |
|
17.89 |
Bei beiden Systemen wird die Existenz einer Altersvorsorgeeinrichtung mit speziellen Deckungsmitteln unterstellt. Bei Systemen mit Beitragszusagen muss eine solche Einrichtung tatsächlich bestehen. Im Falle von Systemen mit Leistungszusagen kann eine Einrichtung real existieren, möglich ist aber auch eine fiktive Einrichtung. Im erstgenannten Fall kann die Einrichtung Bestandteil derselben institutionellen Einheit wie der Arbeitgeber sein, denkbar wäre auch die Bildung einer gesonderten institutionellen Einheit, einer rechtlich selbständigen Pensionskasse oder die Eingliederung in ein anderes Finanzinstitut, entweder eine Versicherungsgesellschaft oder ein System mehrerer Arbeitgeber. |
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen mit Beitragszusage
|
17.90 |
Der vom Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer abgeführte Beitrag an eine Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusage wird als Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts behandelt. |
|
17.91 |
Kapitalerträge aus erworbenen Alterssicherungsansprüchen werden als Ausschüttungen der Altersvorsorgeeinrichtung an die privaten Haushalte dargestellt. Die Kapitalerträge schließen Zinsen und Dividenden zuzüglich der ausgeschütteten Erträge aus gemeinschaftlichen Kapitalanlagesystemen ein, wenn die Altersvorsorgeeinrichtung Anteile daran hält. Die Altersvorsorgeeinrichtung kann Immobilien besitzen und damit einen Nettobetriebsüberschuss erwirtschaften, der mit den Kapitalerträgen als an die Begünstigten ausgeschüttet erfasst wird. In diesem Fall schließt der Begriff "Kapitalerträge" diese gegebenenfalls vorhandene Einkommensquelle mit ein. Umbewertungsgewinne und -verluste, die durch die Anlage der erworbenen Alterssicherungsansprüche entstehen, werden nicht den Kapitalerträgen zugerechnet, sondern als sonstige Vermögensänderung aufgrund von Umbewertungen gebucht. |
|
17.92 |
Ein Teil der an die privaten Haushalte ausgeschütteten Erträge wird verwendet, um die Kosten für das Betreiben der Altersvorsorgeeinrichtung zu bestreiten. Diese Kosten werden als Produktionswert der Altersvorsorgeeinrichtung und als Konsumausgabe der privaten Haushalte ausgewiesen. Der verbleibende Teil der ausgeschütteten Erträge wird als zusätzlicher Beitrag behandelt, den die privaten Haushalte wieder in die Altersvorsorgeeinrichtung einzahlen. |
|
17.93 |
Sozialbeiträge werden als Zahlungen von privaten Haushalten an die Altersvorsorgeeinrichtung gebucht. Die Sozialbeiträge bestehen aus den tatsächlichen Beiträgen der Arbeitgeber, die Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts sind, den tatsächlichen Beiträgen von Arbeitnehmern und eventuell anderen Einzelpersonen, wie Personen, die zuvor an einem System teilgenommen haben, Selbständigen und Nichterwerbstätigen sowie Ruheständlern, sowie aus den unter 17.92 genannten zusätzlichen Beiträgen. Zur Verdeutlichung und um Systeme mit Leistungszusagen besser vergleichen zu können, werden die zusätzlichen Beitragsleistungen mit ihrem vollen Wert ausgewiesen. Die Gesamtheit aller von privaten Haushalten in die Altersvorsorgeeinrichtung eingezahlten Beiträge stellt genauso einen Nettowert dar wie Versicherungsprämien, d. h. es handelt sich um die Summe aller Beiträge abzüglich des Dienstleistungsentgelts. |
|
17.94 |
Andere Beitragszahler als Arbeitnehmer, die in eine Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusagen einzahlen, können Selbständige und Nichterwerbstätige sein, die aufgrund ihres Berufs bzw. ihres früheren Status als abhängig Beschäftigte an einem System mit Beitragszusagen teilnehmen. |
|
17.95 |
Die von der Altersvorsorgeeinrichtung an die privaten Haushalte auszuzahlenden Leistungen werden als "sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung" (D.6221) gebucht. |
|
17.96 |
Die von der Altersvorsorgeeinrichtung erbrachte Dienstleistung, deren Höhe sich am Produktionswert der Einrichtung bemisst, wird als Konsumausgabe privater Haushalte abgebildet. |
|
17.97 |
Die Zunahme von betrieblichen Versorgungsansprüchen aufgrund eines Überschusses der Beiträge über die Leistungen wird als Zahlung der Altersvorsorgeeinrichtung an die privaten Haushalte ausgewiesen. Entsprechend wird eine Abnahme von Alterssicherungsansprüchen, die durch ein Defizit der Beiträge im Verhältnis zu den Leistungen verursacht wird, als Zahlung der privaten Haushalte an die Altersvorsorgeeinrichtung ausgewiesen. Die Änderung der Alterssicherungsansprüche hat eine unmittelbare Auswirkung auf das Reinvermögen der privaten Haushalte und somit auf die Ersparnisse der privaten Haushalte. Da ein großer Teil der Zunahme der Alterssicherungsansprüche in einer Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusagen und damit letztlich auch die Finanzierung der Leistungen aus Umbewertungsgewinnen stammt, die nicht den zusätzlichen Beiträgen zugeordnet werden, wird die Zunahme betrieblicher Alterssicherungsansprüche häufig negativ sein. |
|
17.98 |
Die Zunahme der von der Altersvorsorgeeinrichtung an die privaten Haushalte gezahlten Alterssicherungsansprüche wird als Forderung der privaten Haushalte gegenüber der Altersvorsorgeeinrichtung gebucht. |
|
17.99 |
Aus Tabelle 17.3 ist ersichtlich, welche Buchungen für eine Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusagen erforderlich sind. Weil für diese Tabelle keine unterstellten Transaktionen zu berücksichtigen sind, ist sie übersichtlicher als die entsprechende Tabelle für ein System mit Leistungszusagen. Tabelle 17.3 — Konten für Alterssicherungsleistungen aus einem System mit Beitragszusagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Ströme in einer Altersvorsorgeeinrichtung mit Beitragszusage
|
17.100 |
Die weiteren Faktoren, die den Wert der Alterssicherungsansprüche in der Vermögensbilanz beeinflussen, werden im Konto sonstiger Vermögensänderungen gebucht. Dies betrifft insbesondere die Ansprüche der Begünstigten auf Umbewertungsgewinne. Diese Umbewertungsgewinne und -verluste im Umbewertungskonto entsprechen genau den Gewinnen und Verlusten bei den Vermögenswerten, die von der Altersvorsorgeeinrichtung zur Deckung solcher Verbindlichkeiten gehalten werden. |
|
17.101 |
Durch Anlage der Ansprüche aus Altersvorsorgeeinrichtungen mit Beitragszusagen werden Umbewertungsgewinne oder -verluste erzielt. Solche Gewinne oder Verluste entstehen durch Änderungen bei den von der Altersvorsorgeeinrichtung gehaltenen Vermögenswerten, und ein Betrag in Höhe der Umbewertungsgewinne und -verluste wird im Umbewertungskonto als Zunahme der Alterssicherungsansprüche der Begünstigten ausgewiesen. |
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusage
|
17.102 |
Bei Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen verbleibt die Verantwortung für die Rentenzahlungen beim Arbeitgeber. Andere Gestaltungsmöglichkeiten, darunter die Nutzung eines Systems mehrerer Arbeitgeber oder die Übernahme der Verantwortung durch den Staat, folgen den Definitionen unter 17.76 und 17.77. |
|
17.103 |
Der Gesamtbeitrag, den ein Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer an ein System mit Leistungszusagen leistet, muss so bemessen sein, dass er zusammen mit einem etwaigen tatsächlichen Beitrag des Arbeitnehmers und abzüglich der Kosten für das Betreiben des Systems die Zunahme der Alterssicherungsansprüche des Arbeitnehmers abdeckt. Der Arbeitgeberbeitrag untergliedert sich in einen tatsächlichen und einen unterstellten Beitrag, wobei Letzterer so berechnet ist, dass die geforderte vollständige Übereinstimmung zwischen allen Beiträgen und der Zunahme der Ansprüche des Arbeitnehmers abzüglich des Dienstleistungsentgelts, gegeben ist. |
|
17.104 |
Der Beitrag des Arbeitgebers wird auf der Grundlage des in dem betreffenden Zeitraum erworbenen Alterssicherungsanspruchs, d. h. ohne Berücksichtigung etwaiger Kapitalerträge des Systems in demselben Zeitraum oder einer etwaigen Überfinanzierung des Systems, bestimmt. Der im laufenden Rechnungszeitraum erworbene Anspruch ist Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts. Wird der Wert des Arbeitgeberbeitrags nicht oder nicht vollständig berücksichtigt, kommt es zu einer Unterschätzung des Arbeitnehmerentgelts und daraus resultierend zu einer Überschätzung des Betriebsüberschusses des Arbeitgebers. Es ist wichtig, Beiträge auch dann zu buchen, wenn die faktische Beitragszahlung, im Falle sogenannter Beitragsferien, unterbrochen wird, d. h., wenn der Arbeitgeber keinen tatsächlichen Beitrag zahlt. Der Beitrag des Arbeitgebers wird als Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Altersvorsorgeeinrichtung betrachtet. Dadurch bleibt das Reinvermögen beider Seiten unverändert in derselben Höhe bestehen, wie bei einer Buchung als Beitragsferien, ohne das Arbeitnehmerentgelt künstlich zu kürzen. |
|
17.105 |
Bei Systemen mit Leistungszusagen besteht die Möglichkeit, eine Wartezeit festzulegen, bevor ein Arbeitnehmer Anspruch auf eine Zahlung im Ruhestand hat. Trotz dieser Wartezeit sind Beiträge und Ansprüche ab Beginn des Beschäftigungsverhältnisses zu buchen, wobei ein Anpassungsfaktor anzuwenden ist, der die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass der Arbeitnehmer das Ende der Wartezeit tatsächlich erreicht. |
|
17.106 |
Die Summe der tatsächlichen und unterstellten Altersicherungsbeiträge des Arbeitgebers wird als Arbeitnehmerentgelt behandelt. Im Einkommensentstehungskonto wird es als Verwendung des Arbeitgebers und im Konto der primären Einkommensverteilung als Aufkommen des Arbeitnehmers gebucht. |
|
17.107 |
Die Zunahme des Gegenwartswertes der Ansprüche von Arbeitnehmern und Personen, die zwar keine Einzahlungen mehr leisten, aber weiterhin das Recht auf Alterssicherungsleistungen haben, wird durch die Vermögenseinkommen abgebildet, die an die Arbeitnehmer ausgeschüttet werden. Umbewertungsgewinne werden nicht berücksichtigt. Die Kapitalerträge entsprechen der Summe, die dem Arbeitnehmer nach den geltenden Vereinbarungen unwiderruflich zusteht; wie der Arbeitgeber letztlich diese Forderung erfüllt, ist für die Buchung dieses Betrags als Vermögenseinkommen genauso unerheblich wie die Frage, wie Zinsen und Dividenden tatsächlich finanziert werden. Das Vermögenseinkommen wird für das Altersicherungssystem als Verwendung und für die privaten Haushalte als Aufkommen gebucht. Es wird von den privaten Haushalten sofort als zusätzlicher Beitrag wieder in das System eingezahlt. |
|
17.108 |
Im Konto der sekundären Einkommensverteilung werden Sozialbeiträge als Verwendung privater Haushalte und als Aufkommen der Altersicherungseinrichtung ausgewiesen. Die Gesamtsumme der zu leistenden Sozialbeiträge besteht aus den tatsächlichen und unterstellten Beiträgen der Arbeitgeber, die einen Bestandteil des Arbeitnehmerentgelts bilden, abzüglich der Kosten für die Verwaltung des Alterssicherungsystems, zuzüglich der tatsächlichen Beiträge der Arbeitnehmer und zuzüglich der unter 17.107 genannten zusätzlichen Beitragsleistungen. Wie in den Nummern 17.54 bis 17.56 in Bezug auf Systeme mit Beitragszusagen dargelegt, wird in den Konten der volle Wert der Beiträge und zusätzlichen Beiträge ausgewiesen, wobei ein Ausgleichsposten für das fällige Dienstleistungsentgelt vorgesehen ist. Die tatsächlich gezahlte Summe stellt einen Nettobeitrag dar. |
|
17.109 |
Die Alterssicherungsleistungen der Altersicherungseinrichtung an die privaten Haushalte werden im Konto der sekundären Einkommensverteilung ausgewiesen. Bei der Erbringung von Leistungen in Form einer Rente werden hier die Rentenzahlungen und nicht die zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand fällige Einmalzahlung dargestellt. |
|
17.110 |
Im Einkommensverwendungskonto wird das Dienstleistungsentgelt gebucht, dessen Höhe dem Produktionswert der Altersicherungseinrichtung zuzüglich des Produktionswerts der Unternehmen, die mit Rückstellungen erworben wurden, entspricht. Dies wird für private Haushalte als Verwendung und für die Altersicherungseinrichtung als Aufkommen ausgewiesen. |
|
17.111 |
Im Einkommensverwendungskonto wird die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche gebucht, die auf der einen Seite auf die Gewährung weiterer Alterssicherungsansprüche durch den Arbeitgeber und auf der anderen Seite auf die Abnahme der zu empfangenden Leistungen zurückzuführen ist. Dieser Betrag wird als Aufkommen privater Haushalte und als Verwendung der Altersicherungseinrichtung gebucht. Da sich die Zunahme von Ansprüchen direkt auf das Reinvermögen der privaten Haushalte auswirkt, sollte sie den Ersparnissen des Sektors private Haushalte zugeordnet werden. |
|
17.112 |
Der Betrag, der im Einkommensverwendungskonto als geleistet durch die Altersicherungseinrichtung an die privaten Haushalte dargestellt ist, wird im Finanzierungskonto als Vermögensänderung der privaten Haushalte gegenüber der Altersicherungseinrichtung ausgewiesen. |
|
17.113 |
Andere Organisationen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, können eine Altersvorsorgeeinrichtung mit Leistungszusagen für ihre Mitglieder betreiben, die in jeder Hinsicht mit einem solchen von einem Arbeitgeber betriebenen System vergleichbar ist. Es sind dieselben Buchungsvorschriften einzuhalten wie vorstehend beschrieben; der einzige Unterschied besteht darin, dass unter "Arbeitgeber" der Träger der Altersicherungseinrichtung und unter "Arbeitnehmer" der Teilnehmer des Systems zu verstehen ist. |
|
17.114 |
In Tabelle 17.4 wird anhand eines Zahlenbeispiels die Buchung von Transaktionen im Rahmen eines Systems mit Leistungszusagen veranschaulicht. Unterstellte Zahlen werden fett und Zahlen, die das Ergebnis einer Umleitung sind, kursiv dargestellt. Tabelle 17.4 — Konten für Alterssicherungsleistungen aus einem System mit Leistungszusagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.115 |
Versicherungsmathematische Berechnungen ergeben, dass die Zunahme der Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Alterssicherungssystemen, d. h. der Nettowert der im fraglichen Jahr "verdienten" weiteren Ansprüche, 15 beträgt. Der Beitrag der privaten Haushalte (Versicherte/Arbeitnehmer) beläuft sich auf 1,5. Der Arbeitgeber ist daher verpflichtet,13,5 bereitzustellen. Zudem belaufen sich die Kosten für das Betreiben des Systems auf 0,6. Demzufolge muss der Arbeitgeber insgesamt 14,1 aufbringen. Tatsächlich erbringt er 10, die restlichen 4,1 sind ein unterstellter Beitrag. Der Produktionswert von 0,6 wird im Produktionskonto ausgewiesen; die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung wird im Einkommensverwendungskonto gebucht. Die Arbeitgeberbeiträge werden im Einkommensentstehungskonto für den Arbeitgeber als Verwendung und im Konto der primären Einkommensverteilung für die privaten Haushalte als Aufkommen ausgewiesen. |
|
17.116 |
In den Konten der primären Einkommensverteilung wird auch das Vermögenseinkommen dargestellt. Die Zunahme der Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen aus bestehenden Anwartschaften von 4 ist darauf zurückzuführen, dass der Abzinsungsfaktor sinkt, weil der Ruhestand ein Jahr näher gerückt ist. Ausgewiesen wird dies als unterstellter Vermögenseinkommensstrom vom Altersicherungssystem an die privaten Haushalte. Gleichzeitig erzielt das Altersicherungssystem tatsächlich Kapitalerträge von 2,2 aus den von ihr verwalteten Mitteln. An dieser Stelle besteht daher ein Fehlbetrag von 1,8, der jedoch nicht in den Transaktionskonten ausgewiesen wird. |
|
17.117 |
In den Konten der sekundären Einkommensverteilung werden die Zahlungen der privaten Haushalte an die Altersvorsorgeeinrichtung dargestellt. Hier gibt es zwei Betrachtungsmöglichkeiten. Die Summe der von den privaten Haushalten geleisteten Beitragszahlungen sollte der Zunahme bei den Ansprüchen derzeit Aktiver (15) zuzüglich der Zunahme aufgrund der Vermögenseinkommen aus früher erworbenen Ansprüchen (4) bzw. insgesamt 19 entsprechen. Die tatsächlich geleisteten Zahlungen setzen sich wie folgt zusammen: tatsächliche Beiträge der Arbeitgeber 10, unterstellte Beiträge 4,1, eigene Beiträge der privaten Haushalte 1,5, zusätzliche Beiträge 4; davon ist das Dienstleistungsentgelt von 0,6 abzuziehen; auch in diesem Fall errechnet sich ein Gesamtwert von 19. |
|
17.118 |
Im Einkommensverwendungskonto wird unter Berücksichtigung des Dienstleistungsentgelts als Bestandteil der Konsumausgaben der privaten Haushalte die Veränderung der Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen als Verwendung der Altersicherungseinrichtung und als Aufkommen der privaten Haushalte ausgewiesen. In diesem Beispiel stehen den Beiträgen der privaten Haushalte in Höhe von 19 Alterssicherungsleistungen von 16 gegenüber. Daraus ergibt sich für die den privaten Haushalten geschuldeten Ansprüche eine Zunahme von 3. |
|
17.119 |
Der Wert für das Sparen der privaten Haushalte beträgt 17,5, wobei die Zunahme ihrer Ansprüche aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen dem Wert 3 entspricht, d. h. sie haben andere finanzielle Vermögenswerte erworben oder die Verbindlichkeiten wurden reduziert (um 14,5). Diese Zahl bildet die Differenz zwischen den empfangenen Leistungen (16) und den tatsächlichen Beiträgen der privaten Haushalte (1,5). |
|
17.120 |
Im Finanzierungskonto des Altersicherungssystems wird der Wert 4,1, bei dem es sich um den unterstellten Beitrag handelte, als Forderung des Verwalters an den Arbeitgeber ausgewiesen. Es besteht eine Forderung der privaten Haushalte an die Altersicherungseinrichtung bezüglich der Zunahme der Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen von 3. Ferner reduziert die Altersvorsorgeeinrichtung entweder den Bestand an finanziellen Vermögenswerten oder erhöht die Verbindlichkeiten um 2,3; dieser Wert entspricht dem verfügbaren Einkommen ohne die unterstellten Beiträge des Arbeitgebers. |
ERGÄNZUNGSTABELLE ZU IM RAHMEN DER SOZIALVERSICHERUNG AUFGELAUFENEN RENTENANSPRÜCHEN IM SOZIALSCHUTZ
Aufbau der Ergänzungstabelle
|
17.121 |
Die Ergänzungstabelle (Tabelle 17.5) zu im Rahmen der Sozialversicherung aufgelaufenen Rentenansprüchen im Sozialschutz bietet einen Rahmen für die Erstellung und Präsentation vergleichbarer Vermögensbilanz- und Transaktionsdaten sowie sonstiger Stromgrößen für sämtliche Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen aus der Sicht der Schuldner (Träger der Altersicherungseinrichtung) und der Gläubiger (private Haushalte). Zudem enthält die Tabelle Angaben zu Bestands– und Stromgrößen, die in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Falle bestimmter Altersvorsorgeeinrichtungen nicht vollständig gebucht werden, wie zum Beispiel staatliche Systeme mit Leistungszusage ohne spezielle Deckungsmittel, bei denen der Staat als Träger der Altersicherungseinrichtung fungiert, und Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung. |
|
17.122 |
Die Ergänzungstabelle deckt den Altersrentenzweig von Sozialschutzsystemen einschließlich der Renten ab, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt werden. In dieser Tabelle erscheinen weder Sozialhilfe noch Kranken- und Langzeitpflegeversicherung oder Krankengeld– und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen. Dasselbe gilt für Einzelversicherungsverträge. In der Praxis kann jedoch eine vollständige Identifikation aller nicht die Alterssicherung betreffenden Elemente des Sozialschutzes nicht umsetzbar bzw. nicht wichtig genug sein. Elemente der Sozialhilfe, die in Altersvorsorgeeinrichtungen im Rahmen des Sozialschutzes eingebunden sind, lassen sich möglicherweise nicht herauslösen und fließen daher in die Ergänzungstabelle ein. |
|
17.123 |
Ansprüche von Hinterbliebenen (z. B. versorgungsberechtigte Ehegatten, Kinder und Waisen) sowie Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und Invalidität werden in die Ergänzungstabelle aufgenommen, wenn sie ein integraler Bestandteil der Altersvorsorgeeinrichtung sind. |
|
17.124 |
Sämtliche Positionen in der Ergänzungstabelle werden ohne Abzug von Steuern, weiteren Sozialbeiträgen oder des für das Betreiben des Systems fälligen Dienstleistungsentgelts gebucht. Tabelle 17.5 — Ergänzungstabelle zu im Rahmen der Sozialversicherung aufgelaufenen Rentenansprüchen im Sozialschutz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tabellenspalten
|
17.125 |
Die Tabellenspalten beziehen sich wie folgt auf die Unterteilung in die drei Gruppen von Alterssicherungssystemen:
|
|
17.126 |
Bei den Begünstigten von Altersvorsorgeeinrichtungen handelt es sich überwiegend um gebietsansässige private Haushalte. In einigen Ländern kann die Anzahl gebietsfremder Haushalte, die Alterssicherungsleistungen beziehen, erheblich sein. In diesem Fall kommt eine Spalte J hinzu, in der der Gesamtbetrag für gebietsfremde Haushalte ausgewiesen wird. |
|
17.127 |
Die Entscheidung, die Alterssicherungsansprüche aus einer betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtung mit Leistungszusage ohne spezielle Deckungsmittel in den Fällen, in denen der Staat als Träger der Altersicherungseinrichtung fungiert, in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder nur in der Ergänzungstabelle zu buchen, hängt von der Art des Systems mit Leistungszusagen ab. Hauptkriterium für eine Einbeziehung in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist die Nähe des Systems zur nationalen Altersvorsorgeeinrichtung der Sozialversicherung. |
|
17.128 |
In der EU gibt es eine breite Palette unterschiedlichster Systeme, deren vollständige Einbeziehung zu Unstimmigkeiten bei der Buchung führen würde. Daher werden Ansprüche aus betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen ohne spezielle Deckungsmittel, bei denen der Staat als Träger der Altersicherungseinrichtung fungiert, nur in der Ergänzungstabelle gebucht. Das wirkt sich in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf die Methode der Berechnung der unterstellten Arbeitgebersozialbeiträge zu diesen Systemen aus. |
|
17.129 |
Ferner erfolgt eine Klassifizierung von Altersvorsorgeeinrichtungen nach Art des Trägers der Altersicherungseinrichtung; diese werden in staatliche und nichtstaatliche Träger untergliedert. Der Begriff „Träger einer Altersicherungseinrichtung“ ist unter 17.75 definiert. |
|
17.130 |
Bei einigen betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtungen gehören beispielsweise sowohl Beamte und Angehörige des öffentlichen Dienstes als auch Beschäftigte öffentlicher Kapitalgesellschaften zu den Mitgliedern; viele dieser Systeme lassen die Mitgliedschaft von Teilnehmern ruhen, die zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt sind. Ein geringer Prozentsatz von nichtstaatlichen Beschäftigten unter den Mitgliedern ist kein Hindernis für die Einstufung eines Systems als System mit staatlichem Träger. |
|
17.131 |
Systeme mit Leistungszusagen mit speziellen Deckungsmitteln, die der Staat für seine eigenen Beschäftigten eingerichtet hat, erscheinen in den Spalten E und F. In Spalte E sind Systeme ausgewiesen, die von einer Pensionskasse oder einer Versicherungsgesellschaft verwaltet werden, in Spalte F die vom Staat selbst verwalteten Systeme. Systeme, die der Staat für seine eigenen Beschäftigten betreibt und bei denen die Alterssicherungsansprüche nicht in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erscheinen, werden in Spalte G dargestellt. Aus den Spalten E, F und G wird daher die Zuständigkeit des Staates für die Alterssicherungsansprüche seiner eigenen Beschäftigten ersichtlich. |
|
17.132 |
Altersvorsorgeeinrichtungen werden in Systeme mit Beitragszusagen (Spalten A und D) und Systeme mit Leistungszusagen (Spalten B, E, F und G) unterteilt. Spalte H betrifft Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung. |
Die Tabellenzeilen
|
17.133 |
Die Tabellenzeilen in der Ergänzungstabelle stehen für Bilanzpositionen, Transaktionen und sonstige Ströme im Zusammenhang mit Alterssicherungsansprüchen, die in Tabelle 17.6 nochmals ausgewiesen werden. Sie zeigen den Übergang vom Anfangsbestand an Alterssicherungsansprüchen zu Beginn des Rechnungszeitraums zum Endbestand an Alterssicherungsansprüchen am Ende des Rechnungszeitraums unter Berücksichtigung aller Transaktionen und sonstigen Ströme während des Rechnungszeitraums. Bei den in den Spalten G und H gebuchten Systemen werden die Bestände an Alterssicherungsansprüchen nicht in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen abgebildet, wohingegen viele der Transaktionen in den Hauptkonten erfasst werden. Tabelle 17.6 — Zeilen der Ergänzungstabelle zu im Rahmen der Sozialversicherung aufgelaufenen Rentenansprüchen im Sozialschutz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eröffnungs- und Schlussbilanzen
|
17.134 |
In Zeile 1 ist der Anfangsbestand an Alterssicherungsansprüchen ausgewiesen, der genau dem Endbestand des vorherigen Rechnungszeitraums entspricht. In Zeile 10 erscheint der entsprechende Endbestand an Alterssicherungsansprüchen am Ende des Rechnungszeitraums. |
Veränderung bei Alterssicherungsansprüchen aufgrund von Transaktionen
|
17.135 |
Die tatsächlichen Sozialbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden wie in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in den Zeilen 2.1 und 2.3 gebucht. Im Falle einiger Alterssicherungssysteme, namentlich der Systeme der Sozialversicherung, muss zwischen tatsächlichen Sozialbeiträgen zu Altersvorsorgeeinrichtungen und Sozialbeiträgen unterschieden werden, die der Absicherung anderer sozialer Risiken wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit dienen. |
|
17.136 |
Im Falle von Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen werden die unterstellten Sozialbeiträge der Arbeitgeber im Allgemeinen als Restgröße bestimmt – sämtliche Veränderungen der Ansprüche im Laufe eines Jahres, die nicht in anderen Tabellenzeilen erfasst sind, werden in Zeile 2.2 ausgewiesen. In dieser Zeile schlagen sich "Erfahrungseffekte" nieder, wenn das Ergebnis der Annahmen zur Anwartschaftsberechnung (Lohnzuwachsrate, Inflationsrate und Abzinsungsfaktor) von den unterstellten Werten abweicht. Bei Altersvorsorgeeinrichtungen mit Beitragszusagen erscheinen in dieser Zeile Nullen. |
|
17.137 |
Zeile 2.4 betrifft Vermögenseinkommen, das empfangen oder den Systemen zugerechnet und über den Sektor der privaten Haushalte oder der übrigen Welt gebucht wurde. Es ist darauf hinzuweisen, dass dieses Vermögenseinkommen bei allen Systemen mit Leistungszusagen einschließlich der Sozialversicherung, ob mit oder ohne spezielle Deckungsmittel, der Senkung des Abzinsungsfaktors entspricht. Anders formuliert: Der Wert entspricht der Verzinsung der Alterssicherungsansprüche zu Beginn des Rechnungszeitraums. |
|
17.138 |
Einige der Zeileneinträge in den Spalten G und H, insbesondere die tatsächlichen Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, erscheinen in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die Ansprüche auf Alterssicherungsleistungen und die diesbezüglichen Veränderungen werden hingegen nicht ausgewiesen. Andere Einträge in den Spalten G und H, die nur in der Ergänzungstabelle dargestellt werden, sind in der Tabelle schattiert und werden nachfolgend erläutert. |
|
17.139 |
Ein besonderes Augenmerk ist auf den unterstellten Arbeitgeberbeitrag zu staatlichen Systemen zu legen, für den die Ansprüche in Spalte G, aber nicht in den Hauptkonten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erscheinen. In den Hauptkonten werden die unterstellten Beiträge durch versicherungsmathematische Berechnungen bestimmt. Wenn durch die versicherungsmathematischen Berechnungen keine verlässlichen Ergebnisse erbringen und nur in solchen Fällen, sind zwei weitere Ansätze möglich, um die unterstellten Arbeitgeberbeiträge zu staatlichen Altersvorsorgeeinrichtungen zu ermitteln:
Für die Darstellung der Positionen "Zusätzliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte aus Kapitalerträgen" und "Sonstiger (versicherungsmathematischer) Erwerb von Alterssicherungsansprüchen" gelten dieselben Kriterien wie bei privaten Systemen. |
|
17.140 |
Eine mit Blick auf die Sozialversicherung auf derselben versicherungsmathematischen Grundlage berechnete Position wird in Zeile 3 unter "Sonstiger (versicherungsmathematischer) Erwerb von Alterssicherungsansprüchen der Sozialversicherung" ausgewiesen. Damit erfolgt eine Abgrenzung von den unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber. |
|
17.141 |
Da die Ergänzungstabelle die Veränderung von Alterssicherungsansprüchen im Rechnungszeitraum vollständig darstellt, ist eine gesonderte Zeile für den Fall erforderlich, dass die tatsächlichen Sozialbeiträge zur Altersvorsorgeeinrichtung der Sozialversicherung nicht versicherungsmathematisch ermittelt wurden. In dieser Zeile werden die unterstellten Beiträge gebucht, für die kein Arbeitgeber verantwortlich ist. Solche unterstellten Transaktionen im Rahmen von Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung erscheinen in Zeile 3 als sonstige (versicherungsmathematische) Veränderung von Alterssicherungsansprüchen in der Sozialversicherung. Die Einträge in dieser Zeile können positiv oder negativ sein. Ein negativer Eintrag liegt dann vor, wenn der Abzinsungsfaktor größer ist als der interne Zinssatz des Systems. Der interne Zinssatz eines Alterssicherungssystems ist der Abzinsungsfaktor, der den Gegenwartswert der tatsächlich gezahlten Beiträge und den abgezinsten Wert der durch diese Beiträge erworbenen Alterssicherungsansprüche ausgleicht. Negative Einträge treten beispielsweise dann auf, wenn der Beitragssatz über den nach versicherungsmathematischen Berechnungen notwendigen Wert angehoben wird, um kurzzeitige Finanzierungsprobleme zu beheben. |
|
17.142 |
In Zeile 3 werden keine steuerfinanzierten Transfers ausgewiesen; diese würden in den Standardkonten als laufende Transfers zwischen staatlichen Einheiten gebucht, soweit sie keine Auswirkungen auf Alterssicherungsansprüche haben. In einigen Mitgliedstaaten leistet der Staat Transfers an Alterssicherungssysteme, die eine Zunahme von Alterssicherungsansprüchen bewirken; wenn zum Beispiel Transferzahlungen für bestimmte soziale Gruppen erfolgen, die keine direkten Beitragszahlungen leisten können; daher sollten diese Summen in den in dieser Zeile erscheinenden und als Differenz berechneten Wert einfließen. |
|
17.143 |
Die Unterschiede zwischen unterstelltem und tatsächlichem Lohnzuwachs, d. h. dem Teils des Lohnzuwachses, der bei der Modellierung den "Erfahrungseffekten" oder "versicherungsmathematischen Effekten" zuzurechnen ist, müssen sich in den Transaktionen, den unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber, ebenso widerspiegeln wie sämtliche andere Erfahrungseffekte. |
|
17.144 |
In Zeile 3 umfasst "Erfahrungseffekte" bei Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung, wenn das Ergebnis der Annahmen der Rentenmodellierung (Lohnzuwachsrate, Inflationsrate und Abzinsungsfaktor) in einem beliebigen Jahr von den unterstellten Werten abweicht. |
|
17.145 |
In Zeile 4 werden die im Rechnungszeitraum erbrachten Alterssicherungsleistungen ausgewiesen. Die Auszahlung von Alterssicherungsleistungen bewirkt die "Bedienung" einiger der im Anfangsbestand in Zeile 1 erfassten Alterssicherungsansprüche. |
|
17.146 |
In Zeile 5 wird die Veränderung von Alterssicherungsansprüchen aufgrund von Beiträgen und Leistungen dargestellt. Sie ergibt sich aus Zeile 2 zuzüglich Zeile 3 abzüglich Zeile 4. Dieser aus den nichtfinanziellen Konten ermittelte Saldo entspricht dem in den Finanzierungskonten ausgewiesenen Wert. |
|
17.147 |
Ein Zeichen für die veränderten Rahmenbedingungen im Alterssicherungsbereich ist die immer häufiger bestehende Möglichkeit "übertragbarer Renten", wenn bei einem Arbeitsplatzwechsel der beim früheren Arbeitgeber erworbene Anspruch auf Altersicherung zum neuen Arbeitgeber mitgenommen werden kann. In diesem Fall bleibt der Rentenanspruch des privaten Haushalts unberührt, es findet jedoch eine Transaktion zwischen den beiden Altersversorgeeinrichtungen in dem Sinne statt, dass das neue System die Verpflichtungen des alten Systems übernimmt. Zudem erfolgt eine Gegenleistung in Form der Übertragung bestimmter Vermögenswerte als Ausgleich für die übernommenen Verbindlichkeiten. |
|
17.148 |
Übernimmt der Staat durch eine explizite Transaktion die Verantwortung für die Erbringung von Alterssicherungsleistungen für Beschäftigte einer nichtstaatlichen Einheit, sind etwaige Zahlungen der nichtstaatlichen Einheit als vorausbezahlte Sozialbeiträge (F.89) zu buchen. Eingehender werden Vereinbarungen dieser Art unter 20.272 bis 20.275 erörtert. |
|
17.149 |
Wenn eine Einheit die Verantwortung für Alterssicherungsansprüche von einer anderen Einheit übernimmt, werden in Zeile 6 zwei Transaktionen gebucht. Zum einen gibt es eine Übertragung von Alterssicherungsansprüchen vom ursprünglichen zum neuen Alterssicherungssystem. Zum zweiten kann ein Transfer von Bargeld und sonstigen Forderungen als Ausgleich für die neue Altersvorsorgeeinrichtung erfolgen. Möglicherweise entspricht der Wert der übertragenen Forderungen nicht ganz dem Wert der übertragenen Alterssicherungsansprüche. In einem solchen Fall ist eine dritte Buchung als Vermögenstransfers erforderlich, um die Reinvermögensänderungen der beiden betroffenen Einheiten vollständig darzustellen. |
|
17.150 |
Arbeitgeber reformieren zunehmend die von ihnen verwalteten Altersvorsorgeeinrichtungen und reagieren damit auf demografische und sonstige Faktoren. Reformen können Änderungen der Leistungsformel, des Ruhestandsalters oder anderer Bestimmungen der Altersvorsorgeeinrichtung bedeuten. |
|
17.151 |
Nur in Kraft getretene Reformen führen zu einer Buchung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; dies betrifft die Alterssicherungsansprüche in dem Jahr, in dem die jeweilige Reform in Kraft tritt, und die anschließend zu beobachtenden Ströme. Kündigt ein Arbeitgeber lediglich an, dass er die Alterssicherung zu reformieren beabsichtigt, reicht dies für eine Berücksichtigung der Reformwirkungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht aus. |
|
17.152 |
In einigen Fällen beschließt der Arbeitgeber, die Rechte gegenwärtiger Mitglieder nicht anzutasten und wendet die neuen Regelungen nur auf den Erwerb künftiger Ansprüche an. Davon wären die aktuellen Alterssicherungsleistungen nicht unmittelbar betroffen. Entsprechend dem Konzept der erworbenen Ansprüche würden sich die Auswirkungen der Reform erst in künftigen Rentenzahlungen niederschlagen. |
|
17.153 |
Manchmal beschließt der Arbeitgeber aber auch Reformen, die einen Eingriff in die aufgelaufenen Ansprüche gegenwärtiger Mitglieder bedeuten, zum Beispiel eine allgemeine Anhebung des Renteneintrittsalters für alle Mitglieder. Reformen dieser Art führen zu Änderungen im Bestand der Alterssicherungsansprüche im Laufe des Jahres, in dem die Reformen in Kraft gesetzt werden. Dieser Effekt ist als Stromgröße zu behandeln. Er kann sehr groß sein, denn er betrifft aktuelle und künftige Alterssicherungsansprüche gleichermaßen. |
|
17.154 |
Veränderungen bei den Alterssicherungsansprüchen werden wie folgt als Transaktionen gebucht:
|
|
17.155 |
Veränderungen bei den Alterssicherungsansprüchen, die ohne Verhandlungen verfügt wurden, sind als sonstige reale Vermögensänderungen zu buchen. |
|
17.156 |
Änderungen der aufgelaufenen, in der Vergangenheit erworbenen Ansprüche werden als Vermögenstransfer gebucht. |
|
17.157 |
Die Zeile 7 zeigt die Auswirkung von Strukturreformen bei Altersvorsorgeeinrichtungen auf die bisher erworbenen Ansprüche. |
Veränderungen von Alterssicherungsansprüchen aufgrund sonstiger Ströme
|
17.158 |
In den Zeilen 8 und 9 werden die sonstigen Ströme in Form von Umbewertungen und sonstige reale Vermögensänderungen im Zusammenhang mit Altersvorsorgeeinrichtungen im Sozialschutz ausgewiesen. Aus Tabelle 17.7 sind die sonstigen Ströme, untergliedert in Umbewertungen und sonstige reale Vermögensänderungen, ersichtlich. |
|
17.159 |
Umbewertungen ergeben sich aus Änderungen bei den wesentlichen Modellannahmen in den versicherungsmathematischen Berechnungen. Diese Grundannahmen sind Abzinsungsfaktor, Höhe der Löhne und Gehälter sowie Inflationsrate. Erfahrungseffekte kommen hier nicht zum Tragen, es sei denn, sie lassen sich nicht separat feststellen. Sonstige Änderungen in versicherungsmathematischen Schätzungen dürften eher als sonstige reale Vermögensänderungen gebucht werden. Die Effekte von Preisänderungen aus der Anlage von Alterssicherungsansprüchen werden als Umbewertungen im Umbewertungskonto gebucht. |
|
17.160 |
Die Buchung von Veränderungen bei den demografischen Annahmen, die für versicherungsmathematische Berechnungen herangezogen werden, erfolgt im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen. Tabelle 17.7 — Sonstige Ströme in Form von Umbewertungen und sonstigen realen Vermögensänderungen Umbewertungen Veränderungen des angenommenen Abzinsungsfaktors Veränderungen der angenommenen Lohnentwicklung Veränderungen der angenommenen Preisentwicklung Sonstige reale Vermögensänderungen Veränderungen bei demografischen Annahmen Sonstige Änderungen |
Verwandte Indikatoren
|
17.161 |
Von Altersvorsorgeeinrichtungen erbrachte Finanzdienstleistungen werden als von den Mitgliedern des Systems bezahlt gebucht; die Kosten eines Alterssicherungssystems werden somit nicht als Vorleistung des Arbeitgebers ausgewiesen, der das System betreibt. Im Schaubild 17.1 werden demzufolge Finanzdienstleistungen und Sozialbeiträge separat dargestellt. Die Ausweisung von Finanzdienstleistungen in dieser Form bedeutet, dass die Beiträge, die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern erhalten haben, genauso hoch sind wie der Beitragsanteil, den die Arbeitnehmer in die Altersvorsorgeeinrichtung einzahlen. Zudem muss nicht ausgewiesen werden, aus welchem Teil der Sozialbeiträge das Dienstleistungsentgelt finanziert wird. Im Falle eines Systems mit Beitragszusage wird zur Finanzierung des Dienstleistungsentgelts der zusätzliche Beitrag der privaten Haushalte und bei einem System mit Leistungszusage entweder der Arbeitgeberbeitrag oder der Beitrag der privaten Haushalte herangezogen. Da für alle Altersvorsorgeeinrichtungen ein Produktionswert gebucht wird, ist aus Zeile 11 der Produktionswert für alle Systeme ersichtlich. Schaubild 17.1 — Alterssicherungsansprüche und ihre Veränderung
Dieses Schaubild ist rein illustrativ; die Größe der einzelnen Felder und Kästen ist ohne Belang. |
Versicherungsmathematische Annahmen
Erworbene Ansprüche
|
17.162 |
Alterssicherungsansprüche werden in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Bruttovermögen ausgewiesen. Es werden keine Vermögenswerte oder angesammelten Sozialbeiträge zur Berechnung etwaiger Nettoansprüche herangezogen. Es werden nur die auf aktuelle und künftige Alterssicherungsleistungen bezogenen Ansprüche erfasst. |
|
17.163 |
Das Konzept der erworbenen Ansprüche ist für die Zwecke der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen geeignet. Es schließt den Gegenwartswert von Alterssicherungsansprüchen ein, der sich aus bereits erworbenen Rechten ergibt. So deckt es die erworbenen Alterssicherungsansprüche gegenwärtig beschäftigter Arbeitnehmer (einschließlich aufgeschobener Alterssicherungsansprüche) und die verbleibenden Alterssicherungsansprüche von Rentenbeziehern ab. |
|
17.164 |
Ebenso wie alle Daten in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden die Angaben ex post ermittelt, denn sie beinhalten nur den Gegenwartswert der Ansprüche, die sich aus zum Bilanzstichtag bestehenden Rentenansprüchen ergeben. Die Berechnung basiert auf beobachtbaren Ereignissen und Transaktionen der Vergangenheit wie Mitgliedschaft in der Altersvorsorgeeinrichtung und geleisteten Beitragszahlungen. Allerdings fließen auch eine Reihe von Annahmen in den Modellierungsprozess ein. Es müssen Schätzungen der Wahrscheinlichkeit vorgenommen werden, wie viele gegenwärtige Beitragszahler vor Erreichen der Altersgrenze sterben oder erwerbsunfähig werden. Eingeschlossen sind zudem künftige Veränderungen des Zahlungsstroms, die durch das Inkrafttreten von Rechtsvorschriften vor dem Jahr bedingt sind, für das die Alterssicherungsansprüche berechnet werden. Schließlich bedarf es einiger wichtiger Annahmen zu künftigen Entwicklungen, vor allem im Hinblick auf den Abzinsungsfaktor für künftige Alterssicherungszahlungen. |
Abzinsungsfaktor
|
17.165 |
Der bei Schätzungen künftiger Alterssicherungsleistungen im Falle erworbener Ansprüche zugrunde gelegte Abzinsungsfaktor stellt eine der wichtigsten Annahmen bei der Modellierung von Altersvorsorgeeinrichtungen dar, da seine über Jahrzehnte reichende Wirkung sehr groß sein kann. Der Abzinsungsfaktor kann sich im Laufe der Zeit ändern; dies führt zu Umbewertungen in den Konten. |
|
17.166 |
Der Abzinsungsfaktor kann als Entsprechung der erwarteten risikolosen Kapitalverzinsung eines Alterssicherungssystems angesehen werden. Im Falle künftig zu erbringender Alterssicherungsleistungen kann der Abzinsungsfaktor aber auch mit den Kapitalkosten in dem Sinne gleichgesetzt werden, dass künftige Zahlungen vom Staat aus den üblichen Quellen finanziert werden müssen:
Aus diesen Finanzierungskosten kann ein Abzinsungsfaktor hergeleitet werden. |
|
17.167 |
Der Abzinsungsfaktor sollte einer risikolosen Rendite entsprechen. Die folgenden Ausführungen stellen einige Kriterien für einen angemessenen Abzinsungsfaktor vor. Der Abzinsungsfaktor für erstrangige Staats- oder Unternehmensanleihen, die z. B. mit einen "AAA"-Rating versehen sind, stellen eine adäquate Referenz dar. Renditen erstrangiger festverzinslicher Unternehmensanleihen werden nur bei breiten Märkten verwendet. Die Restlaufzeiten der Schuldverschreibungen sollten den Restlaufzeiten der Alterssicherungsansprüche entsprechen. Es wird empfohlen, einen Abzinsungsfaktor zu verwenden, der sich an langen Laufzeiten, das heißt an Laufzeiten von 10 Jahren oder mehr, orientiert. Zur Glättung der Zeitreihe kann ein Mehrjahresdurchschnitt des Abzinsungsfaktors verwendet werden, gekoppelt an die Länge des Konjunktur- und Wirtschaftszyklus. Die Annahmen zum Abzinsungsfaktor und zur künftigen Lohnentwicklung sollten konsistent bestimmt werden. Die Mitgliedsstaaten sind gehalten, die Überlegungen, die im Lichte der oben angesprochenen Kriterien zur Bestimmung des Abzinsungsfaktors herangezogen wurden, darzulegen. |
|
17.168 |
Für sämtliche Alterssicherungssysteme, bei denen der Staat – gleich auf welcher Ebene – als Träger fungiert (einschließlich Sozialversicherung), muss derselbe Abzinsungsfaktor angewendet werden, da das Resultat einer risikolosen Rendite entsprechen sollte. |
Zunahme von Löhnen und Gehältern
|
17.169 |
Bei Altersvorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusage kann zur Ermittlung der Rentenhöhe eine Formel genutzt werden, die sich auf das Einkommen der Mitglieder, sei es das zuletzt erzielte Entgelt, das Durchschnittseinkommen einiger Jahre oder das Lebenseinkommen, bezieht. Die durchschnittlichen Lohnsteigerungen bei den Versicherten, vor allem durch Beförderung und beruflichen Aufstieg, wirken sich auf die Höhe der Altersbezüge aus. |
|
17.170 |
Es ist daher wichtig, über Annahmen zur künftigen Entwicklung der Löhne und Gehälter nachzudenken. Die unterstellte langfristige Einkommensentwicklung sollte mit dem ermittelten Abzinsungsfaktor im Einklang stehen. Auf lange Sicht sind beide Variablen untrennbar aneinander gekoppelt. |
|
17.171 |
Aktuare stützen sich bei der Messung des Einflusses von Lohnsteigerungen auf zwei versicherungsmathematische Ansätze. Im Falle des Teilwertverfahrens (accrued benefit obligation – ABO) werden nur die bislang tatsächlich aufgelaufenen Leistungen erfasst. Dabei handelt es sich um den Betrag, der dem Arbeitnehmer zustünde, wenn er morgen aus dem Unternehmen ausschiede. Anhand dieser Kennziffer kann zum Beispiel der Vermögenswert im Falle eines Versorgungsausgleichs ermittelt werden. |
|
17.172 |
Die Kennziffer der erdienten Ansprüche nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (projected benefit obligation – PBO) ist ein vorsichtigeres Maß zur Bestimmung der voraussichtlichen Höhe des Anspruchs. Im Falle einer Einzelperson bezieht sich diese Kennziffer auf Annahmen darüber, wie oft der/die Betreffende künftig voraussichtlich befördert wird; entsprechend wird sein/ihr letztes Einkommen geschätzt. Wenn die Person statt der erwarteten 40 Jahre nur 20 Jahre gearbeitet hat, wird das letzte Einkommen halbiert und der Alterssicherungsanspruch so berechnet, als sei dies das gegenwärtige Einkommen. Steigt der erdiente Anspruch (ABO) stufenweise mit jeder Beförderung, so wächst auch der PBO–Wert im Laufe der Zeit kontinuierlich. Bis zum Eintritt in den Ruhestand ist bei Einzelpersonen die Kennziffer PBO stets höher als der ABO–Wert, danach gleichen sich ABO und PBO an. |
|
17.173 |
Der Einfluss von Lohnsteigerungen muss sich in den Transaktionen widerspiegeln, denn eine Gehaltserhöhung ist eine zielgerichtete ökonomische Entscheidung des Arbeitgebers. Zudem führen ABO- wie PBO-Ansatz langfristig zur Buchung derselben Transaktionen, wenn auch, bedingt durch die demografische Struktur des Systems, zu verschiedenen Zeitpunkten. |
|
17.174 |
Änderungen bei den Annahmen in Bezug auf die künftige Einkommensentwicklung, die im Allgemeinen alle paar Jahre im Zuge einer allgemeinen Überprüfung von Annahmen des versicherungsmathematischen Modells oder aufgrund erheblicher Veränderungen in der Struktur der Erwerbsbevölkerung vorgenommen werden, werden als sonstige Ströme (Umbewertungen) gebucht. |
|
17.175 |
Aus der Praxis ist die Anwendung verschiedener Varianten der ABO– und PBO–Methoden bekannt, wobei die unterschiedliche Behandlung von Preis- und Einkommensentwicklung eine entscheidende Rolle spielt. |
|
17.176 |
Ein wichtiger Faktor ist die Behandlung von Rentenanpassungen, wenn die zu zahlende Rente entsprechend der allgemeinen Einkommensentwicklung steigt. |
|
17.177 |
Angesichts der Bedeutung von Einkommensentwicklung ist es ratsam, sich bei der Entscheidung für einen ABO- oder PBO-Ansatz an der zugrunde liegenden Leistungsformel der Altersvorsorgeeinrichtung zu orientieren. Beinhaltet diese Formel implizit oder explizit einen Faktor für Einkommenssteigerungen (vor oder nach Eintritt in den Ruhestand), kommt die PBO-Methode zum Ansatz. Anderenfalls kommt die ABO-Methode zur Anwendung. |
Demografische Annahmen
|
17.178 |
Künftige Alterssicherungszahlungen unterliegen demografischen Effekten wie dem Alter, der Geschlechterverteilung und der Lebenserwartung der Mitglieder. Sterbetafeln sind ein gängiges Hilfsmittel bei der Modellierung von Alterssicherungs- und Lebensversicherungssystemen. |
|
17.179 |
Bei betrieblichen Altersvorsorgeeinrichtungen ist die Mitgliedschaft eindeutig definiert; daher sollten entsprechende Zahlen vorliegen. Im Falle der Sozialversicherungssysteme wird auf allgemeine Bevölkerungsdaten zurückgegriffen, wenn keine spezifischen Angaben zu den Mitgliedern zur Verfügung stehen. |
|
17.180 |
Bei der Verwendung von Sterbetafeln sind Tabellen mit getrennten Angaben nach Geschlecht und Arbeitnehmergruppen vorzuziehen. Bei Versicherten, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, sollte sich die Modellierung für diese Gruppe möglichst auf eine entsprechende Sterbetafel stützen. |
|
17.181 |
Annahmen über die Lebenserwartung sollten eine Erhöhung der Lebenserwartungen im Zeitablauf vorsehen. |
|
17.182 |
In die Modellierung von Altersvorsorgeeinrichtungen können neben der Lebenserwartung weitere demografische Annahmen einfließen, beispielsweise künftige Fertilitätsraten, Erwerbsbeteiligungsquoten oder Zuwanderungsquoten, wenn die Alterssicherungsleistung oder die Anpassungsformel auf einem „Nachhaltigkeitsfaktor“ oder einem vergleichbaren Konzept beruht. |
|
17.183 |
Ist die Frühverrentung in einem System versicherungsmathematisch neutral ausgestaltet, hat sie keine Auswirkungen auf die Ergebnisse. Frühverrentungen ohne versicherungsmathematische kalkulierte Abschläge haben hingegen einen Einfluss; und sie sind nicht selten, da bei der Frühverrentung in der Regel unterschiedliche Zinssätze angewandt werden. Daher kommt einer der Modellierung des Frühverrentungsverhaltens, besonders bei einer reformbedingten Anhebung des künftigen Rentenalters, eine besondere Bedeutung zu. |
(1) Die sonstigen Systemen ohne Beitragszusagen, die oft als Hybridsysteme bezeichnet werden, umfassen die Elemente Leistungszusage und Beitragszusage.
(2) Vom Staat für seine gegenwärtig und früher Beschäftigten organisierte Systeme.
(3) Es gibt rechtlich unselbständige Systeme mit Leistungszusagen, bei denen die Alterssicherungsansprüche in den Hauptkonten gebucht werden.
(4) Angaben zu Ansprüchen gebietsfremder Haushalte werden nur dann gesondert ausgewiesen, wenn die Beziehungen zur übrigen Welt im Alterssicherungsbereich ein erhebliches Ausmaß haben.
(5) Diese zusätzlichen Beträge stellen die Rendite auf die Forderungen der Mitglieder gegenüber Altersvorsorgeeinrichtungen dar, und zwar sowohl in Form von Kapitalerträgen aus dem Vermögen von Systemen mit Beitragszusagen als auch in Form der Senkung des Abzinsungsfaktors bei Systemen mit Leistungszusagen.
(6) Eine detailliertere Aufschlüsselung dieser Positionen muss für die in den Spalten G und H abgebildeten Systeme mithilfe der durchgeführten Modellrechnungen erfolgen. Die schwarz hinterlegten Felder █ entfallen; die grau hinterlegten Felder ▒ enthalten von den Hauptkonten abweichende Angaben.
(7) Solche zusätzlichen Sozialbeiträge stellen die Rendite auf die Forderungen der Mitglieder gegenüber Altersvorsorgeeinrichtungen dar, und zwar sowohl in Form von Kapitalerträgen aus dem Vermögen von Systemen mit Beitragszusagen als auch in Form der Senkung des Abzinsungsfaktors bei Systemen mit Leistungszusagen.
(8) Eine detailliertere Aufschlüsselung solcher Positionen muss für die Spalten G und H auf der Grundlage der für diese Systeme durchgeführten Modellrechnungen erfolgen (siehe Abschnitte 17.158 bis 17.160).
KAPITEL 18
AUSSENKONTO ÜBRIGE WELT
EINLEITUNG
|
18.01 |
Die Konten der gebietsansässigen institutionellen Sektoren bilden im ESVG die gesamtwirtschaftliche Tätigkeit ab: Erwirtschaftung, Verteilung und Umverteilung von Einkommen sowie Vermögensänderungen. Diese Konten erfassen Transaktionen zwischen gebietsansässigen Einheiten sowie Transaktionen von gebietsansässigen mit gebietsfremden Einheiten, d. h. mit der übrigen Welt. |
|
18.02 |
Das ESVG ist ein geschlossenes System. Jede Transaktion wird sowohl aufkommensseitig als auch verwendungsseitig gebucht. Für gebietsansässige Einheiten ist so eine vollständige Rechnungsführung möglich. Das Kontensystem umfasst alle wirtschaftlichen Tätigkeiten jeder institutionellen Einheit. Dies gilt nicht für gebietsfremde Einheiten. Diese werden nur durch ihre Wechselbeziehungen mit gebietsansässigen Einheiten der betrachteten Volkswirtschaft abgebildet. Dazu wird ein Sektor namens "Übrige Welt" mit einem speziellen Kontensystem für gebietsfremde Einheiten eingerichtet. Die Buchungen sind auf die Transaktionen beschränkt, die mit gebietsansässigen Einheiten erfolgen. |
|
18.03 |
Die Kontenabfolge für die übrige Welt sieht wie folgt aus:
Die komplette Kontenabfolge ist in Kapitel 8 dargestellt. Die in Klammern nachgesetzten Ziffern verweisen auf die dortigen Darstellungen. |
|
18.04 |
Die Konten sind aus der Sicht der übrigen Welt angelegt, daher werden im Außenkonto der Gütertransaktionen die Importe in die Volkswirtschaft als Aufkommen und die Exporte aus der Volkswirtschaft als Verwendung ausgewiesen. Diese Umkehrung gilt entsprechend für alle Konten der übrigen Welt. Ein positiver Saldo bedeutet einen Überschuss für die übrige Welt und ein Defizit für die inländische Gesamtwirtschaft. Entsprechend bedeutet ein negativer Saldo ein Defizit für die übrige Welt und einen Überschuss für die Volkswirtschaft. Eine Forderung der übrigen Welt ist eine Verbindlichkeit der inländischen Volkswirtschaft und eine Verbindlichkeit der übrigen Welt somit eine Forderung für die inländische Volkswirtschaft. |
|
18.05 |
Der Standardrahmen für Statistiken zu den Transaktionen und Positionen zwischen einer Volkswirtschaft und der übrigen Welt ist im Zahlungsbilanzhandbuch BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual 2008 — sechste Auflage) (1) dargelegt. BPM6 ist mit dem System of National Accounts (SNA) 2008 harmonisiert, bildet aber die Wechselwirkungen zwischen der inländischen Volkswirtschaft und der übrigen Welt in einem Konten- und Bilanzsystem mit abweichender Darstellung ab. Das vorliegende Kapitel beschreibt die Konten des Sektors übrige Welt gemäß dem ESVG 2010 und die Beziehungen zu den internationalen Konten des Zahlungsbilanzhandbuchs BPM6. |
WIRTSCHAFTSGEBIET
|
18.06 |
Unter Wirtschaftsgebiet wird gemeinhin das Territorium verstanden, über das ein Einzelstaat die effektive wirtschaftliche Kontrolle hat. Mitunter werden aber auch zusammengeschlossene Währungs- und Wirtschaftsräume, Regionen oder die ganze Welt als ein Wirtschaftsgebiet betrachtet, da sie Gegenstand gesamtwirtschaftlicher Politik oder Untersuchungen sein können. Die komplette Definition findet sich in Kapitel 2 (2.04 bis 2.06). |
|
18.07 |
Um im Einzelfall festzustellen, ob eine Gebietsansässigkeit vorliegt, ist zu ermitteln:
|
Gebietsansässigkeit
|
18.08 |
Jede institutionelle Einheit ist in dem Wirtschaftsgebiet ansässig, zu dem sie die engsten Verbindungen hat, d. h. in dem Wirtschaftsgebiet, das den Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Hauptinteresses bildet. ESVG, SNA 2008 und BPM6 verwenden identische Begrifflichkeiten. Die Einführung der Terminologie „Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses“ bedeutet nicht, dass Einheiten mit erheblicher Betriebstätigkeit in zwei oder mehreren Wirtschaftsgebieten nun nicht mehr aufgespalten werden müssen (siehe 18.12) oder dass institutionelle Einheiten ohne wesentliche physische Präsenz außer Acht gelassen werden können (siehe 8.10 und 18.15). Das Konzept der Gebietsansässigkeit im Allgemeinen und für Haushalte, Firmen und andere Einheiten im Besonderen, ist in Kapitel 2 umfassend beschrieben. |
INSTITUTIONELLE EINHEITEN
|
18.09 |
Der Begriff der „institutionellen Einheit“ ist im ESVG, SNA 2008 und BPM6 identisch definiert. Die allgemeine Definition findet sich in Kapitel 2, 2.12 bis 2.16. Da das Hauptaugenmerk auf der Volkswirtschaft liegt, werden grenzüberschreitende Situationen besonderes behandelt. In bestimmten Fällen werden mehrere juristische Personen zu einer einzigen institutionellen Einheit zusammengefasst, wenn sie in der gleichen Volkswirtschaft ansässig sind, aber nicht, wenn sie in unterschiedlichen Volkswirtschaften ansässig sind. Analog kann eine juristische Person aufgespalten werden, wenn sie umfangreiche Tätigkeiten in zwei oder mehr Volkswirtschaften ausübt. Diese Buchungsweise nach territorialer Zugehörigkeit stärkt den Grundsatz des Wirtschaftsgebiets. |
|
18.10 |
Kapitalgesellschaften und Staaten nutzen Zweckgesellschaften normalerweise für die Mittelbeschaffung. Soweit Zweckgesellschaft und Muttergesellschaft in derselben Volkswirtschaft ansässig sind, werden sie nicht unterschiedlich behandelt. Normalerweise gibt die Zweckgesellschaft keinen Anlass für eine Behandlung als separate Einheit und ihre Aktiva und Passiva werden in den Konten der Muttergesellschaft ausgewiesen. Wenn die Zweckgesellschaft jedoch nicht gebietsansässig ist, verlangen die Kriterien der Gebietsansässigkeit für den Sektor übrige Welt die separate Buchung. In diesem Fall erscheinen die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Zweckgesellschaft im Sektor übrige Welt und nicht in einem Sektor der Volkswirtschaft. Die Behandlung von gebietsfremden Zweckgesellschaften im Besitz des Staates ist unter 2.14 definiert. |
|
18.11 |
Alle Mitglieder eines privaten Haushalts sind in derselben Volkswirtschaft gebietsansässig. Eine Person, die getrennt von den übrigen Mitgliedern des privaten Haushalts in einer anderen Volkswirtschaft ansässig ist, gilt nicht als Mitglied dieses privaten Haushalts, auch dann nicht, wenn Einnahmen und Ausgaben zusammenfließen oder ein gemeinsames Vermögen vorliegt. |
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN ALS IN DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ VERWENDETER BEGRIFF
|
18.12 |
Eine Zweigniederlassung (ZNL) ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das zu einer gebietsfremden Einheit gehört, die als Muttergesellschaft bezeichnet wird. Eine ZNL wird als gebietsansässige Quasi-Kapitalgesellschaft für das Territorium behandelt, in dem sie sich befindet. Eine ZNL kann nur dann als separate institutionelle Einheit ausgewiesen werden, wenn sich eine erhebliche Betriebstätigkeit vom Rest der juristischen Person abtrennen lässt. Eine ZNL liegt in folgenden Fällen vor:
Hinzu kommen meist noch einer oder mehrere der folgenden Faktoren:
|
|
18.13 |
Die Identifizierung von Zweigniederlassungen wirkt sich auf die statistische Berichterstattung von Muttergesellschaft und ZNL aus. Die Betriebstätigkeit der ZNL ist aus der institutionellen Einheit des Hauptsitz es herauszunehmen. Die Abgrenzung von Mutter und ZNL muss konsequent in beiden betroffenen Volkswirtschaften vorgenommen werden. Eine ZNL kann bei Bauprojekten oder bei mobilen Betriebstätigkeiten wie Transport, Fischerei oder Beratungstätigkeit identifiziert werden. Ist der Umfang der Betriebstätigkeiten zu gering für eine ZNL, wird die Tätigkeit als Waren- oder Dienstleistungsexport des Hauptsitzes verbucht. |
|
18.14 |
Eine Betriebstätigkeit, die sich auf eine künftige Direktinvestition mit geplanter Firmierung bezieht, ist in bestimmten Fällen ein ausreichender Nachweis der Gründung einer gebietsansässigen Quasi-Kapitalgesellschaft. Beispielsweise werden projektbezogene Lizenz- und Rechtsschutzkosten auf eine Quasi-Kapitalgesellschaft gebucht und sind Teil der direkten Investitionsströme, die in diese Einheit fließen. Sie sind keine Verkäufe von Lizenzrechten an gebietsfremde Einheiten sowie auch keine Dienstleistungsexporte an den Hauptsitz. |
FIKTIVE GEBIETSANSÄSSIGE EINHEITEN
|
18.15 |
Befinden sich auf einem Territorium Grundstücke im Eigentum einer gebietsfremden Einheit, wird für statistische Zwecke eine fiktive gebietsansässige Einheit als Eigentümerin eingerichtet. Diese fiktive gebietsansässige Einheit ist eine Quasi-Kapitalgesellschaft. Das gleiche Vorgehen findet auch Anwendung bei damit verbundenen Gebäuden, Bauwerken und Werterhöhungsmaßnahmen sowie bei langfristigen Verpachtungen und bei Eigentum an anderen Naturressourcen. Die gebietsfremde Einheit ist nicht die unmittelbare Eigentümerin des betreffenden Grundstücks, sondern Eigentümerin der fiktiven gebietsansässigen Einheit. Damit besteht eine Kapitalverbindlichkeit gegenüber der gebietsfremden Einheit, während das Grundstück bzw. die sonstige natürliche Ressource im Vermögen der Volkswirtschaft verbleibt, in der sie sich befindet. Die fiktive gebietsansässige Einheit erbringt üblicherweise Dienstleistungen für ihre Eigentümerin. Beispielsweise stellt sie, im Falle von Ferienhäusern, Unterkünfte bereit. |
|
18.16 |
Wenn eine gebietsfremde Einheit ein unbewegliches Vermögensgut, beispielsweise ein Gebäude, langfristig pachtet oder anmietet, ist das gemeinhin mit der Aufnahme einer Produktionstätigkeit in dem Gebiet verbunden, in dem sich die Immobilie befindet. Sollte aus irgendeinem Grund die Produktionstätigkeit nicht zustande kommen, so wird für das zugrunde liegende Miet- oder Pachtverhältnis ebenfalls eine fiktive gebietsansässige Einheit eingerichtet. Deshalb wird die gebietsfremde Einheit als Eigentümerin der gebietsansässigen Einheit und nicht als Eigentümerin der Immobilie behandelt. Das Gebäude bleibt im Vermögen der entsprechenden Volkswirtschaft. |
GEBIETSÜBERGREIFENDE UNTERNEHMEN
|
18.17 |
Es gibt einige Unternehmen mit einer Geschäftstätigkeit, die sich nahtlos über mehr als nur ein Wirtschaftsgebiet erstreckt; hierbei handelt es sich typischerweise um grenzüberschreitende Tätigkeiten wie bei Fluggesellschaften, Schifffahrtslinien, um Wasserkraftwerke an Grenzflüssen, Pipelines, Kreuzungsbauwerke wie Brücken und Tunnel sowie Tiefseekabel. Nach Möglichkeit sollten hier separate Zweigniederlassungen abgegrenzt werden, es sei denn, die Einheit wird als ein einheitlicher Betrieb ohne separate Konten oder Entscheidungsprozesse für die einzelnen Wirtschaftsgebiete geführt. Da der Schwerpunkt auf national-volkswirtschaftliche Daten gelegt wird, muss in solchen Fällen die Betriebstätigkeit auf die betreffenden Volkswirtschaften aufgeteilt werden. Dies erfolgt anteilig zum Umfang der Betriebstätigkeit auf dem jeweiligen Territorium, ausgehend von unternehmensspezifischen Indikatoren. Die anteilige Buchung kann auch angewendet werden, wenn Unternehmen in Zonen tätig sind, die von zwei oder mehr Staaten verwaltet werden. |
GEOGRAFISCHE AUFSCHLÜSSELUNG
|
18.18 |
Für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Europäischen Union ist der Sektor übrige Welt (S.2) folgendermaßen aufgeteilt:
|
|
18.19 |
Für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Euro-Währungsgebiets können die obigen Teilsektoren wie folgt gruppiert werden:
Die europäischen Aggregate sind in Kapitel 19 beschrieben. |
DIE INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ
|
18.20 |
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen weichen von den internationalen Konten des Zahlungsbilanzhandbuchs BPM6 ab. Die internationalen Konten zeigen die Transaktionen zwischen einer Volkswirtschaft und dem Ausland aus der Sicht der Binnenwirtschaft. Somit werden Importe als Verwendung (Soll) und Exporte als Aufkommen (Haben) ausgewiesen. Tabelle 18.1 ist eine summarische Übersicht der internationalen Konten gemäß BPM6. |
|
18.21 |
Ein zweiter wesentlicher Unterschied besteht darin, dass in den internationalen Konten der Zahlungsbilanz funktionale Kategorien verwendet werden, während in den Sektorkonten der übrigen Welt des ESVG eher Instrumente für die Klassifizierung von finanziellen Transaktionen verwendet werden. Dieser Punkt wird unter 18.57 und 18.58 näher erörtert. |
SALDEN IN DEN KONTEN DER LAUFENDEN TRANSAKTIONEN DES INTERNATIONALEN KONTENSYSTEMS
|
18.22 |
Die Kontensalden in der Zahlungsbilanz sind etwas anders strukturiert als in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. In der Zahlungsbilanz hat jedes Konto seinen eigenen Saldo und einen zweiten Saldo als Bindeglied zum nächsten Konto. Zur Illustration: Das Primäreinkommenskonto hat seinen eigenen Saldo (Saldo Primäreinkommen) und einen kumulativen Saldo (Saldo Waren, Dienstleistungen und Primäreinkommen). Der Außensaldo Primäreinkommen entspricht dem Saldo der primären Einkommen und geht in das Bruttonationaleinkommen (BNE) ein. Der Außensaldo laufender Transaktionen entspricht dem Sparen der übrigen Welt im Verhältnis zur Binnenwirtschaft. Die Salden in der Kontostruktur des BPM6 sind in Tabelle 18.1 dargestellt. Tabelle 18.1 — Die internationalen Stromgrößenkonten der Zahlungsbilanz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE KONTEN FÜR DEN SEKTOR ÜBRIGE WELT UND IHRE BEZIEHUNG ZU DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ
Außenkonto der Gütertransaktionen
|
18.23 |
Das Außenkonto der Gütertransaktionen besteht ausschließlich aus Importen und Exporten von Waren und Dienstleistungen, da nur hier eine grenzüberschreitende Dimension vorliegt. Gütertransaktionen werden dann gebucht, wenn das wirtschaftliche Eigentum von einer Einheit der einen Volkswirtschaft an eine Einheit einer anderen Volkswirtschaft übergeht. Dabei muss nicht in jedem Fall von Eigentumswechsel ein physischer Warenverkehr stattfinden. So kann es beim Transithandel vorkommen, dass die Waren zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs nicht bewegt werden, sondern ihren Ort erst verändern, wenn sie an Dritte verkauft werden. Die Tabellen 18.2 und 18.3 illustrieren die unterschiedliche Buchung von Primär- und Sekundäreinkommen in ESVG und BPM6. Tabelle 18.2 — Außenkonto der Gütertransaktionen (ESVG V.1)
Tabelle 18.3 — Waren- und Dienstleistungskonto des BPM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.24 |
Die Importe und Exporte enthalten keine Waren, die von einer Volkswirtschaft in eine andere Volkswirtschaft bewegt werden, ohne dass sich das wirtschaftliche Eigentum an ihnen ändert. Werden also Waren zur Veredlung ins Ausland versendet und kommen danach wieder zurück, so gilt dies nicht als Import und Export. Nur das für die Veredlung vereinbarte Entgelt wird als Dienstleistung gebucht. |
|
18.25 |
In der Zahlungsbilanz wird stark nach Waren und Dienstleistungen unterschieden. Dieser Ansatz spiegelt politische Interessen wider, da Waren und Dienstleistungen durch separate internationale Übereinkommen geregelt sind. Ein weiterer Grund für diese Unterscheidung ist die Informationsquelle: Die Daten für Waren stammen gewöhnlich aus Zollquellen, während die Daten über Dienstleistungen aus Zahlungsvorgängen oder Erhebungen stammen. |
|
18.26 |
Die internationale Warenhandelsstatistik ist die Hauptquelle der Daten für Güter und Waren. Die entsprechenden internationalen Standards sind im von den Vereinten Nationen herausgegebenen Handbuch International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions Rev. 2 (2) (IMTS) vorgegeben. Im BPM6 werden mögliche Ursachen für abweichende Warenwerte in Handelsstatistik und Zahlungsbilanz aufgezeigt. Ferner wird eine standardisierte Abgleichtabelle empfohlen, die Anwender dabei unterstützt, solche Unterschiede zu verstehen. Eine Hauptursache für Abweichungen ist der Umstand, dass Importe in der internationalen Handelsstatistik auf cif-Basis (Kosten, Versicherung und Fracht) bewertet werden, während in der Zahlungsbilanz für Importe und Exporte einheitlich nach fob (frei an Bord, also Wert an der Zollgrenze der ausführenden Volkswirtschaft) bewertet wird. Deshalb müssen Fracht- und Versicherungskosten, die zwischen der Zollgrenze des Exportlandes und der Zollgrenze des Importlandes anfallen, herausgerechnet werden. Durch Abweichungen zwischen fob-Bewertung und tatsächlicher Vertragsgestaltung müssen bestimmte Fracht- und Versicherungskosten umgeleitet werden. Die Bewertungsgrundsätze in Zahlungsbilanz und ESVG sind identisch. Für die Buchung von Exporten und Importen von Waren ist deshalb der fob-Ansatz zu wählen (siehe 18.32). |
|
18.27 |
Der Grundsatz des Eigentumswechsels in der Zahlungsbilanz bedeutet, dass der Abrechnungszeitpunkt der Waren mit den entsprechenden Finanzströmen übereinstimmt. Im BPM6 gibt es in Bezug auf den Grundsatz des Eigentumswechsels keine Ausnahmen mehr. Im Gegensatz dazu folgt die IMTS dem zeitlichen Ablauf der Zollabfertigung. Der Zeitpunkt ist hier oft eine hinreichende Schätzung, aber in bestimmten Fällen, wie bei Konsignationsware, können Korrekturen erforderlich werden. Die IMTS verzeichnet den Wert von Waren, die zur Veredlung ins Ausland geschickt werden und bei denen kein Eigentumsübergang erfolgt. Anders in der Zahlungsbilanz, wo der Eigentumswechsel ausschlaggebend ist. Dort erscheinen nur die Entgelte für "Fertigungsleistungen an physisch vorgelegten Fremdprodukten"; dabei werden die Werte der Warenbewegungen jedoch als hilfreiche Ergänzungsdaten empfohlen, da sie die genaue Ausgestaltung solcher Veredelungsvereinbarungen erhellen. Wie diese Veredlungsvereinbarungen zu buchen sind, wird an späterer Stelle im Kapitel noch näher erörtert. Die IMTS muss mitunter noch weiter angepasst werden, damit die dortigen Schätzungen mit dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums entweder allgemein oder länderspezifisch übereinstimmen. Beispiele sind Transithandel, Nichtwährungsgold, illegale Ein- und Ausfuhren sowie Warenbeschaffungen von Spediteuren in Häfen. |
|
18.28 |
Wiederausfuhren betreffen ausländische Waren (d. h. in einer anderen Volkswirtschaft produzierte Waren, die zuvor mit Wechsel des wirtschaftlichen Eigentums importiert wurden), die ohne erhebliche Veränderung oder Bearbeitung aus dem Staat ausgeführt werden, der diese zuvor eingeführt hatte. Da rückexportierte Waren nicht in der betrachteten Volkswirtschaft produziert werden, sind sie mit dieser nicht so eng verbunden wie andere Exporte. Volkswirtschaften, die ein großer Umschlagplatz und Großhandelsstandort sind, verzeichnen oft erhebliche Rückexporte. Rückexporte erhöhen die Zahlen für Importe und Exporte gleichermaßen. Bei umfangreichen Rückexporten wirkt sich das auch erheblich auf die Import/Export-Anteile an den wirtschaftlichen Gesamtgrößen aus. Deshalb ist es ratsam, die Rückexporte getrennt auszuweisen. Importierte Waren werden bis zu ihrem Rückexport in den Vorräten des gebietsansässigen wirtschaftlichen Eigentümers geführt. Ein Warentransit liegt vor, wenn Waren auf ihrem Weg zum Empfänger ein Land durchqueren und in der Außenhandelsstatistik, Zahlungsbilanz und volkswirtschaftlichen Rechnung des durchquerten Landes generell nicht erscheinen. Beim Quasi-Warentransit werden Waren in ein Land importiert, vom Zoll für den freien Warenverkehr in der EU freigegeben und anschließend an ein Drittland in der EU versendet. Die für die Zollabfertigung verwendete Einheit ist gewöhnlich keine institutionelle Einheit laut Definition in Kapitel 2 und erwirbt somit nicht das Eigentum an den Waren. Hier wird der Import in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als Direktimport zum Endbestimmungsort ausgewiesen, wie im Falle des einfachen Warentransits, und zwar mit dem Wert der Waren bei Eintritt in das Endbestimmungsland. |
|
18.29 |
In der Zahlungsbilanz werden Waren auf einer aggregierten Ebene dargestellt. Detailliertere Aufschlüsselungen lassen sich den IMTS-Daten entnehmen. |
|
18.30 |
In der Zahlungsbilanz werden Dienstleistungen nach den folgenden zwölf Standardkomponenten aufgeschlüsselt:
|
|
18.31 |
Drei der oben genannten Standardkomponenten der Zahlungsbilanz richten sich auf die Transaktionspartner, d. h. Erwerber oder Anbieter, und nicht auf das eigentliche Produkt. Diese fallen in die Kategorien Reiseverkehr, Bauleistungen und staatsbezogene Waren und Dienstleistungen, a.n.g.
Alle übrigen Komponenten betreffen Produkte und werden aus den detaillierteren Klassen nach CPA Rev. 2 hergeleitet. Im Statistikhandbuch für den Internatonalen Dienstleistungsverkehr (Manual on Statistics of International Trade in Services, kurz MSITS) (3) finden sich zusätzliche Standards für den Dienstleistungsverkehr. Dieses Handbuch ist mit den internationalen Konten harmonisiert. |
Bewertung
|
18.32 |
Die Bewertungsgrundsätze in den internationalen Konten und im ESVG sind identisch. In beiden Fällen werden Marktwerte verwendet, wobei in einigen Positionen Nennwerte zum Ansatz kommen, wenn keine beobachtbaren Marktpreise vorliegen. In den internationalen Konten stellt die Bewertung von Warenexporten und Warenimporten einen Sonderfall dar, da hier ein gleichförmiger Ansatz verwendet wird, nämlich der Wert der Ware an der Zollgrenze der ausführenden Wirtschaft, d. h. Bewertung auf fob-Basis ("frei an Bord"). Diese Bewertung vereinheitlicht die Bewertung bei Exporteur und Importeur und bietet ein einheitliches Maß für eine breite Palette möglicher Vereinbarungen, von "ab Werk" auf der einen Seite (wo der Importeur komplett für Transport und Versicherung verantwortlich ist) bis hin zu "frei verzollt" im anderen Extrem (wo der Exporteur sämtliche Transport- und Versicherungskosten sowie etwaige Zollabgaben trägt). |
Waren zur Veredlung
|
18.33 |
Vom ESVG 95 auf das ESVG 2010 hat sich die Behandlung von Waren, die ohne Eigentumswechsel zur Veredlung ins Ausland gesendet werden, grundlegend geändert. Im ESVG 95 wurden solche Güter beim Versand als Exporte ausgewiesen und bei Rückkehr aus dem Ausland als Importe mit einem infolge der Veredlung erhöhten Wert gebucht. Das wurde als Bruttoausweisverfahren bezeichnet und unterstellt einen Eigentumswechsel, so dass die internationalen Handelszahlen eine Schätzung der gehandelten Waren darstellen. Nach SNA 2008, BPM6 und ESVG 2010 wird kein Eigentumswechsel unterstellt, sondern es gibt nur eine einzige Buchung: die Einfuhr der Veredlungsleistung. Das entspräche einem Dienstleistungsexport für das Land, in dem die Veredlung stattfindet. Diese Buchungsweise steht besser mit den institutionellen Aufzeichnungen und den damit verbundenen Finanztransaktionen in Einklang. Sie führt jedoch zu einer Unstimmigkeit mit der internationalen Warenhandelsstatistik (IMTS). Die IMTS weist nach wie vor den Bruttowert der Veredlungsexporte und der rückimportierten veredelten Güter aus. |
|
18.34 |
Um eine solche Unstimmigkeit in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu vermeiden, können die IMTS-Werte der exportierten und der importierten Waren weiter als nachrichtliche Ergänzungspositionen mitgeführt werden. Dadurch lässt sich die Netto-Veredelungsdienstleistung als Differenz des Wertes der exportierten veredelten Waren abzüglich des Wertes der importierten unveredelten Waren ableiten. Eben diese Dienstleistung wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gebucht. Für das Land, das die Waren im Ausland veredeln lässt, erscheinen somit die zur Veredlung exportierten Waren neben den importierten veredelten Waren als zusätzliche Positionen im Außenkonto der Gütertransaktionen. So werden die Zahlen der IMTS mit den Nettozahlen für Dienstleistungsimporte (d. h. Veredlungskosten) in Übereinstimmung gebracht. |
|
18.35 |
Diese Änderung soll im Folgenden anhand eines Veredlungsbeispiels aus den Aufkommens- und Verwendungstabellen illustriert werden. Wir gehen von einem Unternehmen der Lebensmittelbranche aus, das Gemüse erntet und verarbeitet und die Dosenabfüllung an eine 100 %-ige Tochtergesellschaft im Ausland vergibt, um danach das Dosengemüse zurückzunehmen und weiterzuverkaufen. |
|
18.36 |
Die Import- und Exportzahlen in Tabelle 18.4 für das ESVG 1995 eines Veredelungsverfahrens für den internationalen Handel sollten mit den Angaben der internationalen Warenhandelsstatistik (IMTS) übereinstimmen. Die Warenexporte an das abfüllende ausländische Tochternehmen betragen 50 und die Importe des zurückkehrenden Dosengemüses belaufen sich auf 90. Tabelle 18.4 — Waren zur Veredlung als internationaler Handel nach ESVG 1995
Tabelle 18.5 — Waren zur Veredlung als internationaler Handel nach ESVG 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.37 |
Tabelle 18.5 veranschaulicht die Behandlung der zur Veredlung bestimmten Waren auf Nettobasis im ESVG 2010: Erfasst wird nur der Dienstleistungsverkehr, deshalb gibt es kein Pendant zu den in der IMTS ausgewiesenen Warenbewegungen. Die Nettoposition Exporte abzüglich Importe wird in den internationalen Konten der Zahlungsbilanz und in den entsprechenden Konten des Sektors übrige Welt ausgewiesen. Importe und Exporte, die in der IMTS ausgewiesen sind und bekanntermaßen eine Konstellation ohne Eigentumswechsel betreffen, sind laut Empfehlung des BPM6 in der Zahlungsbilanz direkt nebeneinander zu setzen, so dass sich der Dienstleistungsbestandteil unmittelbar berechnen lässt. Das bedeutet für den betrachteten Nahrungsmittelbetrieb, dass das zur Dosenabfüllung ins Ausland gehende Gemüse als Export mit 50 und das reimportierte Dosengemüse als Import mit 90 ausgewiesen würde. Diese Zahlen können in der Statistik der internationalen Konten als nachrichtliche Positionen nebeneinander gestellt werden, wobei die Exporte als negative Importe dargestellt werden, so dass sich ein Nettowert von 40 für die importierten Dosenabfüllleistungen ableiten lässt. Diese BPM6-Buchung ist in Tabelle 18.6 beispielhaft illustriert. Tabelle 18.6 — Buchung der Veredlung nach BPM6
|
Transithandel
Transithandelswaren
|
18.38 |
Beim Transithandel (Merchanting) kauft eine gebietsansässige Einheit (der abrechnenden Volkswirtschaft) Waren von einer gebietsfremden Einheit, um die gleichen Waren an eine andere gebietsfremde Einheit weiterzuverkaufen, ohne dass die Waren in der abrechnenden Volkswirtschaft vorliegen. Der Transithandel betrifft Gütertransaktionen, bei denen die materielle Inbesitznahme der Waren durch den Eigentümer für den Ablauf der Geschäftshandlung nicht notwendig ist. Die jetzigen und nachfolgenden Einordnungen zum Transithandel folgen den entsprechenden Abschnitten im BPM6 (Nummern 10.41 bis 10.48). |
|
18.39 |
Transithandelsvereinbarungen werden für den Großhandel ebenso wie für den Einzelhandel getroffen. Sie können für Warenverkehrsgeschäfte ebenso eingesetzt werden wie für die Verwaltung und Finanzierung globaler Fertigungsprozesse. Beispielsweise kann ein Unternehmen die Montage an einen oder mehrere Auftragnehmer vergeben, indem es die Waren erwirbt und weiterverkauft, ohne dass die Waren das Wirtschaftsgebiet des Eigentümers queren. Falls sich durch fremde Fertigungsdienstleistungen die materielle Form der Waren ändert, während sie sich im Eigentum des Transithändlers befinden, werden die Gütertransaktionen als allgemeine Warengeschäfte und nicht als Transithandel gebucht. In anderen Fällen, wo sich die Form der Waren nicht ändert, erfolgt eine Buchung unter Transithandel, wenn der Verkaufspreis der Waren geringfügige Veredlungskosten sowie Großhandelsspannen erkennen lässt. In Fällen, in denen der Händler einen globalen Fertigungsprozess organisiert, können im Verkaufspreis auch Elemente wie Bereitstellung von Planung, Verwaltung, Patenten und anderem Know-how, Marketing und Finanzierung enthalten sein. Insbesondere bei High-Tech-Waren können die immateriellen Bestandteile gegenüber dem Wert von Material und Montageleistung ins Gewicht fallen. |
|
18.40 |
Transithandelsware wird in den Konten des Eigentümers genauso behandelt wie andere Ware in seinem Eigentum. Diese Waren werden jedoch in den internationalen Statistiken der Volkswirtschaft des Händlers im Einzelnen aufgeschlüsselt, da sie dort von ureigenem Interesse sind und nicht unter die Zollbestimmungen dieser Volkswirtschaft fallen. Transithandel wird wie folgt gebucht:
|
|
18.41 |
Transithandel-Positionen erscheinen nur als Exporte in den Konten der Volkswirtschaft des Transithändlers. In den entsprechend exportierenden bzw. importierenden Volkswirtschaften werden Exportverkäufe an Transithändler und Importkäufe bei Transithändlern im allgemeinen Warenhandel verbucht. |
|
18.42 |
Gütertransaktionen in Großhandel, Einzelhandel, Warenhandel und Fertigungsverwaltung können auch so vereinbart sein, dass die Güter in der Volkswirtschaft des Eigentümers vorliegen; in diesem Fall werden sie als allgemeine Waren und nicht im Transithandel gebucht. Wenn Güter nicht die Volkswirtschaft des Eigentümers durchlaufen, aber aufgrund einer Veredlung im Ausland ihre körperliche Form ändern, werden die internationalen Transaktionen als allgemeiner Warenhandel betrachtet und nicht als Transithandel gebucht (das Veredelungsentgelt wird als vom Eigentümer bezahlte Fertigungsdienstleistung gebucht). |
|
18.43 |
Ein Transithandel liegt nicht vor, wenn der Händler die Waren an eine gebietsansässige Einheit verkauft, die der gleichen Volkswirtschaft wie der Händler angehört. In einem solchen Fall gilt der Erwerb der Waren als allgemeiner Warenimport in diese Volkswirtschaft. Falls die gebietsansässige Einheit die Güter, die sie von einem Händler in der gleichen Volkswirtschaft gekauft hat, anschließend an eine gebietsfremde Einheit verkauft, werden diese Warenverkäufe als allgemeine Warenexporte aus der Volkswirtschaft des Händlers verbucht, unabhängig davon, ob die Güter tatsächlich in der Volkswirtschaft des Händlers präsent sind. Solch ein Fall ist zwar dem Transithandel sehr ähnlich, aber er erfüllt nicht die Definitionskriterien nach Nummer 18.38. Darüber hinaus wäre es unpraktisch für den Ersthändler, seine Einkäufe als Transithandel zu buchen, da er nicht wissen kann, ob der zweite Händler die Güter aus der Volkswirtschaft nimmt oder nicht. |
Importe und Exporte von FISIM
|
18.44 |
Für Kredite tatsächlich gezahlte und erhaltene Zinsen beinhalten eine Einkommenskomponente und ein Dienstleistungsentgelt. Die Zinssätze, die Kreditinstitute für Anlagen bieten, sind niedriger als die Zinssätze, die für ausgereichte Kredite verlangt werden. Die sich daraus ergebenden Zinsmargen verwenden die finanziellen Kapitalgesellschaften für die Deckung ihrer Ausgaben und für die Erwirtschaftung eines Betriebsüberschusses. Zinsmargen sind eine Alternative zur offenen Abrechnung von Finanzdienstleistungen gegenüber Kunden. Im ESVG ist für diese unterstellten Bankgebühren für FISIM die Buchung eines Dienstleistungsentgelts vorgeschrieben. Die Begriffsbestimmung und die Leitlinien für die Veranschlagung der FISIM finden sich in Kapitel 14. |
|
18.45 |
Weder die Finanzinstitute, die unterstellte Bankgebühren stillschweigend in Rechnung stellen, noch deren Kunden sind zwangsweise gebietsansässig. Deshalb sind für diese Art von Finanzdienstleistungen auch Importe und Exporte möglich. Leitlinien für die Abrechnung von Importen und Exporten von FISIM finden sich unter 14.10. |
Außenkonto von Primär- und Sekundäreinkommen
In den Tabellen 18.7 und 18.8 wird an einem Beispiel die unterschiedliche Buchung von Primär- und Sekundäreinkommen in ESVG und BPM6 illustriert.
Tabelle 18.7 — Außenkonto der Primär- und Sekundäreinkommen (ESVG V.II)
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
|
|
B.11 |
Außenbeitrag |
–41 |
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
6 |
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
2 |
|
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
0 |
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
0 |
|
D.3 |
Subventionen |
0 |
D.3 |
Subventionen |
0 |
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
63 |
D.4 |
Vermögenseinkommen |
38 |
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögenssteuern |
1 |
D.5 |
Einkommen- und Vermögenssteuern |
0 |
|
D.6 |
Sozialbeiträge und Sozialleistungen |
0 |
D.6 |
Sozialbeiträge und Sozialleistungen |
0 |
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
16 |
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
55 |
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
|
B.12 |
Saldo der laufenden Außentransaktionen |
–32 |
|
|
|
Tabelle 18.8 — Primäreinkommenskonto und Sekundäreinkommenskonto des BPM6
|
|
ESVG-Code |
Haben |
Soll |
Saldo |
|
Aus Waren und Dienstleistungen |
|
|
|
41 |
|
Primäreinkommenskonto |
||||
|
Arbeitnehmerentgelt |
D.1 |
6 |
2 |
|
|
Zinsen |
D.4 |
13 |
21 |
|
|
Ausschüttungen und Entnahmen |
36 |
17 |
|
|
|
Reinvestierte Gewinne |
14 |
0 |
|
|
|
Produktions- und Importabgaben |
D.2 |
0 |
0 |
|
|
Subventionen |
D.3 |
0 |
0 |
|
|
Primäreinkommen |
|
69 |
40 |
29 |
|
Waren, Dienstleistungen und Primäreinkommen |
|
609 |
539 |
70 |
|
Sekundäreinkommenskonto |
||||
|
Einkommen- und Vermögenssteuer |
D.5 |
1 |
0 |
|
|
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
D.6, D.7, D.8 |
2 |
11 |
|
|
Nichtlebensversicherungsleistungen |
12 |
3 |
|
|
|
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
1 |
31 |
|
|
|
Übrige laufende Transfers |
1 |
10 |
|
|
|
Sekundäreinkommen |
|
17 |
55 |
–38 |
|
Saldo der Leistungsbilanz |
|
|
|
32 |
Das Primäreinkommenskonto
|
18.46 |
Die Buchungen auf dem Primäreinkommenskonto der Zahlungsbilanz beinhalten — genau wie das primäre Einkommensverteilungskonto des ESVG — Arbeitnehmerentgelte und Vermögenseinkommen. Von gebietsansässigen Einheiten gezahlte Produktionsabgaben und empfangene eigenstaatliche Subventionen werden auf das Einkommensentstehungskonto geschrieben, ein Konto, das es in der Zahlungsbilanz nicht gibt. Produktionsabgaben, die eine gebietsansässige Einheit an einen anderen Staat zahlt, und Subventionen, die die gebietsansässige Einheit von einem anderen Staat empfängt, werden im Primäreinkommenskonto der Zahlungsbilanz verbucht. Die entsprechenden Buchungen erfolgen für den inländischen Staat im primären Einkommensverteilungskonto und für den ausländischen Staat in der Spalte übrige Welt dieses Kontos und im Primäreinkommenskonto der Zahlungsbilanz. |
|
18.47 |
In grenzüberschreitenden Fällen können Mieten/Pachten anfallen; dieser Fall ist jedoch selten, da für Grundstücke stets ein inländischer Eigentümer angenommen wird, und sei es notfalls über die Einrichtung einer fiktiven gebietsansässigen Einheit. Wenn solche fiktiven gebietsansässigen Einheiten sich im Eigentum gebietsfremder Einheiten befinden, gilt das erwirtschaftete Einkommen dieser Einheiten als Einkommen aus Direktinvestitionen und nicht als Miete/Pacht. Ein Beispiel, bei dem Mieten/Pachten in den internationalen Konten gebucht werden, sind kurzfristige Fischereirechte in territorialen Gewässern für ausländische Fischfangflotten. In den internationalen Konten wird für Vermögenseinkommen ohne Miete/Pacht gewöhnlich der Begriff Investitionseinkommen ("investment income") gebraucht. Dieses Investitionseinkommen betrifft Einkommen aus dem Eigentum an Forderungen. Bei Disaggregierung entspricht es Forderungen und Verbindlichkeiten, so dass sich Renditen errechnen lassen. |
Einkommen aus Direktinvestitionen
|
18.48 |
Unternehmen, in die direkt investiert wird, spielen eine besonders wichtige Rolle; das zeigt sich sowohl in den Strom- als auch in den Bestandsgrößen der internationalen Konten. Bei solchen Unternehmen wird davon ausgegangen, dass ein Teil der einbehaltenen Gewinne als eine Form von Investitionseinkommen an den Direktinvestor ausgeschüttet wird. Der Anteil entspricht der Beteiligung des Direktinvestors am Unternehmen. |
|
18.49 |
Einbehaltene Gewinne sind gleich dem Nettobetriebsüberschuss des Unternehmens zuzüglich aller anfallenden Vermögenseinkommen abzüglich aller zu leistenden Vermögenseinkommen (vor Berechnung der reinvestierten Gewinne) zuzüglich aller empfangenen laufenden Transfers abzüglich aller zu leistenden laufenden Transfers und abzüglich des Korrekturpostens für die Zunahme der betrieblichen Alterssicherungsansprüche. Reinvestierte Gewinne von unmittelbaren Tochterunternehmen sind im empfangenen Vermögenseinkommen des Unternehmens enthalten, in das direkt investiert wird. |
|
18.50 |
Reinvestierte Gewinne können auch einen negativen Wert annehmen, beispielsweise wenn das Unternehmen Verluste schreibt oder wenn Umbewertungsgewinne ausgeschüttet werden, oder in einem Quartal, in dem eine Jahresdividende ausgeschüttet wird. So wie positive reinvestierte Gewinne als Eigenkapitalzufuhr durch den Direktinvestor behandelt werden, werden negative reinvestierte Gewinne als Abzug von Eigenkapital behandelt. Bei einem Unternehmen, das Gegenstand einer Direktinvestition und 100 %-ige Tochter einer gebietsfremden Einheit ist, sind die reinvestierten Gewinne gleich den einbehaltenen Gewinnen, so dass der Saldo der Primäreinkommen des Unternehmens exakt Null beträgt. |
Das Sekundäreinkommenskonto (laufende Transfers) des BPM6
|
18.51 |
Das Sekundäreinkommenskonto weist die laufenden Transfers zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden aus. Der Buchungsbereich der laufenden Transfers entspricht exakt dem Buchungsbereich im Konto der sekundären Einkommensverteilung. Einige Buchungen sind besonders in den internationalen Konten wichtig, insbesondere laufende Transfers im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Überweisungen von im Ausland beschäftigten natürlichen Personen in ihr Heimatland. |
|
18.52 |
Grenzüberschreitende private Transfers gehen von privaten Haushalten an private Haushalt und sind deshalb von Interesse, weil sie eine wesentliche internationale Finanzquelle für einige Länder sind, die eine Vielzahl von Arbeitnehmern mit langfristigem Beschäftigungsverhältnis im Ausland haben. In den privaten Transfers enthalten sind Überweisungen von langfristig Beschäftigten, d. h. von Personen, die ihren Wohnsitz in das Gastland verlegt haben. |
|
18.53 |
Andere Beschäftigte, wie Grenzgänger und Saisonarbeiter, verlassen ihre Volkswirtschaft nicht. In diesem Fall sind die internationalen Transaktionen keine Transfers, sondern enthalten Erwerbseinkommen (Arbeitnehmerentgelte), Steuern und Reisekosten. In der Zahlungsbilanz werden private Heimatüberweisungen zusätzlich ausgewiesen und führen so diese verwandten Transaktionen mit den privaten Transfers zusammen. Private Heimatüberweisungen enthalten private Transfers, Arbeitnehmerentgelte abzüglich Steuern und Reisekosten, sowie Vermögenstransfers zwischen Privathaushalten. |
|
18.54 |
International können Versicherungsströme, insbesondere Rückversicherungsströme, von Bedeutung sein. Die Transaktionen zwischen dem Direktversicherer und dem Rückversicherer werden als vollkommen separater Satz von Transaktionen gebucht. Es erfolgt keine Konsolidierung zwischen den Transaktionen des Direktversicherers als Aussteller einer Police im Erstgeschäft einerseits und dem Verhältnis des Policeninhabers zum Rückversicherer andererseits. |
Außenkonto der Vermögensbildung
|
18.55 |
Die Elemente des Vermögensbildungskontos bei internationalen Transaktionen sind reduzierter als die Elemente in den inländischen Sektoren. Die Buchungen im Vermögensbildungskonto enthalten nur Zugänge (Erwerb) und Abgänge (Veräußerung) nichtproduzierter Vermögensgüter sowie Vermögenstransfers. Hier werden keine Transaktionen als Vermögensbildung produzierter Güter gebucht, da die letzte Verwendung der exportierten und importierten Waren zum Zeitpunkt der Buchung nicht bekannt ist. Ebenso wenig wird Erwerb und Veräußerung von Grund und Boden verbucht. |
|
18.56 |
Der Finanzierungssaldo ist der Saldo für die Transaktions- und Vermögensbildungskonten und für das Finanzierungskonto. Er umfasst alle Instrumente, die für die Mittelbereitstellung bzw. den Mittelerwerb verwendet werden, nicht nur Kredit- und Anleihegeschäfte. Der Finanzierungssaldo nach BPM6 besitzt vom Grundansatz her den gleichen Wert wie die entsprechende Position für die Gesamtvolkswirtschaft in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechungen und die entsprechende Position für die übrige Welt in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, aber mit umgekehrtem Vorzeichen. In den Tabellen 18.9, 18.10 und 18.11 wird die Buchung der einzelnen Kontoelemente für laufende Transaktionen und Vermögensbildung sowie die Saldierung nach ESVG und BPM6 aufgezeigt. Tabelle 18.9 — Reinvermögensänderung aufgrund des Saldos der laufenden Außentransaktionen und aufgrund von Vermögenstransfers (ESVG V.III.1.1) (4)
Tabelle 18.10 — Sachvermögensbildungskonto (ESVG V.III.1.2)
Tabelle 18.11 — Vermögensbildungskonto des BPM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzierungskonto und Auslandsvermögensstatus
|
18.57 |
Das Finanzierungskonto der Zahlungsbilanz und der Auslandsvermögensstatus sind besonders wichtig, da sie die internationale Finanzierung sowie die internationale Liquidität und Anfälligkeit deutlich machen. Anders als im ESVG erfolgt die Klassifizierung der Finanzinstrumente in der Zahlungsbilanz nach funktionalen Kriterien (siehe 18.21) mit zusätzlichen Daten zu Instrumenten und institutionellen Sektoren. Die Tabellen 18.12 und 18.13 illustrieren das Außenkonto der Finanzierungsströme nach ESVG bzw. das Finanzierungskonto nach BPM6. Tabelle 18.12 — Außenkonto der Finanzierungsströme (ESVG V.III.2)
Tabelle 18.13 — Finanzierungskonto des BPM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.58 |
Die funktionalen Kategorien des BPM6 liefern Informationen über die Beweggründe der an den finanziellen Transaktionen Beteiligten sowie über deren wechselseitiges Verhältnis und sind so für internationale Wirtschaftsanalysen besonders interessant. Die Daten der einzelnen funktionalen Kategorien werden weiter untergliedert nach Finanzinstrumenten und institutionellen Sektoren und lassen sich so mit den entsprechenden Positionen des ESVG sowie der Währungs- und Finanzstatistik verknüpfen. Die Untergliederung der institutionellen Sektoren ist im BPM6 und im ESVG identisch, wird aber in der Regel verkürzt (auf fünf Sektoren in den Standardkomponenten). Außerdem gibt es einen zusätzlichen Teilsektor für Währungsbehörden, der als funktionaler Teilsektor mit dem Reservevermögen verknüpft ist. Er umfasst die Zentralbank und alle Teilbereiche des Staates bzw. nicht zur Zentralbank gehörenden finanziellen Kapitalgesellschaften mit Reservevermögen. Somit ist er für alle Länder relevant, in denen sich das Reservevermögen ganz oder teilweise außerhalb der Zentralbank befindet. |
|
18.59 |
Die Hauptverknüpfungen zwischen den Finanzinstrument-Kategorien der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und den funktionalen Kategorien der internationalen Konten sind in Tabelle 18.14 dargestellt. Die funktionalen Kategorien werden im Finanzierungskonto des BPM6 sowohl aktivseitig als auch passivseitig verwendet. Die Darstellung beschränkt sich auf die gebräuchlichsten Verknüpfungen. Tabelle 18.14 — Verknüpfungen zwischen den funktionalen Kategorien des BPM6 und den Kategorien der Finanzinstrumente des ESVG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILANZEN FÜR DEN SEKTOR ÜBRIGE WELT
|
18.60 |
Der Auslandsvermögensstatus wird in den internationalen Konten als Teil der Bilanzen ausgewiesen. Die Wortwahl macht deutlich, welche Einzelkomponenten der nationalen Bilanzen einbezogen werden. Der Auslandsvermögensstatus umfasst nur Forderungen und Verbindlichkeiten. Ist in einem Land ein Grundstück im direkten Eigentum einer gebietsfremden Einheit, wird als Eigentümerin des Grundstücks eine fiktive gebietsansässige Einheit eingesetzt, die eine Forderung der gebietsfremden Eigentümerin begründet (siehe auch 18.16). Bei finanziellen Ansprüchen kommt das grenzüberschreitende Element zum Tragen, wenn die eine Partei gebietsansässig und die andere Partei gebietsfremd ist. Hinzu kommt Barrengold, dem zwar keine Verbindlichkeit gegenübersteht, das aber aufgrund seiner Rolle als internationales Zahlungsmittel in den Auslandsvermögensstatus einbezogen wird, wenn es sich im Reservevermögen befindet. Nichtfinanzielle Vermögensgüter bleiben jedoch ausgeschlossen, da ihnen keine Verbindlichkeit gegenübersteht und ihnen die internationale Dimension fehlt. |
|
18.61 |
Der Saldo im Auslandsvermögensstatus ist die Nettoauslandsposition. Die Nettoauslandsposition zuzüglich nichtfinanzieller Vermögensgüter in der volkswirtschaftlichen Bilanz ist gleich dem volkswirtschaftlichen Reinvermögen, da sich in der nationalen Bilanz die Forderungen zwischen Gebietsansässigen netto ausgleichen. Tabelle 18.15 zeigt das Beispiel einer Bilanz für den Sektor übrige Welt und Tabelle 18.16 ein Beispiel für den Auslandsvermögensstatus. |
|
18.62 |
Die gleichen breit angelegten Kategorien finden sich beim Investitionseinkommen und Auslandsvermögensstatus. Dies ermöglicht die Berechnung durchschnittlicher Renditen. Die Renditen können zeitlich sowie nach unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten und Fälligkeiten miteinander verglichen werden. So lässt sich beispielsweise die Renditeentwicklung bei Direktinvestitionen analysieren oder die Rendite mit anderen Instrumenten vergleichen. Tabelle 18.15 — Bilanzen für den Sektor übrige Welt (ESVG)
Tabelle 18.16 — Der integrierte Auslandsvermögensstatus im BPM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) International Monetary Fund, Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6), 2009, ISBN 978-1-58906-812-4 (abrufbar unter http://www.imf.org).
(2) International Merchandise Trade Statistics: Concepts and definitions, United Nations, 1998, ISBN 92-1-161410-4 (abrufbar unter: http://unstats.un.org).
(3) United Nations, Eurostat, OECD, IMF, WTO et al, Manual on Statistics of International Trade in Services, 2011, (abrufbar unter: http://unstats.un.org)
(4) Im Fall der übrigen Welt handelt es sich hierbei um die Veränderung des Reinvermögens aufgrund des Saldos der laufenden Transaktionen mit der übrigen Welt und aufgrund von Vermögenstransfers.
KAPITEL 19
EUROPÄISCHE AGGREGATE
EINFÜHRUNG
|
19.01 |
Der Prozess der europäischen Integration erforderte die Einrichtung eines kompletten Kontensystems zur Abbildung der gesamteuropäischen Volkswirtschaft, auch als Instrument zur besseren Analyse und Politikplanung auf europäischer Ebene. Die europäischen Aggregate beruhen auf dem gleichen Kontensystem und auf den gleichen Konzepten wie die Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten. |
|
19.02 |
Dieses Kapitel beschreibt die besonderen Merkmale der europäischen Aggregate, d. h. der Rechnungen für die Europäische Union und das Euro-Währungsgebiet („Euroraum“). Besondere Aufmerksamkeit erfordern bei den europäischen Aggregaten die Definition der gebietsansässigen Einheiten, die Konten der übrigen Welt und die Aufrechnung der innereuropäischen wirtschaftlichen Transaktionen (Ströme) und finanziellen Vermögensbilanzen (Bestände). |
|
19.03 |
Das Wirtschaftsgebiet der Europäischen Union umfasst
|
|
19.04 |
Das Wirtschaftsgebiet des Euro-Währungsgebiets umfasst
|
VON DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN DER EINZELSTAATEN ZU DEN EUROPÄISCHEN AGGREGATEN
|
19.05 |
Vom Grundansatz her sind die europäischen Aggregate nicht gleich der Summe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten nach Umrechnung in eine gemeinsame Währung. Hinzuzurechnen sind die Konten der gebietsansässigen europäischen Organe. Der Geltungsbereich des Konzeptes der Gebietsansässigkeit ändert sich beim Übergang von den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten zu europäischen Aggregaten. Die Behandlung reinvestierter Gewinne von ausländischen Direktinvestitionsunternehmen oder von Zweckgesellschaften ist ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten können die Investoren eines ausländischen Direktinvestitionsunternehmens Gebietsansässige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union/des Euro-Währungsgebiets sein. In den europäischen Aggregaten werden die entsprechenden reinvestierten Gewinne nicht also solche gebucht. Außerdem müssen Zweckgesellschaften möglicherweise in denselben institutionellen Sektor wie ihr Mutterunternehmen umgebucht werden, wenn dieses in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist. Schließlich sind grenzüberschreitende Wirtschaftsströme und Finanzbestände zwischen europäischen Ländern umzubuchen. Diese Unterschiede sind in den Abbildungen 19.1 und 19.2 verdeutlicht. Der europäische Raum wird vereinfacht mit nur zwei Mitgliedstaaten gezeigt: Land A und Land B. Die Ströme und Bestände zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden Einheiten sind mit Pfeilen dargestellt. Abbildung 19.1 — Aggregation der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten. Wenn die VGR der Länder A und B aggregiert werden, verzeichnen die aggregierten Konten der übrigen Welt sowohl interne Ströme zwischen den Ländern A und B als auch Ströme mit Drittländern und europäischen Organen.
Abbildung 19.2 — Europäische Aggregate Die Europäische Union/der Euroraum wird als eine einzelne Einheit betrachtet: sie enthält die Rechnungen der europäischen Organe/der Europäischen Zentralbank und in den Konten der übrigen Welt werden nur Transaktionen zwischen gebietsansässigen Einheiten und Drittländern gebucht.
|
Umrechnung von Angaben in unterschiedlicher Währung
|
19.06 |
In europäischen Aggregaten sind die Handelsströme und die Finanzbestände in einer einzigen Standardwährung anzugeben. Dazu werden die in verschiedenen Währungen angegebenen Daten in Euro umgerechnet, entweder
Mit dem Verfahren gemäß Buchstabe a werden die Gewichte der Mitgliedstaaten in den europäischen Aggregaten entsprechend der Parität ihrer jeweiligen Währungen aktualisiert. Die Niveaus der europäischen Aggregate sind somit jederzeit auf dem neuesten Stand, aber ihre Bewegungen können durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Soweit es sich um Verhältniswerte handelt, hebt sich der Einfluss der Wechselkursschwankungen auf Zähler und Nenner weitestgehend auf. Das Verfahren gemäß Buchstabe b bringt keine Aktualisierung der Gewichte der einzelnen Mitgliedstaaten mit sich, wodurch die Änderungen der europäischen Aggregate vor Wechselkursschwankungen geschützt bleiben. Die Niveaus der europäischen Aggregate können jedoch durch die Wahl der (festen) Wechselkurse beeinflusst werden, denen die die Paritäten Währungen von Mitgliedstaaten zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechen. Das Verfahren gemäß Buchstabe c bewahrt die Bewegungen der europäischen Aggregate vor Wechselkursschwankungen, während die Niveaus der europäischen Aggregatebenen im Allgemeinen die jeweils geltenden Paritäten der entsprechenden Zeiträume widerspiegeln. Das geht zu Lasten der Additivität und anderer Rechnungsanforderungen. Falls sie erforderlich sind, müssen sie im letzten Schritt wiederhergestellt werden. |
|
19.07 |
Europäische Aggregate können auch berechnet werden, indem die in den unterschiedlichen Landeswährungen angegebenen Daten in Kaufkraftstandards (KKS) umgerechnet werden. Die in Nummer 19.06 dargelegten Verfahren gemäß den Buchstaben a, b und c lassen sich auch für diesen Zweck verwenden. Dabei sind die Wechselkurse durch die entsprechenden Kaufkraftparitäten (KKP) zu ersetzen. |
Europäische Organe
|
19.08 |
Die Europäischen Organe im ESVG umfassen die folgenden Einheiten:
Zu beachten ist, dass die Agenturen zur Regulierung des Agrarmarkts, deren Hauptaktivität im An- und Verkauf von Agrarerzeugnissen zur Preisstabilisierung besteht, nicht zu den europäischen Einrichtungen im Sinne des Buchstabens b zählen. Diese Agenturen werden als gebietsansässige Organe desjenigen Mitgliedstaates betrachtet, in dem sie tätig sind. |
|
19.09 |
Die Europäischen nichtfinanziellen Organe und Einrichtungen, die im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union erfasst sind, bilden eine institutionelle Einheit für sich, die im Wesentlichen nichtmarktbestimmte staatliche Dienstleistungen zum Nutzen der Europäischen Union erbringt. In der Klassifizierung ist dies der Teilsektor „Organe und Einrichtungen der Europäischen Union“ (S. 1315) (1) des Sektors „Staat“ (S. 13). |
|
19.10 |
Der Europäische Entwicklungsfonds bildet, solange sein Haushalt nicht als Teil des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union angenommen worden ist, eine gesonderte institutionelle Einheit im Teilsektor „Organe und Einrichtungen der Europäischen Union“ (S. 1315) des Sektors „Staat“ (S. 13). |
|
19.11 |
Die Europäische Zentralbank ist eine institutionelle Einheit, eingeordnet im Teilsektor „Zentralbank“ (S. 121) des Sektors „finanzielle Kapitalgesellschaften“ (S. 12). |
|
19.12 |
Die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investmentfonds sind gesonderte institutionelle Einheiten, eingeordnet im Teilsektor „sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen)“ (S. 125) des Sektors „finanzielle Kapitalgesellschaften“ (S. 12). |
|
19.13 |
Das Wirtschaftsgebiet der europäischen Organe umfasst auch die territorialen Exklaven, die sich in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in nicht zur EU gehörenden Ländern (Drittländern) befinden (Vertretungen, Delegationen, Büros usw.). |
|
19.14 |
Die Haupttransaktionen europäischer Organe werden unter Aufkommen und Verwendungen gemäß der Beschreibung im Anhang gebucht. |
Außenkonto der übrigen Welt
|
19.15 |
In den europäischen Aggregaten verzeichnen die Konten der übrigen Welt die Wirtschaftsströme und Finanzbestände (Forderungen/Verbindlichkeiten) zwischen den gebietsansässigen Einheiten der Europäischen Union/des Euroraums und gebietsfremden Einheiten. Somit enthält das europäische Außenkonto der übrigen Welt keine Transaktionen, die innerhalb der Europäischen Union/des Euroraums ablaufen. Die innerhalb der EU/des Euroraums stattfindenden Ströme heißen „Intra-Ströme“, die finanziellen Positionen zwischen Gebietsansässigen der EU/des Euroraums „Intra-Bestände“ |
|
19.16 |
Warenimporte/-exporte enthalten keinen Quasi-Warentransit, d. h.
Warenexporte sind auf fob-Basis an der Grenze der Europäischen Union/des Euroraums zu bewerten. Bei Quasi-Transitwaren für den Export sind die Transport- und Vertriebskosten innerhalb der Europäischen Union/des Euroraums als Produktion von Transportleistungen zu werten, wenn das Transportunternehmen in der Europäischen Union/im Euroraum ansässig ist, andernfalls als Import von Transportleistungen. |
|
19.17 |
In den europäischen Aggregaten betrifft der Transithandel nur die Fälle, in denen eine gebietsansässige Einheit der Europäischen Union/des Euroraums Waren von einer gebietsfremden Einheit kauft, um diese gleichen Waren anschließend an eine gebietsfremde Einheit weiterzuverkaufen, ohne dass die Waren in der Europäischen Union/im Euroraum effektiv vorliegen. Die Buchung erfolgt zuerst als negativer Warenexport und dann als positiver Warenexport, wobei zeitliche Abstände zwischen Kauf und Verkauf als Vorratsveränderungen verzeichnet werden (siehe Nummern 18.41 und 18.60). Wenn ein Transithändler, der in der Europäischen Union/im Euroraum ansässig ist, Waren von einer gebietsfremden Einheit kauft und anschließend an eine gebietsansässige Einheit eines anderen Mitgliedstaates verkauft, erscheint der Kauf als negativer Export in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Mitgliedstaates, dem der Transithändler angehört, während er in den europäischen Aggregaten als Import verzeichnet wird. |
|
19.18 |
Ein ausländisches Direktinvestitionsunternehmen ist in der Europäischen Union/im Euroraum ansässig, wenn ein gebietsfremder Investor mindestens 10 Prozent der Stammaktien oder Stimmrechte (für Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit) oder äquivalenten Rechte (für Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) hält. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten können für ein ausländisches Direktinvestitionsunternehmen auch solche Investoren maßgeblich sein, die einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union/des Euroraums angehören. Die entsprechenden reinvestierten Gewinne werden in den europäischen Aggregaten nicht als solche gebucht. |
Aufrechnung von Transaktionen
|
19.19 |
Ein Verfahren zur Erstellung des europäischen Außenkontos der übrigen Welt besteht darin, dass die innereuropäischen Ströme sowohl aufkommens- als auch verwendungsseitig aus den mitgliedstaatlichen Konten der übrigen Welt herausgenommen werden. Diese gespiegelten Ströme müssten sich theoretisch zwar aufheben, jedoch ist dies in der Praxis normalerweise nicht der Fall, weil die gleiche Transaktion in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der jeweils beteiligten Mitgliedstaaten asymmetrisch gebucht wird. |
|
19.20 |
Asymmetrien führen in den europäischen Aggregaten zu einer Inkongruenz zwischen Gesamtwirtschaft und Außenkonto der übrigen Welt. Bei den europäischen Aggregaten ist deshalb ein Kontenabgleich erforderlich. Hierzu verwendete Abgleichmethoden sind die Methode der kleinsten Quadrate oder die proportionale Zurechnung. Im Falle von Waren kann die Statistik des EU-Binnenhandels herangezogen werden, um die Asymmetrien nach Ausgabenkategorien aufzuteilen. |
|
19.21 |
Die Beseitigung von Asymmetrien und anschließende Saldierung der Konten bringt weitere Abweichungen zwischen den europäischen Aggregaten und der Summe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten mit sich. |
Preis- und Volumenmessungen
|
19.22 |
Für Transaktionen von Waren und Dienstleistungen kann eine europäische nichtfinanzielle Rechnung zu Vorjahrespreisen erstellt werden. Dazu wird eine ähnliche Methodik verwendet wie bei den europäischen Aggregaten zu jeweiligen Preisen. Zuerst werden die zu Vorjahrespreisen erstellten Rechnungen der Mitgliedstaaten und der europäischen Organe/Europäischen Zentralbank aggregiert. Im zweiten Schritt werden die zu Vorjahrespreisen bewerteten grenzüberschreitenden Transaktionen zwischen Mitgliedstaaten aus dem Außenkonto der übrigen Welt herausgenommen. Im dritten Schritt werden die sich ergebenden Unstimmigkeiten zwischen Aufkommen und Verwendung beseitigt, indem das gleiche Verfahren verwendet wird, das für die Aufrechnung der europäischen Transaktionen zu jeweiligen Preisen ausgewählt wurde. |
|
19.23 |
Die europäischen Aggregate zu Vorjahrespreisen erlauben die Berechnung von Volumenindizes zwischen dem laufenden Rechnungszeitraum und dem Vorjahr. Nach Auswahl eines Bezugszeitraums können Volumenindizes verkettet und dann auf die europäischen Aggregate zu jeweiligen Preisen des Bezugsjahres angewendet werden. Dies ergibt volumenbezogene europäische Aggregate für jeden beliebigen betrachteten Zeitraum. Die so gewonnenen Reihen sind nicht additiv. Wenn Additivität und andere Rechnungsanforderungen für Volumenmessungen für spezielle Zwecke erforderlich sind, sind sie im letzten Schritt wiederherzustellen, um additiv bereinigte Reihen zu erhalten. |
Vermögensbilanzen
|
19.24 |
In den europäischen Aggregaten lassen sich finanzielle Vermögensbilanzen auf ähnliche Weise wie bei den Transaktionen erstellen:
|
|
19.25 |
In den europäischen Aggregaten können nichtfinanzielle Vermögensbilanzen durch Summierung der nichtfinanziellen Vermögensbilanzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union/des Euroraums erstellt werden. |
„Intersektorielle“ Matrixdarstellungen
|
19.26 |
Die „intersektoriellen“ Matrizen schlüsseln die wirtschaftlichen Transaktionen (bzw. bestehende Forderungen) zwischen institutionellen Sektoren auf. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten geben mit diesen Darstellungen detailliert Auskunft über Transaktionen/Forderungen zwischen Herkunftssektor/Gläubiger und Bestimmungssektor/Schuldner sowie zwischen inländischen Sektoren und der übrigen Welt. |
|
19.27 |
In den europäischen Aggregaten lassen sich „intersektorielle“ Übersichten dadurch erstellen, dass die nationalen intersektoriellen Matrizen zusammengefasst und die innereuropäischen Ströme und Bestände zu gebietsansässigen Strömen und Beständen umklassifiziert werden. Dazu ist in den nationalen intersektoriellen Matrizen zu unterscheiden zwischen Transaktionen und Forderungen gegenüber gebietsansässigen Einheiten der Europäischen Union/des Euroraums und gegenüber gebietsfremden Einheiten im Außenkonto der übrigen Welt. Ferner müssen die Ströme und Bestände gegenüber den gebietsansässigen Einheiten der Europäischen Union/des Euroraums weiter nach Partnersektoren aufgeschlüsselt sein. |
ANHANG 19.1
AGGREGATE EUROPÄISCHER ORGANE
Aufkommen
|
19.28 |
Zu den Haupteinnahmequellen der nichtfinanziellen europäischen Organe und Einrichtungen gehören:
|
|
19.29 |
In den Konten der europäischen Organe werden diese Ströme als Aufkommen des Teilsektors „Organe und Einrichtungen der Europäischen Union“ (S. 1315) und als Verwendungen der übrigen Welt (S. 211) gebucht. |
|
19.30 |
Zölle und Agrarabschöpfungen werden an den Außengrenzen der Europäischen Union nach dem Gemeinsamen Zolltarif erhoben. Sie werden als „Importabgaben“ (D.212) eingestuft and enthalten Erhebungskosten. |
|
19.31 |
Produktionsabgaben werden auf die Zucker-, Isoglucose- und Inulinsirup-Quoten der Produzenten erhoben. Sie werden als „sonstige Gütersteuern“ (D.214) eingestuft and enthalten Erhebungskosten. |
|
19.32 |
Ein fester Anteil der erhobenen Beträge nach Nummer 19.A1.01 Buchstaben a und b wird von den Mitgliedstaaten als Erhebungskosten einbehalten. Dieser Anteil belief sich im Jahre 2009 auf 25 %. In den Aggregaten der europäischen Organe werden diese Erhebungskosten verwendungsseitig als „Vorleistungen“ (P.2) des Teilsektors „Organe und Einrichtungen der Europäischen Union“ (S. 1315) gebucht. Aufkommensseitig werden sie als „Dienstleistungsimporte“ (P.72) in den Konten der übrigen Welt (S. 211) gebucht. |
|
19.33 |
Die Mehrwertsteuer-Einnahmequelle wird mit einem festen Prozentsatz (MwSt.-Abrufsatz) anhand der harmonisierten MwSt.-Bemessungsgrundlage der einzelnen Mitgliedstaaten berechnet. Die MwSt.-Bemessungsgrundlage wird im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen gedeckelt. Deckelung bedeutet: Wenn die MwSt.-Bemessungsgrundlage eines Mitgliedstaates einen bestimmten prozentualen Anteil der BNE-Bemessungsgrundlage dieses Mitgliedstaates übersteigt, wird der MwSt.-Abrufsatz nicht auf die MwSt.-Bemessungsgrundlage, sondern auf diesen prozentualen Anteil der BNE-Bemessungsgrundlage angewendet. Die MwSt.-Bemessungsgrundlage beinhaltet Zahlungen für das laufende Jahr sowie fällige Restbeträge von Vorjahren aus Nachberechnungen früherer Jahre. Die Mehrwertsteuer-Einnahmequelle fällt unter „MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel“ (D.76). |
|
19.34 |
Die Einnahmequelle Bruttonationaleinkommen ist ein Restfinanzierungsbeitrag zum Haushalt der europäischen Organe und wird nach der Höhe des Bruttonationaleinkommens der einzelnen Mitgliedstaaten bemessen. Sie fällt unter „MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel“ (D.76) und enthält Erstattungszahlungen ebenso wie Restbeträge aus Vorjahren. Unter D.76 werden auch die Ausgleichszahlungen gebucht, die zur Korrektur von Haushaltsungleichgewichten von den anderen Mitgliedstaaten an die jeweils begünstigen Länder gezahlt werden, und zwar als Aufkommen und Verwendungen der übrigen Welt (S. 211). |
|
19.35 |
Die Beiträge der Mitgliedstaaten zum den Europäischen Entwicklungsfonds gelten als „laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit“ (D.74). |
|
19.36 |
Die Beteiligungen der Mitgliedstaaten am eingezahlten Kapital der Europäischen Investitionsbank, des Europäischen Investmentfonds und der Europäischen Zentralbank werden in den Finanzierungskonten als „sonstige Anteilsrechte“ (F.519) gebucht. Sie werden als Änderungen der Forderungen der übrigen Welt (S. 211) und als Änderungen der Verbindlichkeiten der Teilsektoren „sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen)“ (S. 125)/ „Zentralbank“ (S. 121) gebucht. |
|
19.37 |
Zu leistende Zinszahlungen auf Kredite der Europäischen Investitionsbank werden nach Abzug der unterstellten Bankdienstleistungen (FISIM) auf „Zinsen“ (D.41) geschrieben. In den Aggregaten der europäischen Organe werden sie als Verwendung der übrigen Welt (S. 2) und als Aufkommen des Sektors „sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen)“ (S. 125) gebucht. |
|
19.38 |
Zu leistende Zinszahlungen auf Kredite der Europäischen Zentralbank werden unter „Zinsen“ (D.41) eingeordnet. In den Aggregaten der europäischen Organe werden sie als Verwendungen der übrigen Welt (S. 2111) und als Aufkommen des Teilsektors „Zentralbank“ (S. 121) gebucht. |
Verwendung
|
19.39 |
Von europäischen nichtfinanziellen Organen und Einrichtungen geleistete Zahlungen umfassen
|
|
19.40 |
In den Konten der europäischen Organe werden die von europäischen nichtfinanziellen Organen und Einrichtungen geleisteten Zahlungen als Verwendung des Teilsektors „Organe und Einrichtungen der Europäischen Union“ (S. 1315) und als Aufkommen der übrigen Welt (S. 211 oder S. 22) gebucht. |
|
19.41 |
Die Buchung von Zahlungen, die von europäischen nichtfinanziellen Organen und Einrichtungen geleistet werden, erfolgt generell anhand der von den Mitgliedstaaten eingereichten Zahlungserklärungen. Anzahlungen und Nachtragszahlungen werden in den Finanzierungskonten der europäischen Organe als „übrige Forderungen/Verbindlichkeiten, ohne Handelskredite und Anzahlungen“ (F.89) gebucht. |
|
19.42 |
Von europäischen Finanzinstituten und Finanzeinrichtungen geleistete Zahlungen umfassen:
Die Kapitalbeteiligungen von Mitgliedstaaten an der Europäischen Investitionsbank werden nicht als ausländische Direktinvestition betrachtet, und somit erscheinen in deren Gesamtrechnungen keine Ströme von reinvestierten Gewinnen (D.43). |
|
19.43 |
In den Konten der europäischen Organe werden die von europäischen Finanzinstituten und Finanzeinrichtungen geleisteten Zahlungen als Verwendung des Teilsektors „sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen)“ (S. 125) und als Aufkommen der übrigen Welt (S. 211 oder S. 22) gebucht. |
Konsolidierung
|
19.44 |
In den europäischen Aggregaten erfolgt in der Regel keine aufkommens- und verwendungsseitige Konsolidierung von Strömen zwischen Mitgliedstaaten und europäischen Organen im Rahmen des Sektors „Staat“ (S. 13). Im Falle von „laufenden Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit“ (D.74) werden jedoch die von den Mitgliedstaaten für die Finanzierung z. B. des Europäischen Entwicklungsfonds an die europäischen Organe geleisteten Zahlungen konsolidiert und in den europäischen Aggregaten verwendungsseitig auf den „Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung)“ (S. 1311) und aufkommensseitig auf die übrige Welt (S. 22) geschrieben. |
(1) Es handelt sich um einen spezifischen Code für die Europäische Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Er erscheint nicht in Kapitel 23 „Klassifikationen“, da in diesem Kapitel die Codes für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten aufgeführt werden, in denen die Europäischen Institutionen zum Sektor „übrige Welt“ zählen.
KAPITEL 20
DIE KONTEN DES SEKTORS STAAT
EINFÜHRUNG
|
20.01 |
Die Tätigkeiten des Staates werden von denen der übrigen Wirtschaft getrennt, denn Befugnisse, Motivation und Funktionen des Staates unterscheiden sich von denen anderer Sektoren. Dieses Kapitel befasst sich mit den Konten des Sektors Staat und einer Darstellung der staatlichen Finanzstatistiken (government finance statistics — GFS), die einen Überblick über die staatliche Wirtschaftsaktivität bieten: Einnahmen, Ausgaben, Defizit/Überschuss, Finanzierung, sonstige wirtschaftliche Stromgrößen und Vermögensbilanz. |
|
20.02 |
Staaten verfügen über das hoheitliche Recht, Steuern und andere Pflichtabgaben zu erheben und Gesetze zu erlassen, die sich auf das Verhalten von Wirtschaftseinheiten auswirken. Die wichtigsten wirtschaftlichen Funktionen des Staates sind folgende:
|
|
20.03 |
Die GFS-Darstellung der Wirtschaftsaktivität des Sektors Staat stellt die übliche Kontenabfolge in einer Weise dar, die für die Abnalytiker der Staatsfinanzen und die politischen Entscheidungsträger geeigneter ist. Bei dieser Darstellung werden Aggregate und Kontensalden entsprechend den Konzepten, Definitionen, Klassifikationen und Buchungsregeln des ESVG verwendet, sodass sie in konsistenter Weise mit anderen makroökonomischen Variablen und mit denselben Messgrößen wie in anderen Ländern gemessen werden. Positionen wie etwa das Sparen und der Finanzierungssaldo sind bereits in der Kontenabfolge enthalten. Andere Positionen, beispielsweise Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Steuerlast und Gesamtverschuldung, sind nicht explizit dargestellt. |
|
20.04 |
Weitere Regeln für einige kompliziertere Aspekte der Klassifizierung und Messung im Sektor Staat werden im Abschnitt „Buchungsprobleme in Bezug auf den Sektor Staat“ erläutert. |
ABGRENZUNG DES SEKTORS STAAT
|
20.05 |
Der Sektor Staat (S.13) besteht aus allen staatlichen Einheiten und allen nichtmarktbestimmten Organisationen ohne Erwerbszweck, die von staatlichen Einheiten kontrolliert werden. Er umfasst außerdem sonstige Nichtmarktproduzenten gemäß den Nummern 20.18 bis 20.39. |
|
20.06 |
Staatliche Einheiten sind juristische Personen, die durch politische Verfahren entstanden sind und legislative, judikative oder exekutive Gewalt über andere institutionelle Einheiten in einem bestimmten Gebiet ausüben. Ihre Hauptfunktion besteht in der nichtmarktbestimmten Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für die Allgemeinheit und die privaten Haushalte sowie in der Umverteilung von Einkommen und Vermögen. |
|
20.07 |
Eine staatliche Einheit hat in der Regel die Befugnis, Mittel durch Pflichttransfers anderer institutioneller Einheiten aufzubringen. Um den Grundbedarf einer institutionellen Einheit zu decken, muss eine staatliche Einheit über eigene finanzielle Mittel verfügen, die entweder durch Einkommen von anderen Einheiten aufgebracht oder als Transferzahlungen von anderen staatlichen Einheiten empfangen werden, und die Befugnis haben, diese Mittel für die Verfolgung ihrer politischen Ziele aufzuwenden. Sie muss ferner Mittel für eigene Rechnung leihen können. |
Identifizierung von Einheiten im Sektor Staat
Staatliche Einheiten
|
20.08 |
In jedem Land besteht insbesondere innerhalb des Zentralstaats eine Kerneinheit, die die Exekutive, Legislative und Judikative auf nationaler Ebene wahrnimmt. Ihre Einnahmen und Ausgaben werden von einem Finanzministerium oder einer entsprechenden Stelle mittels eines allgemeinen, von der Legislative gebilligten Haushaltsplans direkt reguliert und kontrolliert. Trotz ihrer Größe und Vielgestaltigkeit bildet diese Kerneinheit gewöhnlich eine einzige institutionelle Einheit. Ministerialabteilungen, Agenturen, Ämter, Ausschüsse, Justizbehörden und gesetzgebende Körperschaften sind Teil dieser Kerneinheit Zentralstaat. Die einzelnen Ministerien, die zu ihr gehören, gelten nicht als eigenständige institutionelle Einheiten, da sie nicht befugt sind, in eigenem Namen über ihre Aktiva zu verfügen, Verbindlichkeiten einzugehen oder Transaktionen durchzuführen. |
|
20.09 |
Die Teilsektoren des Staates wie Länder und Gemeinden können derartige, in Nummer 20.08 beschriebenen primären staatlichen Kerneinheiten umfassen, die jeweils in Bezug zu einer bestimmten staatlichen Ebene und einem bestimmten geografischen Raum stehen. |
|
20.10 |
Zusätzlich zu dieser Primäreinheit bestehen staatliche Einheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit und erheblicher Autonomie einschließlich der Verfügungsfreiheit über die Höhe und Zusammensetzung ihrer Ausgaben und über eine direkte Einnahmequelle wie zweckgebundene Steuern. Solche Einheiten werden oft gebildet, um bestimmte Aufgaben auszuführen, beispielsweise Straßenbau oder die Nichtmarktproduktion von Gesundheits-, Bildungs- oder Forschungsdienstleistungen. Diese Körperschaften werden als gesonderte staatliche Einheiten angesehen, wenn sie über vollständige Kontensätze verfügen, aus eigenem Recht Waren oder Aktiva besitzen, nichtmarktbestimmte Tätigkeiten ausüben, für die sie haftbar sind, und Verbindlichkeiten eingehen und Verträge abschließen können. Solche Einheiten (zusammen mit dem Sektor Staat zugeordneten Organisationen ohne Erwerbszweck) werden als „außerbudgetäre Einheiten“ bezeichnet, weil sie über eigene Budgets verfügen, erhebliche Transferzahlungen aus dem zentralen Haushalt erhalten und ihre Hauptfinanzierungsquellen durch eigene Einnahmequellen außerhalb des zentralen Haushalts ergänzt werden. Diese außerbudgetären Einheiten zählen zum Sektor Staat, sofern sie nicht überwiegend von einer anderen staatlichen Einheit kontrollierte Marktproduzenten sind. |
|
20.11 |
Zum Haushaltsplan jeder staatlichen Ebene können Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit gehören, die Marktproduzenten und Quasi-Kapitalgesellschaften darstellen. Handelt es sich bei ihnen um institutionelle Einheiten, werden diese Unternehmen nicht als Teil des Sektors Staat angesehen, sondern werden den nichtfinanziellen oder finanziellen Kapitalgesellschaften zugeordnet. |
|
20.12 |
Die Sozialversicherung umfasst staatliche Einheiten, die Sozialversicherungssysteme betreiben. Sozialversicherungssysteme sind Systeme der sozialen Sicherung, in die die gesamte Bevölkerung oder weite Kreise der Bevölkerung einbezogen sind und die von staatlichen Einheiten vorgeschrieben und kontrolliert werden. Eine Sozialversicherung bildet eine institutionelle Einheit, wenn sie von den anderen Tätigkeiten staatlicher Einheiten getrennt organisiert ist, ihre Aktiva und Passiva getrennt davon hält und finanzielle Transaktionen in eigenem Namen durchführt. |
Dem Sektor Staat zugeordnete Organisationen ohne Erwerbszweck
|
20.13 |
Organisationen ohne Erwerbszweck, die Nichtmarktproduzenten sind und von staatlichen Einheiten kontrolliert werden, sind Einheiten des Sektors Staat. |
|
20.14 |
Regierungen können sich dafür entscheiden, für die Ausführung staatlicher Maßnahmen nicht auf staatliche Stellen, sondern auf gewisse Organisationen ohne Erwerbszweck zurückzugreifen, weil diese als unparteiischer, objektiver und weniger unter politischem Einfluss stehend angesehen werden. So sind zum Beispiel Forschung und Entwicklung wie auch die Festlegung und Verwaltung von Normen auf Gebieten wie Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Bildung Bereiche, in denen Organisationen ohne Erwerbszweck möglicherweise wirksamer sein können als staatliche Stellen. |
|
20.15 |
Die Kontrolle einer Organisation ohne Erwerbszweck wird definiert als die Möglichkeit, die allgemeine Politik oder das Programm dieser Organisation festzulegen. Öffentliche Interventionen in Form von allgemeinverbindlichen Verordnungen, die auf alle Einheiten anzuwenden sind, die in derselben Aktivität tätig sind, sind nicht maßgeblich bei der Entscheidung, ob der Staat die Kontrolle über eine individuelle Einheit ausübt. Um zu ermitteln, ob eine Organisation ohne Erwerbszweck von der Regierung kontrolliert wird, sollten die folgenden fünf Kriterien berücksichtigt werden:
Die Kontrolle kann bereits bei Erfüllung eines einzigen Kriteriums gegeben sein. Falls jedoch eine Organisation ohne Erwerbszweck, die hauptsächlich durch den Staat finanziert wird ihre Politik oder ihr Programm in einem signifikanten Umfang selbst entsprechend den Grundsätzen, wie sie in den anderen Kriterien erwähnt werden, bestimmen kann, wird sie nicht als vom Staat kontrolliert betrachtet. In den meisten Fällen werden mehrere Kriterien zusammen darauf hinweisen, dass die Kontrolle gegeben ist. Eine Entscheidung auf der Grundlage dieser Kriterien wird wertend sein. |
|
20.16 |
Die nichtmarktbestimmten Eigenschaften einer Organisation ohne Erwerbszweck werden auf die gleiche Weise wie für andere staatliche Einheiten bestimmt. |
Sonstige Einheiten des Sektors Staat
|
20.17 |
Die Zuordnung von Produzenten von Waren und Dienstleistungen, die unter dem Einfluss staatlicher Einheiten tätig sind, kann schwierig sein. Sie können dem Sektor Staat oder, wenn sie als institutionelle Einheiten einzustufen sind, öffentlichen Kapitalgesellschaften zugeordnet werden. In solchen Fällen wird der nachstehende Entscheidungsbaum verwendet. Abbildung 20.1 — Entscheidungsbaum
|
Öffentliche Kontrolle
|
20.18 |
Die Kontrolle über eine Einheit besteht in der Möglichkeit, die allgemeine Politik oder das Programm dieser Einheit festzulegen. Für die Feststellung, ob staatliche Kontrolle vorliegt, werden die Kriterien herangezogen, die für als öffentlich kontrollierte Kapitalgesellschaften anzusehende Firmen gelten, wie in Nummer 2.32 dargelegt. |
Markt-/Nichtmarktabgrenzung
Konzept der wirtschaftlich signifikanten Preise
|
20.19 |
Nichtmarktproduzenten stellen ihre Produktion anderen vollständig oder teilweise unentgeltlich oder zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen zur Verfügung. Wirtschaftlich signifikante Preise sind Preise, die einen substantiellen Einfluss darauf haben, welche Mengen von Produkten die Produzenten bereit sind zu liefern und welche Mengen an Produkten die Käufer erwerben möchten. Dies ist das Hauptkriterium für die Unterscheidung nach Markt- und Nichtmarktproduktion bzw. -produzenten und damit für die Entscheidung, ob eine institutionelle Einheit, bei der der Staat Kontrolle ausübt, als Nichtmarktproduzent bezeichnet werden soll — und deshalb zum Sektor Staat zählt — oder als Marktproduzent — und deshalb als öffentliche Kapitalgesellschaft anzusehen ist. |
|
20.20 |
Die Einschätzung, ob ein Preis wirtschaftlich signifikant ist, erfolgt jeweils für die einzelne Produktion, aber das Kriterium zur Bestimmung des Markt-/Nichtmarktcharakters einer Einheit wird auf der Ebene der Einheit angewendet. |
|
20.21 |
Es kann angenommen werden, dass Preise wirtschaftlich signifikant sind, wenn die Produzenten private Kapitalgesellschaften sind. Wenn jedoch der Staat Kontrolle ausübt, können die Preise einer Einheit zum Zwecke des Gemeinwohls festgelegt oder verändert werden, wodurch es schwierig werden kann zu bestimmen, ob die Preise wirtschaftlich signifikant sind. Öffentlich kontrollierte Kapitalgesellschaften werden häufig vom Staat errichtet, um Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die der Markt nicht in den Mengen oder zu den Preisen produzieren würde, die der staatlichen Politik entsprechen. Bei diesen staatlich unterstützten öffentlichen Einheiten kann der Verkauf einen großen Teil ihrer Kosten decken, dennoch reagieren diese Einheiten anders auf Marktkräfte als privat kontrollierte Kapitalgesellschaften. |
|
20.22 |
Um im Hinblick auf Veränderungen der Marktlage zwischen einem Markt- und einem Nichtmarktproduzenten zu unterscheiden, ist es sinnvoll festzustellen, welche Einheiten Verbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen sind und ob der Produzent am Markt tatsächlich einem Wettbewerb ausgesetzt oder der einzige Anbieter ist. |
Kriterien des Käufers der Produktion eines öffentlichen Produzenten
Die Produktion wird vorrangig an Kapitalgesellschaften und private Haushalte verkauft
|
20.23 |
Wirtschaftlich signifikante Preise ergeben sich normalerweise, wenn zwei wichtige Bedingungen erfüllt sind:
|
Die Produktion wird ausschließlich an den Staat verkauft
|
20.24 |
Einige Dienstleistungen werden typischerweise als Hilfsleistungen benötigt. Dazu gehören Tätigkeiten wie Beförderung, Finanzierungen und Investitionen, Ankauf, Verkauf, Marketing, Computerdienstleistungen, Kommunikation, Reinigung und Instandhaltung. Eine Einheit, die diese Art von Dienstleistungen ausschließlich für ihre Muttereinheit oder andere Einheiten in derselben Gruppe von Einheiten bereitstellt, ist eine Hilfseinheit. Sie ist keine eigenständige institutionelle Einheit und wird ihrer Muttereinheit zugeordnet. Hilfseinheiten stellen ihre gesamte Produktion ihren Eigentümern als Vorleistungen oder Bruttoanlageinvestitionen zur Verfügung. |
|
20.25 |
Verkauft ein öffentlich kontrollierter Produzent ausschließlich an den Staat und ist er der einzige Anbieter dieser Dienste, wird angenommen, er sei Nichtmarktproduzent, es sei denn, er konkurriert mit einem privaten Produzenten. Einen typischen Fall stellt das Bieten für einen Vertrag mit dem Staat zu kommerziellen Bedingungen dar; dementsprechend zahlt der Staat nur für erbrachte Leistungen. |
|
20.26 |
Falls ein öffentlicher Produzent einer von mehreren Lieferanten des Staates ist, gilt er als Marktproduzent, wenn er tatsächlich mit anderen Produzenten auf dem Markt im Wettbewerb steht und seine Preise die allgemeinen Kriterien wirtschaftlich signifikanter Preise erfüllen, wie in den Nummern 20.19 bis 20.22 definiert. |
Die Produktion wird an den Staat und andere verkauft
|
20.27 |
Ist ein öffentlicher Produzent der einzige Erbringer seiner Dienstleistungen, wird angenommen, er sei Marktproduzent, wenn seine Verkäufe an nichtstaatliche Einheiten mehr als die Hälfte seiner Gesamtproduktion ausmachen oder seine Verkäufe an den Staat die in Nummer 20.25 genannte Ausschreibungsbedingung erfüllen. |
|
20.28 |
Gibt es mehrere Lieferanten, ist ein öffentlicher Produzent ein Marktproduzent, wenn er mit den anderen Produzenten über Ausschreibungen um einen Vertrag mit dem Staat in Wettbewerb steht. |
Der Markt-/Nichtmarkttest
|
20.29 |
Die Sektorklassifikation von staatlichen Kerneinheiten, die mit der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen auf nichtmarktlicher Grundlage und/oder Umverteilung von Einkommen und Vermögen befasst sind, ist einfach. Für andere Produzenten, die unter der Kontrolle des Staates Geschäfte abwickeln, ist eine Bewertung ihrer Aktivitäten und Ressourcen notwendig. Um zu entscheiden, ob sie Marktproduzenten sind und ökonomisch signifikante Preise verlangen, sind die in den Nummern 20.19 bis 20.28 aufgestellten Kriterien zu prüfen. Zusammengefasst sind die Voraussetzungen wie folgt:
Die Fähigkeit, Marktaktivitäten ausführen zu können, wird hauptsächlich durch das übliche quantitative Kriterium (das 50 %-Kriterium) geprüft, unter Anwendung des Verhältnisses von Verkaufserlösen zu Produktionskosten (wie in den Nummern 20.30 und 20.31 definiert). Um Marktproduzent zu sein, muss die öffentliche Einheit wenigstens 50 % ihrer Kosten über einen aussagefähigen Mehrjahreszeitraum durch ihre Verkaufserlöse decken. |
|
20.30 |
Für den Markt-/Nichtmarkttest entspricht der Verkauf von Waren und Dienstleistungen den Verkaufserlösen, in anderen Worten der marktbestimmten Produktion (P.11) erhöht um Zahlungen für nichtmarktbestimmte Produktion (P.131), falls vorhanden. Die Produktion für die Eigenverwendung wird hierbei nicht als Teil der Verkäufe betrachtet. Ebenfalls beim Verkauf nicht eingerechnet werden alle vom Staat erhaltenen Zahlungen, sofern sie nicht jedem Produzenten gewährt werden, der die gleiche Tätigkeit durchführt. |
|
20.31 |
Die Produktionskosten sind die Summe aus Vorleistungen, Arbeitnehmerentgelt, Abschreibungen und sonstigen Produktionsabgaben. Für den Markt-/Nichtmarkttest werden die Produktionskosten um die Nettozinsbelastung erhöht und um den Wert der gesamten unterstellten Produktion, namentlich der Produktion für die Eigenverwendung, gemindert. Produktionssubventionen werden nicht abgezogen. |
Finanzielle Mittlertätigkeit und die Abgrenzung des Staates
|
20.32 |
Der Fall von Einheiten, die finanziellen Tätigkeiten nachgehen, bedarf einer besonderen Betrachtung. Die finanzielle Mittlertätigkeit von Einheiten besteht darin, im Rahmen von finanziellen Transaktionen für eigene Rechnung Forderungen zu erwerben und gleichzeitig Verbindlichkeiten einzugehen. |
|
20.33 |
Ein finanzieller Mittler geht durch das Eingehen von Verbindlichkeiten auf eigene Rechnung selbst Risiken ein. Wenn beispielsweise eine öffentliche finanzielle Einheit Vermögen verwaltet, aber kein Risiko trägt, weil sie keine Verbindlichkeiten eingeht, ist sie kein finanzieller Mittler und wird nicht dem Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften, sondern dem Sektor Staat zugerechnet. |
|
20.34 |
Die Anwendung des quantitativen Kriteriums des Markt-/Nichtmarkttests auf öffentliche Kapitalgesellschaften, die als finanzielle Mittler tätig sind oder Vermögen verwalten, ist im Allgemeinen nicht von Belang, da deren Einnahmen sowohl aus Vermögenseinkommen als auch aus Umbewertungsgewinnen stammen. |
Grenzfälle
Öffentlich kontrollierte Hauptverwaltungen
|
20.35 |
Öffentlich kontrollierte Hauptverwaltungen sind Einheiten, deren Hauptfunktion darin besteht, eine Gruppe von Tochterunternehmen zu kontrollieren und ihre Gesamtleitung wahrzunehmen. Es werden zwei Fälle unterschieden:
|
|
20.36 |
Die hier benutzte Bezeichnung „öffentlich kontrollierte Hauptverwaltung“ umfasst auch Einheiten, die als „öffentliche Holdinggesellschaften“ bezeichnet werden. |
|
20.37 |
Tochterunternehmen in der Gruppe, die produzieren und über eine vollständige Rechnungsführung verfügen, gelten auch dann als institutionelle Einheiten, wenn sie ihre Entscheidungsfreiheit der zentralen Organisation unterstellt haben (siehe Nummer 2.13). Der Markt-/Nichtmarkttest wird auf der Ebene der einzelnen Einheit angewandt. So kann es geschehen, dass ein Tochterunternehmen im Gegensatz zu den anderen als Nichtmarktunternehmen eingestuft und dem Sektor Staat zugerechnet wird. |
Pensionseinrichtungen
|
20.38 |
Pensionseinrichtungen der Arbeitgeber sind Regelungen zur Bereitstellung von Alterssicherungsleistungen für die Teilnehmer auf der Grundlage einer vertraglichen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Zu diesen Systemen gehören kapitalgedeckte, nicht kapitalgedeckte und teilweise kapitalgedeckte Pensionseinrichtungen. |
|
20.39 |
Ein System mit im Voraus festgelegten Beiträgen, das von einer staatlichen Einheit verwaltet wird, wird nicht als Sozialversicherungssystem behandelt, wenn es ohne staatliche Garantie für die Höhe der zu zahlenden Leistungen der Alterssicherung arbeitet, und wenn die Höhe der Leistungen der Alterssicherung ungewiss ist, da sie von der Ertragskraft der Vermögenswerte abhängt. Deshalb wird die Einheit, die das System — sowie die Leistungen selbst, wenn es sich dabei um eine gesonderte institutionelle Einheit handelt — verwaltet, als finanzielle Kapitalgesellschaft betrachtet und dem Teilsektor Versicherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen zugeordnet. |
Quasi-Kapitalgesellschaften
|
20.40 |
Quasi-Kapitalgesellschaften sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die wie Kapitalgesellschaften geführt werden. Quasi-Kapitalgesellschaften werden als Kapitalgesellschaften behandelt: das heißt, aufgrund ihres speziellen wirtschaftlichen und finanziellen Verhaltens als getrennt von den Einheiten, zu denen sie gehören. Somit werden von staatlichen Einheiten kontrollierte und als öffentlich kontrollierte Quasi-Kapitalgesellschaften anerkannte Markteinrichtungen den Sektoren nichtfinanzielle bzw. finanzielle Kapitalgesellschaften zugeordnet. |
|
20.41 |
Eine staatliche fachliche Einheit bzw. eine Gruppe fachlicher Einheiten, die an der gleichen Produktionsart beteiligt ist und von einer gemeinsamen Stelle verwaltet wird, wird als öffentliche Quasi-Kapitalgesellschaft behandelt, wenn
|
|
20.42 |
Über den Betrag, der den erzielten Gewinnen einer Quasi-Kapitalgesellschaft während eines bestimmten Rechnungszeitraums entnommen wird, entscheidet der Eigentümer. Eine solche Entnahme ist gleichbedeutend mit der Gewinnausschüttung einer Kapitalgesellschaft an ihre Anteilseigner. Anhand des entnommenen Gewinns bestimmt sich die Höhe der von der Quasi-Kapitalgesellschaft einbehaltenen Gewinne. Der Eigentümer kann mehr Kapital in das Unternehmen investieren oder aus diesem Kapital abziehen, indem er einige von dessen Aktiva veräußert, und solche Kapitalströme müssen auch immer in den Konten erscheinen, wenn sie eintreten. In die Quasi-Kapitalgesellschaft fließende Investitionen und Vermögenseinkommen werden in der gleichen Weise gebucht wie vergleichbare Transaktionen in Kapitalgesellschaften. Insbesondere werden Investitionszuschüsse als Vermögenstransfers gebucht. |
|
20.43 |
Die produzierenden Einheiten, die nicht als Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt werden, bleiben den staatlichen Einheiten zugeordnet, denen sie gehören. Einheiten des Staates bestehen zwar weitgehend aus Nichtmarktproduzenten, innerhalb einer staatlichen Einheit kann es aber Markteinrichtungen geben. Die Umsätze dieser Markteinrichtungen kommen zu den Nebenverkäufen hinzu, bei denen es sich um von Nichtmarkteinrichtungen zu wirtschaftlich signifikanten Preisen verkaufte Nebenproduktion handelt. Dadurch kann für eine staatliche Einheit ein Nicht-Null-Nettobetriebsüberschuss entstehen: der von Marktunternehmen erwirtschaftete Nettobetriebsüberschuss. |
Restrukturierungsstellen
|
20.44 |
Einige öffentliche Einheiten sind mit der Restrukturierung von Kapitalgesellschaften befasst. Dies betrifft vom Staat kontrollierte und nicht vom Staat kontrollierte Kapitalgesellschaften. Bei diesen Restrukturierungsstellen kann es sich um seit langem bestehende öffentliche Einheiten oder speziell zu diesem Zweck geschaffene Stellen handeln. Der Staat finanziert die Restrukturierung auf verschiedene Weise: direkt mittels Kapitalzuführungen, z. B. Vermögenstransfer, Darlehen oder Erwerb von Anteilsrechten, oder indirekt durch die Übernahme von Bürgschaften. Die wichtigsten Kriterien für die Sektorzuordnung der Restrukturierungsstellen lauten, ob solche Gremien finanzielle Mittler sind, die Haupttätigkeit Marktcharakter besitzt und welches Risiko die öffentliche Stelle übernimmt. In vielen Fällen ist das Risiko für die Restrukturierungsstelle gering, weil sie mit finanzieller Unterstützung der öffentlichen Hand und im Auftrag des Staates arbeitet. Restrukturierungsstellen können sich mit Privatisierung oder Entschuldung befassen. |
Privatisierungsstellen
|
20.45 |
Die erste Art der Restrukturierungsstelle leitet die Privatisierung von Einheiten des öffentlichen Sektors. Dabei treten zwei Fälle auf:
|
Auffanggesellschaften
|
20.46 |
Die zweite Form der Restrukturierungsstelle befasst sich mit wertgeminderten Vermögenswerten und wird etwa in einer Banken- oder sonstigen Finanzkrise errichtet. Solche Stellen werden als Auffanggesellschaften oder „Bad Banks“ bezeichnet. Eine Restrukturierungsstelle wird nach dem von ihr übernommenen Risiko unter Berücksichtigung des Umfangs der finanziellen Unterstützung seitens des Staates bewertet. Üblicherweise erwirbt die Restrukturierungsstelle mit (direkter oder indirekter) finanzieller Unterstützung durch den Staat Vermögenswerte zu höheren Preisen als marktüblich. Aus ihren Maßnahmen ergibt sich eine Umverteilung von Vermögen und Einkommen. Setzt sich die Auffanggesellschaft selbst dabei keinem Risiko aus, wird sie dem Sektor Staat zugeordnet. |
Zweckgesellschaften
|
20.47 |
Zweckgesellschaften, auch als „Mantelgesellschaften“ bezeichnet, können von Regierungen oder privaten Einheiten aus finanziellen Gründen eingerichtet werden. Die Zweckgesellschaft kann an finanzpolitischen Aktivitäten beteiligt sein, etwa an der Verbriefung von Vermögenswerten, einer Kreditaufnahme im Namen des Staates usw. Solche Zweckgesellschaften sind, wenn sie gebietsansässig sind, keine gesonderten institutionellen Einheiten. Diese Einheiten werden nach der Haupttätigkeit ihres Eigentümers klassifiziert, und Zweckgesellschaften, die finanzpolitische Aktivitäten ausführen, werden dem Sektor Staat zugerechnet. |
|
20.48 |
Gebietsfremde Zweckgesellschaften werden als separate institutionelle Einheiten erfasst. Sämtliche gemeinsamen Ströme und Bestandspositionen des Sektors Staat und der gebietsfremden Zweckgesellschaft werden in den Konten für den Sektor Staat und der Zweckgesellschaft gebucht. Darüber hinaus werden Transaktionen in den Konten sowohl des Sektors Staat als auch der gebietsfremden Einheit unterstellt, um die finanzpolitischen Tätigkeiten des Staates darzustellen, wenn eine solche gebietsfremde Zweckgesellschaft Kredite für den Staat aufnimmt oder Ausgaben des Staates im Ausland vornimmt, auch wenn zu diesen finanzpolitischen Tätigkeiten keine Ströme zwischen Staat und Zweckgesellschaft erfasst werden. Wenn eine gebietsfremde Zweckgesellschaft ein Verbriefungsgeschäft ohne den Verkauf eines Vermögenswerts tätigt, wird der Vorgang als Kreditaufnahme durch den Staat angesehen. Die wirtschaftliche Substanz dieser Transaktion wird erfasst, indem die Kreditaufnahme durch den Staat von der gebietsfremden Zweckgesellschaft zu genau dem Wert und Zeitpunkt unterstellt wird, zu dem die Zweckgesellschaft eine Verbindlichkeit gegenüber dem ausländischen Kreditgeber eingeht. |
Gemeinschaftsunternehmen
|
20.49 |
Viele öffentliche Einheiten schließen Vereinbarungen mit privaten Einrichtungen oder anderen öffentlichen Einheiten ab, um vielfältige Tätigkeiten gemeinsam durchzuführen. Die Tätigkeiten können zu einer marktbestimmten oder nichtmarktbestimmten Produktion führen. Bei gemeinsamen Unternehmungen lassen sich drei Haupttypen unterscheiden: gemeinschaftlich geführte Einheiten, die als Joint Venture bezeichnet werden; gemeinschaftlich geführte Tätigkeiten; und Vermögenswerte unter gemeinschaftlicherKontrolle. |
|
20.50 |
Ein Joint Venture setzt die Gründung einer Kapitalgesellschaft, Partnerschaft oder sonstigen institutionellen Einheit voraus, in der jede Partei an der gemeinschaftlichen Führung der Tätigkeiten der Einheit teilhat. Als institutionelle Einheit kann das Joint Venture Verträge in eigenem Namen eingehen und für eigene Zwecke Finanzierungen durchführen. Ein Joint Venture führt eigene Bücher. |
|
20.51 |
In der Regel genügt es, die Eigentumsverhältnisse zu betrachten. Besitzt jeder Eigentümer einen gleich hohen Anteil an dem Joint Venture, müssen die anderen Kriterien für die Kontrolle herangezogen werden. |
|
20.52 |
Öffentliche Einheiten können auch gemeinsame Arbeitsmechanismen vereinbaren, die nicht von eigenständigen institutionellen Einheiten betrieben werden. In diesem Falle bedarf es keiner Zuordnung von Einheiten, aber es ist darauf zu achten, dass die Eigentumsverhältnisse korrekt gebucht werden und alle Aufteilungsvereinbarungen zu Einnahmen und Ausgaben entsprechend dem Hauptvertrag getroffen werden. So können etwa zwei Einheiten vereinbaren, für unterschiedliche Abschnitte des gemeinschaftlichen Produktionsprozesses zuständig zu sein, oder eine Einheit kann einen Vermögenswert oder einen Komplex von Vermögenswerten besitzen, aber beide Einheiten vereinbaren, die Einnahmen und Ausgaben untereinander zu teilen. |
Marktordnungsstellen
|
20.53 |
Öffentliche Stellen, die im Bereich der Landwirtschaft tätig sind, tun dies auf zweierlei Art:
Im ersteren Fall wird die institutionelle Einheit, sofern sie als Marktproduzent auftritt, dem Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft (S.11) zugerechnet. Im zweiten Fall wird die institutionelle Einheit dem Sektor Staat (S.13) zugeordnet. |
|
20.54 |
Führt die Marktordnungsstelle beide in Nummer 20.53 erläuterten Tätigkeiten aus, wird sie in zwei institutionelle Einheiten entsprechend der Haupttätigkeit aufgeteilt, wobei eine dem Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11) und die andere dem Sektor Staat (S.13) zugeordnet wird. Sollte es sich als schwierig erweisen, die Institution in dieser Weise zu teilen, wird grundsätzlich der übliche Test zur Sektorzuordnung anhand des Kriteriums einer „Haupttätigkeit“ auf der Grundlage der Kosten angewendet. Stehen die Kosten signifikant im Zusammenhang mit der marktordnenden Tätigkeit, wird die Einheit zum Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften gezählt. Für das Verhältnis der Kosten zum Verkauf wird eine 80 %-Schwelle empfohlen. Liegt das mit der Ordnungsfunktion verbundene Kosten-/Verkaufs-Verhältnis unterhalb dieser Schwelle, wird die Einheit dem Sektor Staat (S.13) zugerechnet. |
Supranationale Stellen
|
20.55 |
Einige Länder sind einer institutionellen Vereinbarung beigetreten, mit der sie sich einer supranationalen Stelle anschließen. Normalerweise beinhaltet eine solche Vereinbarung Transferzahlungen der zugehörigen Länder an die supranationale Stelle und umgekehrt. Die supranationale Stelle führt auch nichtmarktbestimmte Produktion durch. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der zugehörigen Länder erscheinen die supranationalen Stellen als gebietsfremde institutionelle Einheiten, die einem speziellen Teilsektor des Sektors übrige Welt zugeordnet werden. |
Die Teilsektoren des Sektors Staat
|
20.56 |
Je nach den verwaltungsmäßigen und rechtlichen Vereinbarungen bestehen in einem Land im Allgemeinen mehrere staatliche Ebenen. In Kapitel 2 sind drei staatliche Ebenen aufgeführt: Bund (Zentralstaat), Länder und Gemeinden. Neben diesen staatlichen Ebenen müssen wegen des Bestehens und des Umfangs der Sozialversicherung und deren Rolle in der Steuerpolitik Statistiken für alle Sozialversicherungseinheiten als gesonderter vierter Teilsektor des Sektors Staat zusammengestellt werden. Nicht alle Länder verfügen über alle Ebenen; in einigen besteht nur ein Zentralstaat oder ein Zentralstaat und eine tiefere Ebene. In Ländern mit mehr als drei Ebenen sollten alle Einheiten jeweils einer der vorstehend genannten Ebenen zugeordnet werden. |
Bund (Zentralstaat)
|
20.57 |
Der Teilsektor Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung) (S.1311) umfasst alle staatlichen Einheiten mit einem nationalen Zuständigkeitsbereich mit Ausnahme der Sozialversicherungseinheiten. Die politische Autorität der Zentralregierung eines Landes erstreckt sich über das gesamte Hoheitsgebiet des Landes. Der Zentralstaat kann Steuern auf alle gebietsansässigen institutionellen Einheiten und auf gebietsfremde Einheiten, die im Land wirtschaftlich tätig sind, erheben. Der Zentralstaat ist üblicherweise zuständig für die Bereitstellung kollektiver Dienstleistungen für die Allgemeinheit als Ganzes, wie etwa die nationale Verteidigung, Außenbeziehungen, öffentliche Ordnung und Sicherheit, sowie für die Regulierung des Sozial- und Wirtschaftssystems des Landes. Zudem kann er Ausgaben für die Bereitstellung von Dienstleistungen wie Bildung oder Gesundheit, vorrangig für private Haushalte, tätigen und Transferzahlungen an andere institutionelle Einheiten, darunter an andere staatliche Ebenen, vornehmen. |
|
20.58 |
Die Zusammenstellung von Statistiken für den Zentralstaat ist wichtig wegen der speziellen Rolle, die er für die Analyse der Wirtschaftspolitik spielt. Finanzpolitik wirkt auf den inflatorischen oder deflatorischen Druck in der Wirtschaft vor allem durch den Zentralstaat. Maßnahmen zu landesweiten Wirtschaftszielen werden im Allgemeinen von Entscheidungsgremien auf der Ebene des Zentralstaats formuliert und umgesetzt. |
|
20.59 |
Der Teilsektor Zentralstaat ist in den meisten Ländern groß und komplex. Er umfasst in aller Regel eine zentrale Gruppe von Körperschaften oder Ministerien, die eine einzelne institutionelle Einheit bilden, sowie sonstige Gremien, die unter der Führung des Zentralstaates mit eigener Rechtspersönlichkeit und so viel Autonomie, dass sie zusätzliche zentralstaatliche Einheiten bilden, arbeiten. |
|
20.60 |
Die Hauptgruppe oder der wichtigste Zentralregierungsposten wird auch als budgetärer Zentralstaat bezeichnet, womit betont wird, dass der „Haushalt“ ein wesentlicher Punkt des zentralen Rechnungslegungsberichts dieser Stelle ist. Dies deutet darauf hin, dass sich die zugrunde liegende institutionelle Einheit des Zentralstaates implizit durch den Haushalt abgrenzt. Auch sie wird gelegentlich als „Staat“ bezeichnet, sollte aber nicht mit dem Konzept der nachgeordneten staatlichen Einheiten verwechselt werden wie z. B. Provinzen, Bundesländer, Kantone, Republiken, Präfekturen oder Verwaltungsregionen in einem föderalen Regierungssystem. Bei der Darstellung der vollständigen Kontenabfolge für den budgetären Zentralstaat ist es oft sinnvoll, die Tätigkeit der außerbudgetäre Fonds, wenn diese nicht als institutionelle Einheiten eingestuft werden, und generell alle nicht im Haushaltsplan erfassten Vorgänge der Staatskasse einzubeziehen. |
|
20.61 |
Der andere Bestandteil des Zentralstaates besteht aus sonstigen Stellen des Zentralstaats, auch als außerbudgetäre Einheiten bezeichnet, beispielsweise außerbudgetäre staatliche Stellen oder Einrichtungen, die als institutionelle Einheiten, öffentliche Nichtmarktunternehmen mit Rechtspersönlichkeit sowie öffentlich kontrollierte Nichtmarktorganisationen ohne Erwerbszweck eingeordnet werden. |
|
20.62 |
Der Zentralstaat lässt sich in zwei Komponenten aufgliedern: budgetärer Zentralstaat und sonstige Stellen des Zentralstaats. Diese Unterteilung ist eine Ermessensfrage und kann durch praktische Erwägungen beeinflusst werden. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die institutionelle Abdeckung des „Haushalts“. Allerdings sollte die konkrete Aufteilung den Erstellern auf der nationalen Ebene genau bekannt und zwischen diesen abgestimmt sein, um die Einheitlichkeit der Ausgangsdaten zu gewährleisten. Die Möglichkeit, eine vollständige Kontenabfolge für diese beiden „Teilsektoren“ des Zentralstaats zu erstellen, ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Datenqualität. |
Länder
|
20.63 |
Der Teilsektor Länder (ohne Sozialversicherung) (S.1312) besteht aus allen staatlichen Einheiten in einem föderalen Regierungssystem, die über einen staatlichen oder regionalen Zuständigkeitsbereich verfügen, möglicherweise mit Ausnahme von Sozialversicherungseinheiten. Ein Bundesland ist das größte geografische Gebiet, in das das Land als Ganzes zu politischen oder verwaltungstechnischen Zwecken unterteilt wird. Solche Gebiete werden z. B. als Provinzen, Bundesländer, Kantone, Republiken oder Verwaltungsbezirke bezeichnet. Sie alle besitzen in ausreichendem Maße die in einem föderalen Regierungssystem notwendige Macht. Die gesetzgebende, rechtsprechende und ausübende Gewalt eines Bundeslandes erstreckt sich über dessen gesamtes Gebiet, das für gewöhnlich zahlreiche Ortschaften umfasst, aber nicht auf andere Bundesländer. In vielen Ländern gibt es keine Bundesländer. In föderalen Staaten können Bundesländern erhebliche Befugnisse und Zuständigkeiten übertragen werden, und die Zusammenstellung eines Teilsektors Länder ist in solchen Fällen angemessen. |
|
20.64 |
Ein Bundesland besitzt in der Regel die finanzpolitische Befugnis, von institutionellen Einheiten, die in seinem Zuständigkeitsbereich ansässig sind oder Wirtschaftstätigkeiten durchführen, Steuern zu erheben. Um als staatliche Einheit behandelt zu werden, muss es Eigentümer von Vermögenswerten sein, sich Mittel beschaffen und im eigenen Namen Verbindlichkeiten eingehen können. Ferner muss es das Recht haben, zumindest einen Teil der Steuern oder des sonstigen Einkommens, das es erzielt, nach eigener Maßgabe auszugeben oder zu verteilen. Die Einheit kann jedoch Transferleistungen vom Zentralstaat erhalten, die an einen bestimmten Zweck gebunden sind. Ein Bundesland kann Organe unabhängig von einer externen administrativen Kontrolle bestellen. Wenn eine in einem Bundesland tätige staatliche Einrichtung völlig auf Mittel des Zentralstaats angewiesen ist und wenn der Zentralstaat außerdem darüber bestimmt, wie diese Mittel auszugeben sind, dann ist die Einrichtung eine Stelle des Zentralstaates. |
Gemeinden
|
20.65 |
Der Teilsektor Gemeinden (ohne Sozialversicherung) (S.1313) besteht aus staatlichen Einheiten mit einem örtlich begrenzten Zuständigkeitsbereich (mit der möglichen Ausnahme von Sozialversicherungseinheiten). Gemeinden erbringen in der Regel ein breites Spektrum von Dienstleistungen für Ortsansässige, die unter Umständen zum Teil durch Zuschüsse höherer staatlicher Ebenen finanziert werden. Die Statistiken für Gemeinden erfassen eine Vielzahl unterschiedlicher staatlicher Einheiten, wie etwa Kreise, Gemeinden, Groß- und Kleinstädte, Stadtgebiete, Stadtbezirke, Schulbezirke sowie Wasser-/Abwasserbezirke. Oft haben Gemeindeeinheiten mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen Verfügungsgewalt über dieselben geografischen Gebiete. Beispielsweise haben getrennte staatliche Einheiten, die eine Stadt, einen Kreis bzw. einen Schulbezirk darstellen, Verfügungsgewalt über dasselbe Gebiet. Auch können zwei oder mehr benachbarte Gemeinden eine staatliche Einheit mit regionaler Verfügungsgewalt bilden, die den Gemeinden gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Diese Einheiten werden dem Teilsektor Gemeinden zugeordnet. |
|
20.66 |
Die gesetzgebende, rechtsprechende und ausführende Gewalt von Gemeindeeinheiten beschränkt sich auf die kleinsten geografischen Gebiete, die für administrative und politische Zwecke unterschieden werden. Sie haben im Allgemeinen wesentlich geringere Befugnisse als der Zentralstaat oder ein Bundesland und können unter Umständen von in ihrem Zuständigkeitsgebiet ansässigen institutionellen Einheiten oder auf dort stattfindende Wirtschaftstätigkeiten Steuern erheben. Sie sind oft von Zuschüssen höherer staatlicher Ebenen abhängig und werden bis zu einem gewissen Grad als Bevollmächtigte des Zentralstaates oder der Länder tätig. Um als institutionelle Einheiten behandelt zu werden, müssen sie jedoch das Recht haben, Eigentümer von Vermögenswerten zu sein, sich Mittel zu beschaffen und durch die Mittelaufnahme in ihrem eigenen Namen Verbindlichkeiten einzugehen. Ferner müssen sie über die Verwendung dieser Mittel entscheiden können und sollten in der Lage sein, ihre eigenen Organe unabhängig von einer externen administrativen Kontrolle zu bestellen. |
Sozialversicherung
|
20.67 |
Der Teilsektor Sozialversicherung (S.1314) besteht aus allen Sozialversicherungseinheiten, und zwar unabhängig von der staatlichen Ebene, die die Systeme betreibt oder führt. Erfüllt ein Sozialversicherungssystem nicht die Bedingungen für eine institutionelle Einheit, würde es mit seiner Muttereinheit einem der anderen Teilsektoren des Sektors Staat zugeordnet werden. Wenn öffentliche Krankenhäuser eine nichtmarktbestimmte Dienstleistung für die Allgemeinheit erbringen und von Sozialversicherungssystemen kontrolliert werden, werden sie zum Teilsektor Sozialversicherung gezählt. |
DIE DARSTELLUNG DER STAATLICHEN FINANZSTATISTIKEN
Bezugsrahmen
|
20.68 |
Die Erfahrung hat gezeigt, dass für den Sektor Staat eine andere Darstellung als die ESVG-Kontenabfolge im zentralen Rahmen für bestimmte Analyseanforderungen besser geeignet ist. Diese Alternative wird als Darstellung der staatlichen Finanzstatistiken (GFS) bezeichnet. In dieser abweichenden, jedoch nach wie vor integrierten Darstellung der Konten des Sektors Staat werden folgende Messgrößen der staatlichen Wirtschaftsaktivität erfasst: Einnahmen, Ausgaben, Defizit/Überschuss, Finanzierung, sonstige wirtschaftliche Stromgrößen und Vermögensbilanz. |
|
20.69 |
Die auf dem ESVG basierende Darstellung der GFS besteht aus den in den verschiedenen ESVG-Konten (Laufende Transaktionen, Vermögensbildungskonto und Finanzierungskonto) erfassten Transaktionen, die für nicht-finanzielle Transaktionen in einer einzigen Kontendarstellung neu zusammengestellt werden, die sich besser für die finanzpolitische Analyse eignet. |
|
20.70 |
In den staatlichen Finanzstatistiken werden die Einnahmen definiert als Aggregat aus allen unter Aufkommen im ESVG-Bezugsrahmen gebuchten Transaktionen und empfangenen Subventionen in den Transaktionskonten sowie empfangenen Vermögenstransfers, die im Vermögensbildungskonto gebucht sind. Ausgaben sind ein Aggregat aus allen unter Verwendung und unter geleisteten Subventionen in den Transaktionskonten gebuchten Transaktionen sowie den im Vermögensbildungskonto gebuchten Investitionsausgaben (Bruttoinvestitionen zuzüglich geleisteter Vermögenstransfers). Diese Messgrößen der Einnahmen und Ausgaben sind spezifisch für die Darstellung der GFS, doch die zugrunde liegenden Transaktionen sind die des ESVG. |
|
20.71 |
Der Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben, der dem Konzept Überschuss/Defizit entspricht, ist der Finanzierungssaldo (B.9). Die Finanzierung des Finanzierungssaldos wird in dem Finanzierungskonto dargestellt, in dem die Nettozugänge an finanziellen Aktiva sowie der Nettozugang an Passiva gebucht werden. Einnahmen oder Ausgaben stehen entsprechende Einträge im Finanzierungskonto gegenüber. Auch Finanzierungsvorgänge können zu einer Doppelbuchung im Finanzierungskonto führen. Darin spiegelt sich das Prinzip der doppelten Buchführung wider, demzufolge für jede Transaktion eine entsprechende Transaktion im Finanzierungskonto gebucht wird. Im Prinzip lässt sich der Finanzierungssaldo auch aus den Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten ableiten. |
|
20.72 |
Die nachstehende Tabelle zeigt die Darstellung der staatlichen Finanzstatistiken:
|
|||||||||||||||||||||||
|
20.73 |
Im GFS-System bestehen weitere Konten für sonstige wirtschaftliche Stromgrößen und Vermögensbilanzen, die im Einklang mit der ESVG-Kontenabfolge stehen. Solche Konten ermöglichen einen vollständigen Abgleich der Veränderung in der Bilanz mit den Strömen während des Rechnungszeitraums. Für jeden Aktiv- bzw. Passivposten kann folgende Gleichung erstellt werden:
|
|
20.74 |
Aus der Bilanz gehen die Gesamtbestände an Aktiva — sowohl Vermögensgüter als auch Forderungen — und der Bestand an Verbindlichkeiten hervor, woraus sich Folgendes ableiten lässt: das Reinvermögen als der Gesamtbestand an Vermögensgütern abzüglich des Gesamtbestands an Verbindlichkeiten, und das finanzielle Reinvermögen als Gesamtbestand an Forderungen abzüglich des Gesamtbestands an Verbindlichkeiten. |
|
20.75 |
Die staatlichen Finanzstatistiken präsentieren die Finanzlage des Staats und seiner Teilsektoren bzw. aller Gruppen von staatlichen Einheiten, und auch einzelne institutionelle Einheiten wie z. B. den budgetären Zentralstaat. |
Einnahmen
|
20.76 |
Eine Einnahmetransaktion ist dadurch gekennzeichnet, dass sie das Reinvermögen steigert und sich positiv auf den Finanzierungssaldo auswirkt. Bei den staatlichen Einnahmen überwiegen in der Regel Pflichtabgaben, die der Staat in Form von Steuern und Sozialbeiträgen erhebt. Für einige staatliche Ebenen stellen Transferzahlungen von anderen staatlichen Einheiten und Zuschüsse internationaler Organisationen eine Haupteinnahmequelle dar. Weitere allgemeine Kategorien von Einnahmen sind Vermögenseinkommen, Verkäufe von Waren und Dienstleistungen sowie sonstige Transfers außer Zuschüssen. Die Gesamteinnahmen des Staates für einen Rechnungszeitraum werden durch Addition der Transaktionseingänge wie folgt berechnet:
|
Steuern und Sozialbeiträge
|
20.77 |
Das Steueraufkommen umfasst Produktions- und Importabgaben (D.2), Einkommen- und Vermögensteuern (D.5) sowie vermögenswirksame Steuern (D.91). Die Sozialbeiträge bestehen aus den tatsächlichen Sozialbeiträgen (D.611) und den unterstellten Sozialbeiträgen (D.612). |
|
20.78 |
Die Ermittlung der Steuern und Sozialbeiträge kann schwierig sein. Die dabei auftretenden Probleme und die empfohlenen Lösungen sind im Abschnitt „Buchungsprobleme in Bezug auf den Sektor Staat“ dargelegt. Während Steuern in der ESVG-Kontenabfolge in mehreren Konten gebucht werden, sind in der Darstellung der staatlichen Finanzstatistiken alle Steuern als eine Einnahmenkategorie mit Teilklassifikationen entsprechend der jeweiligen Steuerbemessungsgrundlage ausgewiesen. Vermögensteuern sind in der Darstellung der staatlichen Finanzstatistiken in den Einkommensteuern enthalten. |
|
20.79 |
Daten zu Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen (1) werden für die Zusammenstellung der Verhältniszahlen für Steuern bzw. die Steuerlast verwendet, z. B. das Verhältnis der gesamten Steuern zum BIP, die für internationale Vergleiche herangezogen werden. In diesem Zusammenhang werden die Pflichtsozialbeiträge zusammen mit den Steuerstatistiken dargestellt und in das Aggregat der Steuerlast oder der Pflichtabgaben einbezogen. |
Verkauf
|
20.80 |
Die Verkäufe von Waren und Dienstleistungen bestehen aus der Marktproduktion (P.11) und Zahlungen für die Nichtmarktproduktion (P.131). Dazu gehört auch — es sei denn, die Daten werden für den Markt-/Nichtmarkttest (siehe Nummer 20.30) herangezogen — die Produktion für die Eigenverwendung (P.12). Der größte Teil der Produktion des Sektors Staat besteht in Waren und Dienstleistungen, die überhaupt nicht oder zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen verkauft werden. Die Verteilung einer Nichtmarktproduktion steht nicht im Einklang mit dem Einnahmenkonzept. Was die Waren und Dienstleistungen betrifft, so werden nur tatsächliche und einige spezifische unterstellte Verkäufe von Waren und Dienstleistungen zu den Einnahmen gezählt. |
|
20.81 |
Die Marktproduktion (P.11) des Staates umfasst
|
|
20.82 |
Die zuvor erwähnten Nebenverkäufe unterscheiden sich von den symbolischen Eintrittspreisen, die etwa Museumsbesucher zahlen und die üblicherweise Teilzahlungen für eine Nichtmarktproduktion (P.131) sind. Weitere bedeutende Teilzahlungen sind Zahlungen an Krankenhäuser und Schulen, wenn diese nichtmarktbestimmt tätig sind. |
|
20.83 |
Der Wert einer selbsterstellten Anlage gilt in den staatlichen Finanzstatistiken auf ESVG-Basis als Einnahme und wird unter Verkäufen ausgewiesen. Verkäufe beinhalten auch den Wert von Waren und Dienstleistungen, die als Naturallöhne oder sonstige Sachleistungen erbracht werden. |
|
20.84 |
Die Verkaufseinnahmen in den staatlichen Finanzstatistiken auf ESVG-Basis werden aus Produktionssicht behandelt: Sie unterscheiden sich nicht von der Produktion, während sich tatsächliche Verkäufe an Kunden durch Vorratsveränderungen unterscheiden. Doch solche Vorratsveränderungen fallen bei staatlichen Einheiten und anderen Nichtmarktproduzenten, die vor allem Dienstleistungen erbringen, statt Waren zu produzieren, vermutlich gering aus. Verkäufe werden zu Herstellungspreisen bewertet. Kasten 20.1 — Vom zentralen ESVG-Rahmen zu Transaktionen und Aggregaten in den staatlichen Finanzstatistiken (GFS)
Im zentralen Rahmen des ESVG ist der Finanzierungssaldo (B.9) der Kontensaldo des Vermögensbildungskontos. Der Kontensaldo des Sektors Staat in der ESVG-GFS-Darstellung entspricht dem Finanzierungssaldo (B.9). Der nachstehende Kasten erläutert die Gründe hierfür. Der zentrale ESVG-Rahmen Das erste Konto in der Abfolge ist das Produktionskonto; deshalb besteht das erste Aufkommen eines institutionellen Sektors im ESVG in seinem Produktionswert. Da die meisten vom Staat erbrachten Dienstleistungen nicht zu wirtschaftlich signifikanten Preisen verkauft werden und somit nichtmarktbestimmt sind, wird die staatliche Produktion vereinbarungsgemäß als Summe der Produktionskosten gemessen. Ähnlich werden auch die Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch, die aus den Dienstleistungen bestehen, die der Staat der Allgemeinheit in Form von allgemeiner Verwaltung, Verteidigung, Sicherheit und öffentlicher Ordnung erbringt, als Summe der Produktionskosten gemessen. Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch (P.32) entsprechen ebenfalls vereinbarungsgemäß dem Konsum (P.4) des Staates. Auch die Konsumausgaben für den Individualverbrauch der privaten Haushalte, die unmittelbar vom Staat auf Nichtmarktbasis erbracht werden, werden als Summe der Produktionskosten gemessen. Daher werden in den ESVG-Konten des Staates zwei Arten von Strömen „unterstellt“:
Jeder unterstellte Strom entspricht der Summe der tatsächlichen Ströme, den Produktionskosten. Diese beiden Arten unterstellter Ströme — auf der Aufkommens- und der Verwendungsseite — gleichen sich in der ESVG-Kontenabfolge aus. Die ESVG-GFS-Darstellung der Statistik In der ESVG-GFS-Darstellung werden die gleichen Hauptkategorien von Transaktionen herangezogen, aber vor allem auf der Grundlage der tatsächlichen Geldströme, um die Einnahmen und Ausgaben des Staates zu errechnen. Von den unterstellten Transaktionen wird nur eine Auswahl herangezogen: die unterstellten Sozialbeiträge und die Sachvermögenstransfers. Die Nichtberücksichtigung der Nichtmarktproduktion (P.132) auf der Aufkommensseite bei der Ermittlung der Einnahmen und der Konsumausgaben (P.4=P.32) und der sozialen Sachleistungen — Nichtmarktproduktion (D.631) auf der Verwendungsseite bei der Ermittlung der Ausgaben ergibt denselben Kontensaldo: den Finanzierungssaldo (B.9). Als einzige soziale Sachleistungen im GFS-Aggregat der Staatsausgaben sind die sozialen Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion für private Haushalte (D.632) berücksichtigt, da hier staatliche Einheiten tatsächlich Zahlungen leisten. Diese Transaktionen werden auch zur Summe der Produktionskosten (gleich der sonstigen Nichtmarktproduktion, P.132) addiert, um die Konsumausgaben des Sektors Staat zu ermitteln. P.3 = P.132 + D.632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Einnahmen
|
20.85 |
Sonstige laufende Einnahmen bestehen aus Vermögenseinkommen (D.4), sonstigen Subventionen (D.39) und sonstigen laufenden Transfers (D.7). |
|
20.86 |
Vermögenseinkommen besteht aus Zinsen (D.41), Ausschüttungen und Entnahmen (Gewinnausschüttungen und -entnahmen von Quasi-Kapitalgesellschaften) (D.42) und, in beschränkterem Umfang, aus reinvestierten Gewinnen aus Direktinvestitionen (D.43), sonstigen Kapitalerträgen (D.44) und Pachteinkommen (D.45). |
|
20.87 |
Sonstige laufende Transfers (D.7) umfassen vor allem innerstaatliche Transferleistungen. Sie werden bei der Erstellung der Konten des Sektors insgesamt konsolidiert. |
|
20.88 |
Sonstige Vermögenseinnahmen umfassen Investitionszuschüsse (D.92) und sonstige Vermögenstransfers (D.99) von anderen Einheiten, überwiegend von anderen staatlichen Einheiten (auch wenn eine Konsolidierung, die bei der Darstellung der Statistiken vorgenommen wird, deren nominalen Umfang verringern könnte) und EU-Organen, aber auch von verschiedenen anderen Einheiten, beispielsweise Rückzahlungen von einem Schuldner im Anschluss an die Aktivierung einer Garantie. |
|
20.89 |
Zuschüsse, die in anderen Statistiksystemen auch als Transfers ohne von einer anderen staatlichen Einheit oder einer internationalen Organisation empfangene Subventionen definiert werden, sind keine ESVG-Kategorie. Ihre Höhe sollte der Summe der folgenden Transfereinnahmen entsprechen: D.73 + D.74 + D.92, in einigen Fällen gemeinsam mit D.75 + D.99. |
|
20.90 |
Von staatlichen Einheiten empfangene Subventionen bestehen ausschließlich in sonstigen Subventionen. Wenn die Empfänger Produktionseinrichtungen sind, die zum Sektor Staat gehören, werden Gütersubventionen bei der Bewertung der Produktion und Verkäufe zu Herstellungspreisen berücksichtigt. |
Ausgaben
|
20.91 |
Eine Ausgabentransaktion wirkt sich negativ auf den Finanzierungssaldo (Finanzierungsüberschuss (+)/Finanzierungsdefizit (–))aus. Die Gesamtausgaben bestehen aus den laufenden und den Investitionsausgaben. Die laufenden Ausgaben umfassen produktionsbezogene Ausgaben (Arbeitnehmerentgelt und Vorleistungen), geleistetes Vermögenseinkommen (vor allem Zinsen) sowie Transferzahlungen (wie Sozialleistungen, laufende Zuschüsse für andere Staatsebenen und diverse andere laufende Transfers). |
|
20.92 |
Die staatlichen Ausgaben eines Rechnungszeitraums werden nach der folgenden Gleichung durch Addition geleisteter Transaktionen berechnet:
|
Arbeitnehmerentgelt und Vorleistungen
|
20.93 |
Das Arbeitnehmerentgelt und die Vorleistungen sind die staatlichen Einheiten entstehenden Herstellungskosten. |
|
20.94 |
Das Arbeitnehmerentgelt (D.1) beinhaltet die gezahlten Bruttolöhne und -gehälter (D.11) sowie Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.12), einschließlich unterstellter Sozialbeiträge, die im ESVG als Verwendungen privater Haushalte und als Aufkommen des Staates eingeordnet werden (und deshalb nicht konsolidiert werden müssen). Das Entgelt wird nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung (accrual basis) gebucht, und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem die Arbeit geleistet wird, und nicht zu dem Zeitpunkt, wenn der Lohn oder das Gehalt fällig ist bzw. gezahlt wird. Löhne und Gehälter umfassen gezahlte Ergebnisprämien und sonstige Einmalzahlungen (bei Nachzahlungen oder Vertragsverlängerung), und der relevante Buchungszeitpunkt kann schwierig zu bestimmen sein: Bei langen Beschäftigungszeiten ist dies oft der Zeitpunkt, an dem die Ergebnisprämie festgelegt wird, und nicht der Zeitraum, für den sie gelten soll. |
|
20.95 |
Vorleistungen (P.2) umfassen die während des Rechnungszeitraums im Produktionsprozess verbrauchten Waren und Dienstleistungen. Sie unterscheiden sich konzeptionell von Anschaffungen und anderen möglichen Erwerbsformen: Jede Anschaffung geht in den Vorrat ein, bis sie dann bei Verbrauch gelöscht wird. Waren und Dienstleistungen können auch von staatlichen Markt- und Nichtmarkteinrichtungen erworben werden. |
|
20.96 |
Das Konzept des Buchungszeitpunkts für die Vorleistungen ist eindeutig: wenn das Produkt im Produktionsprozess verbraucht ist. Der Buchungszeitpunkt für Anschaffungen und sonstige Erwerbsformen ist konzeptionell die Lieferung, auch wenn es hin und wieder schwierig sein kann, die Lieferzeit zu bestimmen. |
Ausgaben für Sozialleistungen
|
20.97 |
Ausgaben für Sozialleistungen bestehen in monetären Sozialleistungen (D.62), bei denen es sich überwiegend um Geldzahlungen handelt, und in sozialen Sachleistungen —gekaufte Marktproduktion (D.632). Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion — sind staatliche Ausgaben zur Finanzierung von Waren und Dienstleistungen, die von Marktproduzenten für Haushalte bereitgestellt werden. Typische Beispiele sind das Gesundheitswesen sowie von Ärzten und Apothekern bereitgestellte Waren und Dienstleistungen, die von staatlichen Einheiten im Rahmen von Sozialversicherungssystemen oder Sozialhilfeprogrammen finanziert werden. |
|
20.98 |
Nicht zu den Ausgaben für Sozialleistungen gehören soziale Sachtransfers von staatlichen Nichtmarktproduzenten an private Haushalte. Häufig produzieren staatliche Stellen Dienstleistungen und Waren und verteilen sie unentgeltlich oder zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen. Um Doppelerfassungen zu vermeiden, werden in der Darstellung der staatlichen Finanzstatistik die relevanten Produktionskosten dieser Waren und Dienstleistungen nur einmal als Ausgaben — Vorleistungen, Arbeitnehmerentgelt, sonstige Produktionsabgaben — und als Einnahmen — sonstige Subventionen — gebucht. In der ESVG-Kontenabfolge werden diese Kosten durch Buchung auf der Aufkommensseite unter Nichtmarktproduktion und dann wieder auf der Verwendungsseite unter Konsumausgaben (P.3) zur Verteilung als soziale Sachtransfers abgeglichen. Zu Analysezwecken kann es wichtig sein, ein umfassenderes Aggregat von Sozialtransfers zu berechnen, bei dem auch monetäre Sozialleistungen (D.62) zuzüglich sozialer Sachleistungen (D.63) einbezogen werden. |
|
20.99 |
Im ESVG werden an Arbeitnehmer des Staates gezahlte betriebliche Altersversorgungsleistungen auch dann als Zahlung einer laufenden Ausgabe gebucht, wenn sie als Liquidation einer Verbindlichkeit des Staates angesehen werden (siehe Abschnitt „Buchungsprobleme in Bezug auf den Sektor Staat“), und die damit zusammenhängenden Beiträge werden als Einnahmen gebucht. Bei kapitalgedeckten Systemen werden jedoch solche Beiträge und Leistungen als Finanzierungsströme angesehen, und eine Korrektur für die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8) wird den Ausgaben hinzugefügt: Sie ist gleich den als Alterssicherungs- oder sonstige Altersversorgungsleistungen empfangenen Sozialbeiträgen abzüglich der Sozialleistungen, die für Alterssicherungs- oder sonstige Altersversorgungsleistungen für die Systeme gezahlt wurden, deren Verpflichtungen als Verbindlichkeiten angesetzt werden. |
Zinsen
|
20.100 |
Zinsausgaben umfassen die fälligen Kosten für das Eingehen von Verbindlichkeiten, insbesondere für Darlehen, Schatzwechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen, aber auch Verbindlichkeiten aus Einlagen oder sonstige Instrumente, die Verbindlichkeiten des Staates sind. Zinsen werden nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung gebucht (siehe Abschnitt „Buchungsprobleme in Bezug auf den Sektor Staat“). |
|
20.101 |
Zinsausgaben sind in den auf dem ESVG basierenden staatlichen Finanzstatistiken um die unterstellten Bankdienstleistungen (FISIM) bereinigt. Die an Kreditinstitute gezahlten Zinsen auf Kredite und Einlagen werden in eine Dienstleistungskomponente (gebucht als Vorleistungen) und eine Vermögenseinkommenskomponente (gebucht als gezahlte Zinsen) aufgeteilt. Die gleiche Anpassung wird bei staatlichen Zinseinnahmen vorgenommen, die von Kreditinstituten auf Einlagen oder Kredite gezahlt werden. |
Sonstige laufende Ausgaben
|
20.102 |
Sonstige laufende Ausgaben umfassen sonstige Produktionsabgaben (D.29), Vermögenseinkommen außer Zinsen (D.4 – D.41), Einkommens- und Vermögenssteuern (D.5), sonstige laufende Transfers (D.7) und die Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8). |
|
20.103 |
Während von staatlichen Einheiten geleistete sonstige Produktionsabgaben als Staatsausgaben gebucht werden, sind Gütersteuern nicht gesondert unter Staatsausgaben ausgewiesen. Der Grund dafür ist, dass zum einen diese Abgaben für die Marktproduzenten des Staates, deren Produktion nach Herstellungspreisen bewertet wird, kein Aufkommen darstellen und sie deshalb nicht unter deren Verwendungen erscheinen, und zum anderen Gütersteuern, die in die Vorleistungen des Staates eingehen, in deren Bewertung zu Anschaffungspreisen einbezogen werden. |
Investitionsausgaben
|
20.104 |
Investitionsausgaben umfassen Vermögenstransfers in Form von Investitionszuschüssen (D.92) und sonstigen Vermögenstransfers (D.99) sowie Investitionsausgaben: Bruttoinvestitionen (P.5, bestehend aus Bruttoanlageinvestitionen — P.51g zuzüglich Vorratsveränderungen — P.52 und Nettozugang an Wertsachen — P.53) und außerdem den Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern (NP). Der Verkäufe von nicht finanziellen Vermögensgütern, wie etwa Gebäude, werden nicht als Einnahmen, sondern als negative Investitionsausgaben gebucht, wodurch sich der Finanzierungssaldo (B.9) verbessert. |
Verbindung zu den Konsumausgaben (P.3) des Staates
|
20.105 |
Die Verbindung zwischen den Ausgaben des Staates und deren Komponenten zu den Konsumausgaben (P.3) des Staates ist wichtig für Nutzer von Finanz- und sonstigen makroökonomischen Statistiken. |
|
20.106 |
Die Konsumausgaben des Staates umfassen dessen eigene Produktion (P.1) und die Ausgaben für Güter, die von Marktproduzenten direkt an private Haushalte geliefert werden (d. h. soziale Sachtransfers D.632), abzüglich der Verkaufserlöse von Gütern und Dienstleistungen (P.11+P.12+P.131). |
|
20.107 |
Die Produktion des Staates — Marktproduktion, selbsterstellte Anlagen — entspricht der Summe ihrer Produktionskosten (Arbeitnehmerentgelt, Vorleistungen, Abschreibungen und geleistete Produktionsabgaben abzüglich empfangener Subventionen), zuzüglich des von Markteinheiten des Staates erwirtschafteten Netto-Betriebsüberschusses (B.2n). |
|
20.108 |
Somit ergeben sich aus der folgenden Berechnung die Konsumausgaben mittels ausgewählter Posten der Staatsausgaben und -einnahmen sowie des Netto-Betriebsüberschusses (B.2n):
und
|
Konsumausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen (COFOG)
|
20.109 |
Eine Systematisierung von Ausgabenvorgängen mittels der Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates (COFOG) ist wesentlich für die Darstellung der Staatsfinanzen: Sie ist ein wichtiges Instrument zur Analyse der Staatsausgaben und mit Blick auf internationale Vergleiche besonders nützlich. Diese Systematisierung zeigt, zu welchem Zweck Ausgaben vorgenommen werden. Diese Zwecke weichen von der administrativen Einteilung des Staates ab, z. B. kann eine für Gesundheitsdienstleistungen zuständige administrative Einheit Tätigkeiten mit einem Bildungszweck durchführen, wie etwa die Ausbildung von Angehörigen medizinischer Berufe. Die Transaktionen des Staates müssen einer Kreuzklassifikation nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (die übliche ESVG-Systematisierung) und nach Funktionen unterzogen werden. |
|
20.110 |
Die Klassifikation COFOG beschreibt Staatsausgaben unterteilt in die nachstehenden zehn wichtigen Aufgabenbereiche und gemäß zwei zusätzlichen Ebenen in einer detaillierteren Aufschlüsselung, die hier nicht dargestellt wird. So ist beispielsweise eine zweite Ebene notwendig, um Informationen zu Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie zu Staatsausgaben für die Risiken und sozialen Erfordernisse der sozialen Sicherung zu liefern. |
|
20.111 |
Die COFOG-Klassifikation ist konsistent mit der der Unterscheidung, die zwischen vom Staat bereitgestellten, nichtmarktbestimmten kollektiven und individuellen Dienstleistungen getroffen wird: Die ersten sechs Aufgabenbereiche sowie in Teilen auch die anderen sind kollektive Dienstleistungen. Dadurch lassen sich die staatlichen Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch berechnen. Das Aggregat der Gesamtausgaben und die nach Aufgabenbereichen aufgegliederten Ausgabentransaktionen entsprechen denen in den staatlichen Finanzstatistiken des ESVG. Deshalb werden soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion (D.631) nicht berücksichtigt, die bereits bei den Produktionskosten des Staates gebucht sind. Tabelle 20.1 — COFOG — die zehn Aufgabenbereiche des Staates
|
Salden
Der Finanzierungssaldo (B.9)
|
20.112 |
Der Finanzierungssaldo (Finanzierungsüberschuss (+)/Finanzierungsdefizit (–)) des Staates (B.9) ist die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Sie ist gleich dem Saldo des Vermögensbildungskontos (B.9N) in den ESVG-Konten. Seine Höhe ist der Betrag, den der Staat als Kredit vergeben kann oder aufnehmen muss, um seine nichtfinanziellen Aktivitäten zu finanzieren. |
|
20.113 |
Der Finanzierungssaldo ist außerdem der Kontensaldo für finanzielle Transaktionen (B.9F im zentralen Rahmen). Konzeptionell entspricht dies dem Saldo des Vermögensbildungskontos, auch wenn es in der Praxis zu statistischen Abweichungen kommen kann. |
|
20.114 |
Der Begriff „Finanzierungssaldo“ ist eine Art Abkürzung. Wenn die Variable positiv ist (also eine Finanzierungskapazität aufzeigt), sollte sie als Finanzierungsüberschuss (+) bezeichnet werden; wenn sie negativ ist (also die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme aufzeigt), sollte sie als Finanzierungsdefizit (–) bezeichnet werden. |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (B.101)
|
20.115 |
Die Differenz zwischen allen Transaktionen, die das Reinvermögen im Rechnungszeitraum betreffen, ergibt den Saldo Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (B.101). |
|
20.116 |
Die Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers bietet eine nützliche Maßeinheit für die Konten und Politiken des Staates, da sie die erworbenen bzw. in den laufenden Tätigkeiten des Staates verbrauchten Mittel darstellt. |
|
20.117 |
Die Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers ist gleich dem Finanzierungssaldo zuzüglich des Nettoerwerbs nichtfinanzieller Vermögenswerte (P5 + NP) abzüglich Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss (P.51c1).
|
Finanzierung
|
20.118 |
Das Finanzierungskonto des Staates in den GFS erfasst die Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten wie in Kapitel 5 beschrieben. |
Transaktionen mit Forderungen
|
20.119 |
Bargeld und Einlagen (F.2) zeigen insbesondere Bewegungen bei staatlichen Einlagen in Banken, vor allem in Zentralbanken, die von einem Zeitraum zum anderen erheblich schwanken können, was hauptsächlich auf Aktivitäten des Finanzministeriums zurückzuführen ist. Auch andere staatliche Einheiten, z. B. Gemeinden und Sozialversicherungen, halten umfangreiche Einlagen bei Banken. |
|
20.120 |
Schuldverschreibungen (F.3) spiegeln vor allem Nettokäufe von Schatzwechseln, Anleihen oder Schuldverschreibungen wider, die von Banken, nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften oder Gebietsfremden einschließlich ausländische Staaten begeben werden; die Käufer sind überwiegend gut ausgestattete Sozialversicherungen oder sonstige Rücklagenfonds. Käufe des Staates von Schuldverschreibungen, die von anderen gebietsansässigen staatlichen Einheiten begeben werden, erscheinen unter dieser Bezeichnung in einer nichtkonsolidierten Darstellung, nicht jedoch in einer konsolidierten Darstellung, da sie dort stattdessen als Schuldentilgung behandelt werden. |
|
20.121 |
Kredite (F.4) umfassen neben Krediten für andere staatliche Einheiten die Kreditvergabe an ausländische Staaten, an öffentlich kontrollierte Kapitalgesellschaften und an Studenten. Auch die Aufhebung von Krediten spiegelt sich hier wider, und zwar mit einem entsprechenden Eintrag auf der Gegenseite unter Vermögenstransferausgaben. Vom Staat gewährte Kredite, bei denen nicht zu erwarten ist, dass sie zurückgezahlt werden, werden im ESVG als Vermögenstransfers gebucht und erscheinen somit hier nicht. |
|
20.122 |
Unter Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (F.5) wird der Nettozugang an Anteilsrechten an Kapitalgesellschaften erfasst, den staatliche Einheiten verzeichnen. Hier können Eigenkapitalzuführungen in öffentliche Kapitalgesellschaften oder Portfolioinvestitionen, Gewinne aus Privatisierungen oder Superdividenden berücksichtigt werden. Sie bestehen hauptsächlich aus folgenden Elementen:
|
|
20.123 |
Unter Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (F.8) wird die Auswirkung des im ESVG anzuwendenden Grundsatzes der periodengerechten Zurechnung erfasst, wonach Transaktionen zu buchen sind, wenn die Pflicht zur Zahlung entsteht, und nicht, wenn die Zahlung tatsächlich erfolgt, auch wenn öffentliche Konten bzw. Haushaltsbuchungen lange Zeit in den meisten Ländern auf Kassenbasis geführt wurden. Die Auswirkung auf den Finanzierungsbedarf des Staates rührt nicht unmittelbar aus dem Defizit, da in anderen Rechnungszeiträumen als dem der eigentlichen wirtschaftlichen Transaktion Staatseinnahmen zu Geld gemacht oder Staatsausgaben beglichen werden können. Zu den sonstigen Forderungen zählen auch Steuern und Sozialbeiträge sowie Beträge im Zusammenhang mit EU-Transaktionen (die vom Staat im Namen der EU gezahlt, aber von der EU noch nicht erstattet wurden), Handelskredite oder Vorschüsse für Ausgaben, etwa für Militärausrüstungen oder seltene Fälle einer Zahlung von Löhnen oder Prämien einen Monat im Voraus usw. Konzeptionell bestehen solche Vermögenswerte ihrem Wesen nach kurzzeitig und zwangsläufig verschwinden einzelne von ihnen nach einer gewissen Zeit wieder, doch die für einen Sektor, beispielsweise den Sektor Staat, erfasste Stromgröße liegt im Durchschnitt auch über einen gewissen Zeitraum hinweg über Null, da der Bestand an Forderungen in der Regel entsprechend der übrigen Wirtschaft wächst. |
|
20.124 |
In den meisten Ländern werden Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) von der Zentralbank verwaltet. Werden sie vom Staat verwaltet, werden sie im Finanzierungskonto des Staats erfasst. |
|
20.125 |
Finanzielle Transaktionen werden zum Transaktionswert gebucht, d. h. zu dem Wert in Landeswährung, zu dem die betreffenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus rein kommerziellen Gründen geschaffen, aufgelöst, übernommen oder zwischen institutionellen Einheiten ausgetauscht wurden. |
|
20.126 |
Der Transaktionswert bezieht sich jeweils auf eine bestimmte finanzielle Transaktion und die ihr gegenüberstehende Transaktion. Dieser Wert braucht nicht dem am Markt notierten Preis, einem angemessenen Marktpreis oder einem Preis zu entsprechen, der für die Mehrheit der Preise einer Gruppe von vergleichbaren oder sogar identischen Forderungen und Verbindlichkeiten gilt. Der im Finanzierungskonto zu erfassende Wert für ein auf dem Sekundärmarkt verkauftes Darlehen ist der Wert, zu dem das Darlehen verkauft wurde, und nicht der Nennwert, und der Abgleich mit dem Saldo wird in den Konten für sonstige Vermögensänderungen eingetragen. |
|
20.127 |
Wenn jedoch die gegenüberstehende Transaktion zu einer Finanztransaktion, wie beispielsweise bei einer Transferzahlung, nicht aus ökonomischen Gründen erfolgt, wird für den Transaktionswert der Marktwert der betroffenen Forderung bzw. Verbindlichkeit verwendet. Somit wird ein Kredit, der vom Staat nicht zu seinem beizulegenden Zeitwert oder Restwert, sondern zu seinem Nominalwert erworben wurde, auf einen Eintrag als Kredit in den Finanzierungskonten zum beizulegenden Zeitwert und einen als Vermögenstransfer aufgeteilt, um einem Vermögenstransfer durch den Staat Rechnung zu tragen. |
|
20.128 |
Nicht zum Transaktionswert zählen Gebühren, Provisionen und andere Entgelte für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Transaktion erbracht werden. Solche Posten werden als Kauf von Dienstleistungen gebucht. Auch Steuern gehen nicht in den Transaktionswert ein, sondern werden als Gütersteuern auf Dienstleistungen ausgewiesen. Werden im Rahmen einer finanziellen Transaktion neue Verbindlichkeiten ausgegeben, ist der Transaktionswert gleich dem Betrag der eingegangenen Verbindlichkeiten abzüglich im Voraus gezahlter Zinsen. Wird eine Verbindlichkeit aufgelöst, ist der Transaktionswert sowohl für den Gläubiger als auch für den Schuldner gleich dem Betrag, um den sich die entsprechenden Verbindlichkeiten verringern. |
Transaktionen mit Verbindlichkeiten
|
20.129 |
Transaktionen mit Verbindlichkeiten werden zu dem Wert erfasst, mit dem diese Verbindlichkeiten begeben oder getilgt werden. Dieser Wert entspricht möglicherweise nicht dem Nominalwert. Eine Transaktion mit Verbindlichkeiten umfasst die Auswirkung aufgelaufener Zinsen. |
|
20.130 |
Der Rückkauf einer Verbindlichkeit durch die entsprechende Einheit wird als Tilgung von Verbindlichkeiten und nicht als Erwerb von Forderungen gebucht. Ebenso wird auf der Ebene eines Teilsektors oder Sektors der Kauf einer von einer anderen Einheit des betreffenden Teilsektors aufgelegten Verbindlichkeit in der konsolidierten Darstellung als Tilgung einer Verbindlichkeit durch diesen Teilsektor ausgewiesen. |
|
20.131 |
Verträge über Finanzierungsleasing und öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) bedingen — wenn der Vermögenswert als Vermögenswert des Staates gebucht wird — die Erfassung einer Schuld des Leasingnehmers oder -gebers. Zahlungen zu solchen Leasing- oder ÖPP-Verträgen stellen keine Ausgabe für die vollen Beträge, sondern eine Schuldentilgung dar: Tilgung eines Kredits und Zinsausgaben. |
|
20.132 |
Finanzierungen in Form langfristiger Handelskredite oder sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten sind als Kredite einzustufen, da sie die Bereitstellung einer langfristigen Finanzierung zugunsten der aufnehmenden Partei beinhalten, die sich von einer Finanzierungsfazilität unterscheidet, die Verkäufer üblicherweise Käufern mit kurzfristigen Handelskrediten bieten. Durch die erheblich längere Zahlungsfrist übernimmt der Ersteller eine finanzielle Funktion, die sich von seiner sonstigen Tätigkeit als Produzent unterscheidet. |
|
20.133 |
Zu Beginn von „off-market“-Swapgeschäften ausgetauschte Einmalzahlungen werden als Kredite (AF.4) eingeordnet, wenn der Staat die Einmalzahlung erhält. „Off-market“-Swapgeschäfte werden in der Bilanz in eine Kreditkomponente und eine reguläre „at-the-money“-Swapkomponente aufgeteilt. |
|
20.134 |
Ähnlich wie bei Forderungen spiegeln Transaktionen mit sonstigen Verbindlichkeiten die zeitliche Auswirkung des Grundsatzes der periodengerechten Zurechnung wider, aber auf der Seite der Passiva: wenn die Ausgabe anfällt, aber noch nicht bezahlt ist, oder wenn Zahlungen im Vorgriff auf die Einnahmebuchung getätigt werden. Neben Handelskrediten, sofern sie kurzfristig sind, umfassen Verbindlichkeiten auch von der EU empfangene, aber noch nicht vom Staat an den Endempfänger ausgezahlte Beträge, vorausgezahlte Steuern oder noch nicht ausgezahlte Steuererstattungen. |
Sonstige wirtschaftliche Stromgrößen
|
20.135 |
Sowohl das Konto sonstiger realer Vermögensänderungen als auch das Umbewertungskonto der ESVG-GFS sind identisch mit den in Kapitel 6 beschriebenen Konten. Alle Veränderungen von Aktiva und Passiva, die auf Ereignisse zurückgehen, die keine wirtschaftlichen Transaktionen sind, werden in einem dieser Konten gebucht. |
Umbewertungskonto
|
20.136 |
Bei Umbewertungen handelt es sich um die gleichen wie in Kapitel 6 beschrieben. Weitere wichtige Informationen wie nachrichtlich gezeigte Posten, zum Beispiel Umbewertungen im Eigenkapital öffentlicher Kapitalgesellschaften, das von staatlichen Einheiten gehalten wird, dürften von besonderer Bedeutung und zugleich schwierig zu messen sein, weil wahrscheinlich keine Marktpreise bestehen. |
|
20.137 |
Da die Vermögensbilanz im ESVG im Idealfall (mit Ausnahme eines oder zweier spezifischer Instrumente) zum Marktwert erstellt wird, und sich Veränderungen bei den Zinssätzen in den Aktienmarktindizes widerspiegeln, kommt es zu spürbaren Veränderungen beim Wert der Bestände sowie beim Reinvermögen institutioneller Einheiten. Solche Veränderungen stellen im ESVG kein Einkommen dar und sind daher auch nicht Einnahmen oder Ausgaben des Staates; sie haben keine Auswirkung auf den Finanzierungssaldo des Staates. Sie gehen in das Umbewertungskonto ein, was zur Reinvermögensänderung durch Umbewertung (B.103) führt. Die Veränderungen beim finanziellen Reinvermögen des Staates während eines Rechnungszeitraums werden von Umbewertungen erheblich beeinflusst. Die Hauptquellen von Umbewertungen, die sich auf das finanzielle Reinvermögen auswirken, sind neben den Auswirkungen von Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten folgende:
|
|
20.138 |
Wenn die Kapitalzuführung einer staatlichen Stelle in eine öffentliche Kapitalgesellschaft als Kapitaltransfer behandelt wird, steigt die Eigenkapitalbewertung des Staatsanteils am Empfänger im Allgemeinen mit Einträgen im Umbewertungskonto und nicht im Finanzierungskonto an. |
|
20.139 |
Wenn ein bestehender Kredit bzw. Handelskredit an eine andere institutionelle Einheit verkauft wird, wird die Differenz zwischen dem Tilgungspreis und dem Transaktionspreis im Umbewertungskonto des Verkäufers und des Käufers zum Zeitpunkt der Transaktion gebucht. |
Konto sonstiger realer Vermögensänderungen
|
20.140 |
Das Konto sonstiger realer Vermögensänderungen enthält Ströme, die weder wirtschaftliche Transaktionen noch Umbewertungen darstellen. Es erfasst beispielsweise die Auswirkungen der Veränderungen in der Sektorzuordnung von Einheiten. |
|
20.141 |
Eine Abschreibung von Krediten ist, wenn sie nicht Ausdruck einer Schuldenlöschung im beiderseitigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Einvernehmen ist, keine Transaktion und wird ohne Auswirkung auf den Finanzierungssaldo im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen gebucht. |
Vermögensbilanzen
|
20.142 |
In den GFS-Konten des Sektors Staat wird die gleiche Definition für den Vermögenswert wie in Kapitel 7 verwendet. Die Zuordnung und der Wert von Forderungen und Verbindlichkeiten sind im ESVG und in den GFS auf ESVG-Basis identisch. |
|
20.143 |
Die Summe der Verbindlichkeiten kann als Schuldenstand betrachtet werden. Die Definition der Staatsverschuldung im Zusammenhang mit der Haushaltsüberwachung weicht jedoch vom Gesamtbestand der Verbindlichkeiten im ESVG und in den GFS sowohl in Bezug auf den gebuchten Umfang der Verbindlichkeiten als auch bei der Bewertung ab. |
|
20.144 |
Einige Vermögenswerte sind nur dem Staat eigen: Kulturerbe wie Denkmäler, Infrastruktur wie Straßen und Kommunikationseinrichtungen, und Anteilsrechte an öffentlichen Kapitalgesellschaften ohne gleichwertige Unternehmen im privaten Sektor. |
|
20.145 |
Auf der Passivseite werden normalerweise keine Verbindlichkeiten bezüglich Anteilsrechten und Anteilen an Investmentfonds (AF.5) erfasst. Doch auf einer niedrigeren Gliederungsstufe der Teilsektoren des Staates können Anteilsrechte als Verbindlichkeiten erscheinen, wenn Einheiten im Ergebnis des Markt-/Nichtmarkttests dem Sektor Staat zugeordnet wurden. |
|
20.146 |
Das Reinvermögen ist der Saldo (B.90) der Vermögensbilanz:
|
|
20.147 |
Eigenmittel sind die Summe aus Reinvermögen (B.90) und begebenen Anteilsrechten (AF.5). Somit werden im ESVG Eigenmittel definiert als Aktiva abzüglich Verbindlichkeiten ohne Verbindlichkeiten an Anteilsrechten, während das Reinvermögen definiert wird als Aktiva abzüglich Verbindlichkeiten einschließlich Verbindlichkeiten an Anteilsrechten. Das ESVG-Reinvermögen ist nicht dasselbe wie das Eigenkapital bzw. Reinvermögen in der betrieblichen Buchführung. Das Reinvermögen in der betrieblichen Buchführung entspricht eher dem Konzept der Eigenmittel im ESVG. |
|
20.148 |
Falls das Reinvermögen (B.90) des Sektors Staat wegen mangelnder Informationen zur Messung des Bestands an nichtfinanziellen Vermögenswerten nicht berechnet werden kann, wird das finanzielle Reinvermögen (BF.90) dargestellt, aus dem die Differenz zwischen den gesamten Forderungen und den gesamten Verbindlichkeiten hervorgeht. |
|
20.149 |
Im ESVG wird die Vermögensbilanz zum Marktwert bewertet, mit Ausnahme dreier spezifischer Instrumente: Bargeld und Einlagen (AF.2), Kredite (AF.4) und sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8). Für diese drei Kategorien ist in der Vermögensbilanz des Gläubigers und in der des Schuldners der vertraglich vereinbarte Rückzahlungsbetrag auszuweisen, und zwar auch dann, wenn ein Agio oder Disagio vereinbart wurde, einschließlich aufgelaufener Zinsen. |
|
20.150 |
Wertpapierverbindlichkeiten werden zum Marktwert bewertet. Auch wenn der Schuldner nur in Höhe des Nennwertes gebunden ist, spielt der Marktwert eine wichtige Rolle, da der Schuldner künftige Zahlungen leisten muss, deren Gegenwartswert je nach Marktrendite unterschiedlich hoch ausfällt, und der Marktwert entspricht dem Preis, den der Staat zahlen müsste, wenn er das Instrument durch Rückkauf auf dem Markt tilgen würde. |
|
20.151 |
Börsennotierte Aktien werden bei der Erstellung der Vermögensbilanz anhand des aktuellsten Börsenkurses bewertet. Nichtbörsennotierte Anteilsrechte können anhand eines Vergleichs von Kennzahlen wie Eigenmittel zum Buchwert/Marktwert der Anteilsrechte mit vergleichbaren Kategorien börsennotierter Unternehmen bewertet werden. Zur Bewertung von nichtbörsennotierten Anteilsrechten können noch andere Vorgehensweisen gewählt werden, wie etwa die Heranziehung der Eigenmittel der Kapitalgesellschaft, wodurch das Reinvermögen auf null gesetzt wird. Dieser Ansatz kann bei öffentlichen Kapitalgesellschaften mit besonderen Tätigkeiten angewandt werden, z. B. im Fall von Anteilen des Staates an Zentralbanken. Nicht empfohlen wird allerdings die Verwendung der Eigenmittel zum Buchwert ohne Korrekturen und auch nicht die Heranziehung des Nennwerts der ausgegebenen Anteilsrechte. |
Konsolidierung
|
20.152 |
Bei der Konsolidierung werden die Konten für eine Gruppe von Einheiten so dargestellt, als ob sie eine einzige Einheit bilden (Einheit, Sektor oder Teilsektor). Dabei werden Transaktionen, wechselseitige Bestandspositionen und sonstige damit in Verbindung stehende wirtschaftliche Stromgrößen zwischen den zu konsolidierenden Einheiten eliminiert. |
|
20.153 |
Die Konsolidierung ist für den Sektor Staat und seine Teilsektoren von Bedeutung. So kann die Gesamtauswirkung staatlicher Maßnahmen auf die Wirtschaft insgesamt oder die Nachhaltigkeit staatlicher Maßnahmen wirksamer beurteilt werden, wenn als Maß für die staatlichen Maßnahmen ein Paket konsolidierter statistischer Angaben dient. Um staatliche Aggregate zur Wirtschaft insgesamt ins Verhältnis zu setzen (wie im Falle des Verhältnisses Einnahmen oder Ausgaben zum BIP), ist es sinnvoll, die interne Umschichtung von Mitteln zu eliminieren und nur jene Transaktionen zu berücksichtigen, die die Grenze zu anderen Sektoren überschreiten oder Gebietsfremde betreffen. Dies gilt insbesondere für folgende Transaktionen:
|
|
20.154 |
Die Konsolidierung hat keinen Einfluss auf Kontensalden, da die konsolidierten Positionen in jedem Konto symmetrisch erscheinen. So wird beispielsweise ein Zuschuss vom Zentralstaat an die Gemeinden durch Eliminierung der Ausgabe beim Zentralstaat und der Einnahme bei der Gemeinde konsolidiert, sodass sich am Finanzierungssaldo des Sektors Staat nichts ändert. |
|
20.155 |
Bei der Konsolidierung geht es also darum, sämtliche Stromgrößen zwischen den konsolidierten Einheiten zu eliminieren, wobei man jedoch die praktischen Aspekte im Auge behalten sollte. Transaktionen im Produktionskonto wie der Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen dürfen oder können nicht konsolidiert werden. Die Entscheidung darüber, wie weit bei der Konsolidierung untergliedert werden sollte, ist auf der Grundlage der Nützlichkeit der konsolidierten Daten und der relativen Bedeutung der verschiedenen Arten von Transaktionen oder Beständen zu treffen. |
|
20.156 |
Für die Erstellung der konsolidierten Konten des Staates sieht das ESVG die Konsolidierung der folgenden wichtigen Transaktionen vor (in der Reihenfolge ihrer Bedeutung):
|
|
20.157 |
Käufe und Verkäufe von Waren und Dienstleistungen zwischen staatlichen Einheiten werden im ESVG nicht konsolidiert, weil die Konten Verkäufe auf der Basis des Produktionswertes und nicht auf Veräußerungsbasis ausweisen, sodass es schwierig ist, den Transaktionspartner für diesen Produktionswert zu ermitteln. Hinzu kommt, dass für Vorleistungen und Produktion zwei unterschiedliche Bewertungsregeln — Herstellungspreise und Anschaffungspreise — gelten, die für zusätzliche Schwierigkeiten sorgen. |
|
20.158 |
Von einer staatlichen Einheit an eine andere gezahlte Steuern oder Subventionen werden nicht konsolidiert. Steuern oder Subventionen für Güter können jedoch im System nicht konsolidiert werden, da es keinen entsprechenden Transaktionspartner im ESVG für solche Transaktionen gibt: die entsprechenden Beträge werden nicht separat als Ausgaben bzw. Einnahmen anerkannt, sondern werden in den Wert der Vorleistungen oder der Verkäufe eingerechnet oder davon ausgenommen. |
|
20.159 |
Erwerb/Veräußerung von Vermögensgütern, einschließlich zwischenstaatlicher Transaktionen mit Grundstücken, Gebäuden und Ausrüstungen, werden nicht konsolidiert, da sie bereits auf Nettobasis im Konto ausgewiesen werden: Erwerb abzüglich Veräußerungen. Nichtkonsolidierte und konsolidierte Konten weisen für diese Positionen stets gleiche Beträge aus. |
|
20.160 |
Einige Arten von Transaktionen, die zwischen zwei staatlichen Einheiten stattzufinden scheinen, werden niemals konsolidiert, da sie innerhalb des Systems zu anderen Einheiten umgeleitet werden. Zum Beispiel: Die Sozialbeiträge von Arbeitgebern werden unabhängig davon, ob sie an die Sozialversicherung oder eine staatliche Pensionseinrichtung gezahlt werden, als Teil des Arbeitnehmerentgeltes behandelt, der dann vom Arbeitnehmer an die Pensionseinrichtung gezahlt wird. Die von staatlichen Einheiten vom Entgelt ihrer Arbeitnehmer einbehaltenen und an andere staatliche Teilsektoren gezahlten Steuern, wie Lohnsteuern, werden so behandelt, als würden sie direkt vom Arbeitnehmer gezahlt. Der staatliche Arbeitgeber fungiert in diesem Fall lediglich als einziehende Stelle für die zweite staatliche Einheit. |
|
20.161 |
Die Konsolidierung ist mit praktischen Schwierigkeiten verbunden. Wird beispielsweise eine zu konsolidierende Transaktion in den Rechnungsunterlagen einer Einheit ermittelt, so wird erwartet, dass die entsprechende Transaktion in den Konten der Partnereinheit ausgewiesen wird. Das ist möglicherweise jedoch nicht der Fall, da sie eventuell in einem anderen Zeitraum ausgewiesen wird, einen anderen Wert hat, oder aufgrund anderer Rechnungslegungspraktiken als eine andere Art von Transaktion ausgewiesen wird. Diese Schwierigkeiten wohnen dem Vierfachbuchungssystem des ESVG inne, noch stärker können sie jedoch bei zwischenstaatlichen Transaktionen ins Auge fallen. |
BUCHUNGSPROBLEME IN BEZUG AUF DEN SEKTOR STAAT
|
20.162 |
Die Grundsätze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gelten für den Sektor Staat genauso wie für andere Sektoren der Wirtschaft. Aufgrund des Wirtschaftscharakters von Aktivitäten staatlicher Einheiten oder aufgrund von praktischen Erwägungen werden in diesem Abschnitt weitere Regeln vorgegeben. |
|
20.163 |
Analog dazu gelten die Grundsätze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch für die Messung der staatlichen Einnahmen und Ausgaben. Doch werden diese Grundsätze, einschließlich insbesondere des Grundsatzes der Periodenabgrenzung, angewandt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Kreditwürdigkeit und die Liquiditätszwänge des Staates grundsätzlich von denen anderer Akteure unterscheiden. Wenn in den Konten des Staates Ausgaben zu dem Zeitpunkt gebucht werden, an dem sie in den einzelnen staatlichen Einheiten anfallen, und zwar unabhängig von langen Zahlungsverzögerungen, sollten die Einnahmen in den Konten nur gebucht werden, wenn mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die entsprechenden Zahlungen tatsächlich stattfinden. |
|
20.164 |
Man muss sich bei der Klassifizierung einer Transaktion im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht notwendigerweise an die in der öffentlichen Rechnungslegung des Staates oder der Buchhaltung eines Unternehmens verwendete Bezeichnung für eine Transaktion halten. So wird beispielsweise eine aus den Rückstellungen eines Unternehmens oder aus dem Erlös des Verkaufs von Vermögenswerten an den Staat geleistete umfangreiche Zahlung, die in der öffentlichen Rechnungslegung als „Dividende“ bezeichnet wird, als Superdividende angesehen und in den VGR als Finanztransaktion gebucht — es handelt sich um eine Entnahme von Eigenkapital. Wirtschaftliche Realität vor Rechtsform ist ein Rechnungslegungsgrundsatz zur Gewährleistung der Konsistenz und um sicherzustellen, dass einander ähnliche Transaktionen zu ähnlichen Ergebnissen in den makroökonomischen Konten führen, und zwar unabhängig von den jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung. Dies ist für Transaktionen des Staates von besonderer Bedeutung. |
Steueraufkommen
Charakter des Steueraufkommens
|
20.165 |
Steuern sind Zwangsabgaben in Form von Geld- oder Sachleistungen, die von institutionellen Einheiten ohne Gegenleistung an den Staat oder supranationale Stellen, die ihre souveränen oder sonstigen Befugnisse ausüben, geleistet werden. Sie stellen im Allgemeinen den größten Teil der Staatseinnahmen dar. Steuern gelten im Gesamtrechnungssystem als Transaktionen, da sie als auf gegenseitigem Einverständnis beruhende Interaktion zwischen Einheiten angesehen werden. Sie werden als Abgaben ohne Gegenleistung angesehen, weil der Staat keine der Zahlung entsprechende Leistung an die diese Zahlung leistende einzelne Einheit erbringt. |
|
20.166 |
Es gibt jedoch Fälle, in denen der Staat für die Zahlung eine Gegenleistung an die einzelne Einheit in Form der direkten Gewährung einer Genehmigung oder Zulassung erbringt. In diesem Fall ist die Zahlung Teil eines obligatorischen Verfahrens, das die Anerkennung der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse und die rechtmäßige Durchführung von Aktivitäten gewährleistet. Die Einstufung solcher Zahlungen als Steuer oder als Verkauf einer Dienstleistung bzw. eines Vermögensguts durch den Staat erfordert zusätzliche Regeln. Diese Regeln werden in Kapitel 4 behandelt. |
Steuergutschriften
|
20.167 |
Steuervergünstigungen können in Form von Steuerfreibeträgen, einer Steuerbefreiung, eines Steuerabzugs (Abzug von der Steuerbemessungsgrundlage) oder einer Steuergutschrift (direkter Abzug von der ansonsten fälligen Steuerschuld des begünstigten privaten Haushalts oder Unternehmens) gewährt werden. Steuergutschriften können fällig werden, wenn Gutschriftbeträge, die die Steuerschuld überschreiten, an den Begünstigten ausgezahlt werden. Es gibt aber auch Steuergutschriften, die nicht zahlbar sind (die also verfallen können) und auf die Höhe der Steuerschuld begrenzt sind. |
|
20.168 |
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird eine in das Steuersystem eingebettete Steuervergünstigung als Senkung der Steuerschuld und damit als Verringerung des staatlichen Steueraufkommens gebucht werden. Das ist der Fall bei Steuerfreibeträgen, Steuerbefreiung und Steuerabzügen, da sie direkt in die Berechnung der Steuerschuld einfließen. Das gilt auch für nicht zahlbare Steuergutschriften, da sich ihr Wert für den Steuerzahler auf die Höhe seiner Steuerschuld beschränkt. Das gilt allerdings nicht für zahlbare Steuergutschriften, die definitionsgemäß sowohl Nichtsteuerzahler als auch Steuerzahler betreffen können. Da diese Art der Steuergutschriften zahlbar ist, werden sie als Ausgabe betrachtet und als solche mit ihrem Gesamtbetrag gebucht. Deshalb werden gewährte zahlbare Steuergutschriften nicht vom veranlagten staatlichen Steueraufkommen abgezogen, und sämtliche gewährten zahlbaren Steuergutschriften fallen unter die Staatsausgaben. Das hat keinerlei Auswirkungen auf den Finanzierungssaldo des Staates, wohl aber auf die Steuerlast und die Staatsausgaben sowie auf die entsprechenden Kennziffern des Verhältnisses zum BIP. Die statistische Darstellung sollte die Ableitung der Steuergutschriften auf Nettobasis erlauben. |
Zu buchende Beträge
|
20.169 |
Die ordnungsgemäße Erfassung des Steueraufkommens ist von Bedeutung für die Messung der Aktivitäten und der Leistung des Staates. Die zu buchenden Beträge sollten den wahrscheinlich vom Staat tatsächlich eingenommenen Beträgen entsprechen: Das bedeutet, dass Beträge, die erklärt wurden, aber als uneinbringlich gelten, nicht als Einnahmen gebucht werden. |
Uneinbringliche Beträge
|
20.170 |
In jedem Falle sollten lediglich Beträge gebucht werden, die vom Staat voraussichtlich tatsächlich eingenommen werden. Uneinbringliche Steuern sollten im Finanzierungssaldo des Staates nicht berücksichtigt werden und im Allgemeinen auch nicht bei den Gesamteinnahmen. Daher entspricht der Einfluss der Steuern und Sozialbeiträge, die im System periodengerecht zugerechnet werden (accrual basis), auf den Finanzierungssaldo des Staates über einen angemessenen Zeitraum hinweg den jeweiligen tatsächlich vereinnahmten Beträgen. Die für die Buchung von Steuern und Sozialabgaben geltenden Regeln werden in Kapitel 4 beschrieben. |
Buchungszeitpunkt
Periodengerechte Buchung
|
20.171 |
Bei der periodengerechten Buchung werden Stromgrößen zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem ein wirtschaftlicher Wert geschaffen, umgewandelt, ausgetauscht, übertragen oder aufgelöst wird. Sie unterscheidet sich von der Buchung zum Zahlungszeitpunkt und im Prinzip von der Buchung zum Fälligkeitszeitpunkt, bei der definitionsgemäß die Buchung zu dem spätesten Zeitpunkt vorgenommen wird, zu dem die Zahlungen erfolgen können, ohne dass zusätzliche Gebühren zu leisten sind oder Sanktionen erfolgen. Der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Zahlungsanspruch entsteht, und dem Zeitpunkt, zu dem sie tatsächlich geleistet wird, durchführt zur Buchung einer Forderung oder einer Verbindlichkeit im Finanzierungskonto. Im ESVG wird nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung (accrual basis) gebucht. Bei einigen Transaktionen wie der Zahlung von Dividenden oder bestimmten Transfers wird der Fälligkeitszeitpunkt herangezogen. |
Periodengerechte Buchung von Steuern
|
20.172 |
Für den Staat ist die Buchung von Einnahmen und Forderungen zum Zeitpunkt des zugrunde liegenden Ereignisses besonders schwierig, da in der öffentlichen Rechnungslegung die Buchung — beispielsweise bei Steuern — oftmals zum Zeitpunkt der Zahlung erfolgt. Werden die anfallenden Steuern anhand von Steuerbescheiden berechnet, so besteht die Gefahr einer Überbuchung der Steuereinnahmen, die ein entscheidendes Finanzaggregat des Staates darstellen. |
|
20.173 |
Der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Steuer in den Konten für nichtfinanzielle Transaktionen als anfallend gebucht wird, und dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung tatsächlich erfolgt, wird durch Buchung einer Forderung im Finanzierungskonto der einen Partei und als eine Verbindlichkeit im Konto der anderen Partei überbrückt. In Fällen, in denen eine sich über zwei oder mehr Rechnungslegungszeiträume erstreckende Vorauszahlung an den Staat geleistet wird, erscheint im Finanzierungskonto des Staates für die in künftigen Zeiträumen fälligen Beträge eine Verbindlichkeit — eine Art Kreditaufnahme. Diese Verbindlichkeit wird gelöscht, sobald die fälligen Beträge der Transaktion im/in den künftigen Zeitraum/räumen gebucht werden. Eine solche Verbindlichkeit wird jedoch nur dann gebucht, wenn der Staat gesetzlich oder aufgrund einer Selbstverpflichtung gehalten ist, an die zahlende Partei eine Rückzahlung für die vorab gezahlten Beträge zu leisten, sollte das steuerbare Ereignis nicht eintreten. |
|
20.174 |
Gemäß der periodengerechten Buchung werden Steuern zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem die Tätigkeiten, Transaktionen oder sonstigen Ereignisse stattfinden, durch die die Steuerverbindlichkeiten entstehen, — anders ausgedrückt, wenn die steuerbegründenden Ereignisse stattfinden — und nicht, wenn die Zahlungen fällig sind oder tatsächlich geleistet werden. Das ist gewöhnlich der Zeitpunkt, zu dem das Einkommen verdient wird oder wenn eine Transaktion (wie der Kauf von Waren und Dienstleistungen), durch die die Verbindlichkeit entsteht, stattfindet, soweit die Steuerschuld zuverlässig gemessen werden kann. Die unterschiedlichen institutionellen Vorkehrungen zur Steuererhebung (z. B. Vorliegen von Veranlagungen und Steuerlisten) können in der Praxis je nach den Merkmalen der Steuer unterschiedliche Buchungsmethoden mit sich bringen. Vor allem dann, wenn es keine zuverlässige Veranlagung gibt oder die wahrscheinlich niemals eingezogenen Beträge nicht zuverlässig geschätzt werden können, gilt die Methode der zeitlichen Bereinigung von Kasseneinnahmen daher als vertretbarer Ersatz für die periodengerechte Buchung. |
|
20.175 |
Werden Steuern auf der Grundlage von Veranlagungen erhoben, so ist in der Praxis in Fällen, in denen vor dem Zeitpunkt der Veranlagung keine zuverlässige Messung erfolgen kann, eine gewisse Flexibilität bezüglich des Buchungszeitpunkts gestattet. Vor allem bei der Einkommensteuer sehen Steuersysteme gegebenenfalls die Erstellung einer Steuerliste oder sonstigen Form der steuerlichen Veranlagung vor, bevor die fälligen Beträge zuverlässig bekannt sind, wobei die Veränderungen von Steuersätzen und Schlussabrechnungen berücksichtigt werden. Dieser Zeitpunkt, zu dem sich möglicherweise Auswirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten privater Haushalte abzeichnen, stellt einen vertretbaren Buchungszeitpunkt dar. Es ist nicht notwendigerweise der Rechnungszeitraum, in dem die Zahlung eingeht. |
Zinsen
|
20.176 |
Zinsen sind Ausgaben eines Schuldners für die Nutzung der Mittel einer anderen Einheit. Zinsen (D.41) sind der Betrag, den der Schuldner dem Gläubiger vereinbarungsgemäß während eines Zeitraums zu zahlen hat, ohne dass sich dadurch der ausstehende Kapitalbetrag verringert. |
|
20.177 |
Zinsen sind unter Vermögenseinkommen (D.4) zu klassifizieren. Anders als bei Ausschüttungen (D.421) hat der Inhaber/Kreditgeber im Falle von Zinsen (D.41) Anspruch auf ein festes und im Voraus festgelegtes Einkommen (bzw. ein sich im Falle eines variablen Zinssatzes nach einem vereinbarten Referenzwert bestimmendes Einkommen). Zinsen bilden gewöhnlich einen großen Ausgabenposten des Staates, da der Staat häufig zu den wichtigsten Kreditnehmern am Markt zählt. |
|
20.178 |
Im ESVG erfolgt die Buchung der Zinsen nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung entsprechend ihrem Auflaufen, d. h., bei der Buchung der Zinsen wird davon ausgegangen, dass die Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dem Gläubiger kontinuierlich zugehen. |
|
20.179 |
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich der Wert eines mit einem Disagio begebenen Wertpapiers während seiner Laufzeit feststellen lässt, wenn sich der vorherrschende Zinssatz von dem unterscheidet, der zum Zeitpunkt der Ausgabe des Wertpapiers bestimmend war. Dabei erfolgt der Schuldneransatz aus der Perspektive der das Papier emittierenden Einheit und der Gläubigeransatz aus der Perspektive der den Titel haltenden Einheit. Bei Schuldneransatz wird der bei Ausgabe vereinbarte Zinssatz über die gesamte Laufzeit hinweg angewendet. Beim Gläubigeransatz wird der aktuelle Zinssatz zur Bewertung der Zinsen zwischen zwei Zeitpunkten während der Laufzeit des Wertpapiers herangezogen. |
|
20.180 |
Periodengerechte Zinsen werden nach dem Schuldneransatz gebucht, d. h. auf der Basis des Zinssatzes oder der Rendite, der oder die zum Zeitpunkt der Schaffung des Finanzinstruments vorherrschte. Folglich schwanken die für festverzinsliche Schuldtitel zu buchenden Zinsausgaben im Zeitverlauf nicht analog zum Marktverhalten, obwohl der Marktwert der Schuldtitel Schwankungen unterliegt und demzufolge die Opportunitätskosten für die Aufrechterhaltung des Darlehens ebenfalls schwanken. Damit werden bei den Zinsausgaben die Schwankungen vermieden, die beim Gläubigeransatz auftreten. Der Rückkauf von Wertpapieren am Markt zu einem Agio oder Disagio im Verhältnis zum ausstehenden Kapitalbetrag hat keine Buchung zur Folge, weder bei den Einnahmen oder Ausgaben zum Zeitpunkt des Kaufs noch zu einem späteren Zeitpunkt. Stattdessen ist das Agio oder Disagio des Rückkaufs Ausdruck des im Finanzierungskonto gebuchten Ausgleichs eines in der Vergangenheit aufgelaufenen Umbewertungsgewinns oder -verlustes, der zu dem damaligen Zeitpunkt im Umbewertungskonto gebucht wurde. |
|
20.181 |
Die periodengerechte kontinuierliche Buchung der Zinsen hat beispielsweise bei Wertpapieren zur Folge, dass die aufgelaufene Zinsbelastung beginnend mit dem Zeitpunkt der Ausgabe des Wertpapiers gebucht und nicht der Zeitpunkt der ersten Kuponzahlung abgewartet wird (die im Falle eines klassischen Wertpapiers mit jährlichen Kuponzahlungen oftmals im darauffolgenden Jahr ansteht). Das bedeutet auch, dass die für Wertpapiere aufgelaufenen Zinsen als Verbindlichkeit erscheinen, sobald ausgegebene Zinsen in den zinstragenden Vermögenswert reinvestiert werden. Das hat zur Folge, dass der Bestand an aufgelaufenen ausstehenden Zinsen stets auf den Wert des Kapitals des zugrunde liegenden Instruments aufgeschlagen werden muss und damit sämtliche Zinszahlungen die Verbindlichkeiten des Schuldners verringern. Dieses Grundprinzip gilt für sämtliche zinstragenden Finanzinstrumente. |
|
20.182 |
In vielen Ländern werden staatliche Schuldverschreibungen in marktfähigen Tranchen über einen Zeitraum von mehreren Jahren ausgegeben, wobei für den Nominalzins jeweils dieselben Bedingungen gelten. Da die Marktrendite zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs der Tranchen schwankt, wird jede Tranche zu einem Agio oder Disagio verkauft. Damit wird der zum Zeitpunkt der Ausgabe der Anleihe vereinbarte Zinssatz zur Berechnung der Zinsen benutzt, wobei er für jede Tranche verschieden und Ausdruck der unterschiedlichen Amortisierung von Agios und Disagios zum Zeitpunkt der Ausgabe ist, ähnlich der Amortisation von Disagios bei Null-Kupon-Anleihen. |
|
20.183 |
Der Ausgabepreis von Schuldverschreibungen, die in marktfähigen Tranchen und mit Kupon ausgegeben werden, umfasst einen Betrag für bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufene Kupons, die praktisch bei Ausgabe „verkauft“ werden. Solche verkauften Kupons stellen weder Staatseinnahmen zum Zeitpunkt des Verkaufs dar noch werden sie als Agio behandelt. Stattdessen gelten sie als finanzielle Vorleistung. |
Anleihen mit Disagio und Null-Kupon-Anleihen
|
20.184 |
Null-Kupon-Anleihen sind Instrumente, bei denen der Schuldner bis zur Rückzahlung zu keinerlei Zahlung gegenüber dem Gläubiger verpflichtet ist. Der Betrag des aufgenommenen Kapitals ist niedriger als der Wert der Anleihe, die vom Schuldner zurückgezahlt wird. Damit entledigt sich der Gläubiger praktisch mit einer einzigen Zahlung zum Fälligkeitszeitpunkt seiner Verbindlichkeit, die sowohl den Betrag des Kapitals als auch die während der Laufzeit des Instruments aufgelaufenen Zinsen abdeckt. Die Differenz zwischen dem am Ende der Laufzeit zurückgezahlten Betrag und dem ursprünglich aufgenommenen Betrag sind die Zinsen, die über die Rechnungslegungszeiträume zwischen dem Beginn und dem Ende der Laufzeit verteilt werden. Die in jedem Zeitraum auflaufenden Zinsen sind so zu behandeln, als seien sie vom Gläubiger gezahlt und dann als Zusatzbetrag derselben Forderung reinvestiert worden. Zinsausgaben und Erhöhungen der Forderung werden dann gleichzeitig für jeden Zeitraum gebucht. |
|
20.185 |
Damit spiegelt der allmähliche Anstieg des Marktwertes einer Anleihe, der auf die Akkumulation der aufgelaufenen und reinvestierten Zinsen zurückzuführen ist, eine Erhöhung des ausstehenden Kapitalbetrags, also ein Wachstum des Vermögenswertes, wider. |
|
20.186 |
Dasselbe Prinzip gilt für Anleihen mit Disagio oder Anleihen, die mit einem Agio begeben werden. In diesem Falle ist der Betrag der gemäß Vertrag aufgelaufenen Kuponzinsen zuzüglich des Betrags, der pro Rechnungszeitraum aufgrund der Differenz zwischen Rückzahlungs- und Emissionskurs aufläuft, als Zinsausgabe zu buchen. |
Indexgebundene Wertpapiere
|
20.187 |
Indexgebundene Wertpapiere sind Finanzinstrumente, gewöhnlich Anleihen mit langer Laufzeit, bei denen die Höhe der periodischen Zahlungen und/oder des Kapitalbetrags an einen Preis- oder anderen Index gekoppelt ist. Alle zusätzlichen Zahlungen an Gläubiger aufgrund von Indexänderungen gelten als Zinsen, einschließlich der Erhöhung des Kapitalbetrags, und sind als kontinuierlich auflaufend zu buchen. Ist der Wert des Kapitalbetrags indexgebunden, so gilt die Differenz zwischen Rückzahlungs- und Emissionskurs als während der Laufzeit des Vermögenswertes auflaufende Zinsen, die zu den in diesem Zeitraum fälligen Zinsen hinzukommen. |
Finanzderivate
|
20.188 |
Die Abgeltung von Swap-Transaktionen gilt gemäß ESVG nicht als Vermögenseinkommen. Abgeltungen im Zusammenhang mit Finanzderivaten sind Finanztransaktionen, die zum Zeitpunkt des effektiven Austauschs des Finanzinstruments zu buchen sind. |
Gerichtsentscheidung
|
20.189 |
Entscheidet ein Gericht, dass aufgrund von Ereignissen in der Vergangenheit eine Entschädigung zu zahlen oder eine Transaktion rückgängig zu machen ist, so wird die Ausgabe oder Einnahme dann gebucht, wenn der Geschädigte einen automatischen und unanfechtbaren Anspruch auf einen bestimmten Betrag, der individuell zu bestimmen ist, hat und wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Geschädigte es versäumen wird, den ihm zustehenden Betrag einzufordern. Wenn ein Gericht lediglich den Entschädigungsgrundsatz begründet oder wenn von Verwaltungsdiensten geprüft werden muss, ob und in welcher Höhe ein Anspruch besteht, werden die entsprechenden Ausgaben oder Einnahmen gebucht, sobald der Wert der Verbindlichkeit zuverlässig feststeht. |
Militärausgaben
|
20.190 |
Militärische Waffensysteme, die Fahrzeuge und andere Ausrüstungen wie Kriegsschiffe, U-Boote, Militärflugzeuge, Panzer, Raketenträger und Raketenabschussvorrichtungen usw. umfassen, werden kontinuierlich bei der Produktion von Dienstleistungen der Verteidigung eingesetzt. Sie gelten so wie jene kontinuierlich länger als ein Jahr für die zivile Produktion genutzten Güter als Anlagegüter. Ihr Erwerb wird als Bruttoanlageinvestition gebucht, d.h. als Investitionsausgaben. Für die einmalige Verwendung bestimmte Positionen wie Munition, Raketen und Bomben werden als militärische Vorräte behandelt. Doch bei einigen Arten von ballistischen Raketen wird von einer kontinuierlichen Dienstleistung zum Zweck der Abschreckung ausgegangen, und sie erfüllen daher die allgemeinen Kriterien für die Klassifikation als Anlagegüter. |
|
20.191 |
Demzufolge gilt der Übergang des Eigentums an einem Anlagegut als Buchungszeitpunkt des Erwerbs dieses Guts. Im Falle von komplexen Systemen mit langfristigen Verträgen sollte die tatsächliche Lieferung der Anlagegüter und nicht der Zeitpunkt der Bezahlung als Zeitpunkt der Buchung des Eigentumsübergangs betrachtet werden. Umfassen einige langfristige Verträge auch die Erbringung von Dienstleistungen, sind die staatlichen Ausgaben zum Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistungen und getrennt von der Lieferung von Anlagegütern zu buchen. |
|
20.192 |
Wird Militärgerät geleast, so wird die Transaktion als Finanzierungsleasing und nicht als Operating-Leasing gebucht. Das bedeutet, dass die Buchung des Erwerbs eines militärischen Vermögensguts einhergeht mit der Aufnahme eines unterstellten Kredits durch den staatlichen Leasingnehmer. Das hat zur Folge, dass die Zahlungen durch den Staat als Schuldendienst, der die Tilgung des Kredits und die Zahlung von Zinsen umfasst, gebucht wird. |
Beziehungen des Staates zu öffentlichen Kapitalgesellschaften
Kapitalbeteiligung an öffentlichen Kapitalgesellschaften und Verteilung der Einkünfte
|
20.193 |
Staatliche Einheiten unterhalten enge Beziehungen zu öffentlich kontrollierten Kapitalgesellschaften oder Quasi-Kapitalgesellschaften, die ihnen gehören. Trotz dieser engen Beziehungen werden Ströme zwischen einer staatlichen Einheit und einer von ihr kontrollierten öffentlichen oder Quasi-Kapitalgesellschaft in Bezug auf Kapitalbeteiligungen in der gleichen Weise behandelt wie Ströme zwischen einer Kapitalgesellschaft und ihren Eigentümern generell: Kapitalbeteiligungen des Kapitalgebers am Kapitalnehmer; Ausschüttung von Einkünften durch den Kapitalnehmer an den Kapitalgeber. |
Kapitalbeteiligung
|
20.194 |
Bei einer Kapitalbeteiligung stellen Wirtschaftsakteure Kapitalgesellschaften Mittel zur Verfügung und erwarten im Gegenzug künftige Dividenden oder sonstige Formen der Rendite. Der investierte Betrag — die Kapitalbeteiligung — ist Teil der Eigenmittel der Kapitalgesellschaft, über die die Kapitalgesellschaft relativ frei verfügen kann. Als Gegenleistung erhalten die Eigentümer Anteile oder eine andere Form von Anteilsrechten. Sie repräsentieren Eigentumsrechte an Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, und mit diesen Rechten ist ein Anspruch verbunden auf
Somit sind die Anteilsrechte finanzielle Forderungen. |
|
20.195 |
Es muss unterschieden werden zwischen der Entnahme von Eigenkapital durch die Kapitalgesellschaft für ihren Eigentümer und der Rendite der Kapitalbeteiligung, insbesondere Einkünfte in Form von Ausschüttungen. Nur die regelmäßige Verteilung von Erträgen aus den Unternehmensgewinnen wird als Ausschüttungen und Gewinnentnahmen gebucht. Umfangreiche unregelmäßige Zahlungen an den Eigentümer werden als Entnahme von Eigenkapital gebucht. |
|
20.196 |
Es ist zu bestimmen, wann Zahlungen des Staates an öffentlich kontrollierte Kapitalgesellschaften eine staatliche Ausgabe oder eine Finanztransaktion (Erwerb eines Vermögensgutes) darstellen, und umgekehrt wann Verteilungen durch öffentlich kontrollierte Kapitalgesellschaften an den Staat Staatseinnahmen oder eine Finanztransaktion bilden. |
Kapitalzuführungen
Subventionen und Kapitalzuführungen
|
20.197 |
Subventionen sind laufende Transfers, die gewöhnlich regelmäßig vom Staat oder gelegentlich von der übrigen Welt an Produzenten geleistet werden, um den Umfang der Produktion dieser Einheiten, ihre Verkaufspreise oder die Entlohnung der Produktionsfaktoren zu beeinflussen. |
|
20.198 |
Größere und unregelmäßige Zahlungen an öffentliche Kapitalgesellschaften, die häufig als „Kapitalspritze“ bezeichnet werden, sind keine Subventionen. Sie dienen der Kapitalisierung oder Rekapitalisierung der begünstigten Kapitalgesellschaft, der sie langfristig zur Verfügung gestellt werden. Nach dem „Kapitalzuführungstest“ handelt es sich bei derartigen Kapitalzuführungen entweder um Vermögenstransfers oder den Erwerb von Anteilrechten oder eine Kombination beider Elemente. Nachfolgend die beiden Fälle:
|
|
20.199 |
In vielen Fällen sollen von staatlichen Einheiten an öffentliche Kapitalgesellschaften geleistete Zahlungen in der Vergangenheit erlittene oder künftig erwartete Verluste ausgleichen. Zahlungen des Staates werden nur dann als Erwerb von Anteilsrechten behandelt, wenn ausreichend Belege für die künftige Rentabilität der Kapitalgesellschaft und für ihre Fähigkeit zur Dividendenausschüttung gegeben sind. |
|
20.200 |
Ausgehend davon, dass Kapitalzuführungen die Eigenmittel des Kapitalnehmers erhöhen, dürften sie auch zu einer Erhöhung des Anteils des Kapitalgebers am Vermögen des Kapitalnehmers beitragen. Das trifft automatisch auf jene öffentlichen Kapitalgesellschaften zu, die sich zu 100 % in Staatsbesitz befinden und deren Eigenkapital dem Wert ihrer Eigenmittel entspricht. Eine solche Erhöhung der Anteilsrechte wird nicht als Kriterium für die Beurteilung des Charakters der Kapitalzuführung herangezogen; stattdessen hat sie einen Eintrag in das Umbewertungskonto zur Folge, wenn die Kapitalzuführung als Vermögenstransfer gebucht wurde, und einen Eintrag in die Finanzierungskonten, wenn die Finanzspritze als Aufstockung des Eigenkapitals gebucht wurde. |
Vorschriften für besondere Umstände
|
20.201 |
Eine Kapitalzufuhr im Rahmen der Privatisierung wird — wenn die Privatisierung innerhalb eines Jahres erwartet wird — als Transaktion mit Anteilsrechten in Höhe eines Betrags gebucht, der den Verkaufserlös nicht überschreitet, wobei der restliche Teil dem Kapitalzuführungstest zu unterziehen ist. Mit dem Verkaufserlös wird die Kapitalspritze abgegolten. |
|
20.202 |
Kapitalspritzen können in Form der Schuldenaufhebung oder der Schuldenübernahme erfolgen. Nach den auf diese Fälle anwendbaren Buchungsregeln ist die Zahlung ein Vermögenstransfer, es sei denn, es handelt sich um eine Privatisierung, bei der die Zahlungen einen Erwerb von Anteilsrechten darstellen, deren Wert im Rahmen der Privatisierungserlöse liegt. |
|
20.203 |
Zuführungen von Sachkapital mittels Bereitstellung von nichtfinanziellen Aktiva haben keine Auswirkungen auf den Finanzierungssaldo. Wird davon ausgegangen, dass die Zuführung eine ausreichend hohe Rendite erwirtschaftet, wird sie als Änderung der Sektorzuordnung (K.61) behandelt, wobei das zugeführte Aktivum in der Bilanz der Kapitalgesellschaft als sonstige Vermögensänderung gebucht wird. Wird die Kapitalzufuhr wahrscheinlich keine ausreichend hohe Rendite erwirtschaften, wird sie als Vermögenstransfer (Investitionszuschuss, D.92) mit einem entsprechenden Eintrag als Veräußerung nichtfinanzieller Aktiva gebucht (P.5 oder NP). |
Fiskalische Maßnahmen
|
20.204 |
Fiskalische Maßnahmen werden vom Staat durchgeführt und im Rahmen der üblichen Haushaltsverfahren aus dem Haushalt finanziert. Doch einige von staatlichen Einheiten eingeleiteten Maßnahmen können die Mitwirkung von Einheiten erfordern, die nicht dem staatlichen Rechtsrahmen unterliegen, einschließlich öffentlicher Kapitalgesellschaften. Obwohl sie nicht im Haushalt erfasst werden und sich gegebenenfalls den üblichen Kontrollverfahren entziehen, erscheint es angemessen, sie im Rahmen der staatlichen Einnahmen und Ausgaben zu buchen. Das hängt damit zusammen, dass das ESVG darstellt, wann der Staat als Hauptakteur einer Maßnahme und die öffentliche Kapitalgesellschaft als Vertreter fungiert. |
Ausschüttungen im Falle öffentlich kontrollierter Kapitalgesellschaften
Ausschüttungen oder Entnahme von Eigenkapital
|
20.205 |
Einkünfte aus einer Kapitalbeteiligung an öffentlich kontrollierten Kapitalgesellschaften können als Verteilungstransaktion (gewöhnlich Ausschüttungen) oder als Finanztransaktion gebucht werden. Ausschüttungen gelten als Vermögenseinkommen. Als Quelle für die Verteilung von Ausschüttungen steht der Unternehmensgewinn der Kapitalgesellschaft zur Verfügung. Folglich sind in den zur Ausschüttung bereitgestellten Mitteln weder die Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten noch Umbewertungsgewinne enthalten. Aus diesen Quellen finanzierte Ausschüttungen bzw. Ausschüttungen auf der Grundlage derartiger Quellen werden als Entnahme von Eigenkapital gebucht. Das gleiche Grundprinzip gilt für Gewinnentnahmen. |
|
20.206 |
Umfangreiche unregelmäßige Zahlungen oder solche, die den Unternehmensgewinn des Jahres überschreiten, werden Superdividenden genannt. Sie werden aus akkumulierten Rückstellungen oder aus der Veräußerung von Vermögenswerten finanziert und als Entnahme von Eigenkapital in Höhe der Differenz zwischen der Zahlung und dem Unternehmensgewinn des entsprechenden Rechnungszeitraums gebucht. Liegt keine Messgröße für den Unternehmensgewinn vor, wird der Betriebsgewinn der betrieblichen Buchführung als Näherungswert herangezogen. |
|
20.207 |
Zwischendividenden werden als Vermögenseinkommen (D.42) gebucht, soweit sie eine Beziehung zum aufgelaufenen Einkommen der Kapitalgesellschaft haben. In der Praxis müssen dafür zwei Bedingungen erfüllt sein:
Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, wird die Zwischenzahlung als Vorauszahlung unter Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (F.8) gebucht, bis das Jahresergebnis vorliegt, da ein entsprechender Test für die Superdividende durchgeführt werden muss, nämlich ein Vergleich der Zwischenzahlung mit dem Unternehmensgewinn des Jahres. |
Steuern oder Entnahme von Eigenkapital
|
20.208 |
Steuern haben eine Rechtsgrundlage und unterliegen der Kontrolle durch ein gesetzliches Verfahren. Diese Transaktionen, die einvernehmlich erfolgen, stellen die Haupteinnahmequelle des Staates dar. |
|
20.209 |
Es kann jedoch vorkommen, dass eine in Rechtsdokumenten als Steuer beschriebene Transaktion im ESVG nicht als solche gebucht wird. Ein Beispiel dafür ist die indirekte Privatisierung. Wenn eine öffentliche Holdinggesellschaft ihre Kapitalbeteiligung einer anderen öffentlich kontrollierten Kapitalgesellschaft verkauft und einen Teil des Erlöses als Steuer an den Staat abführt oder wenn sich aus der Privatisierung eine Steuerpflicht auf nachträglich realisierte Gewinne wie z. B. die Verpflichtung zur Zahlung einer Kapitalertragssteuer ergibt, so wird die Zahlung als Finanztransaktion erfasst. |
Privatisierung und Verstaatlichung
Privatisierungen
|
20.210 |
Die Privatisierung umfasst die Veräußerung von Anteilsrechten an einer öffentlich kontrollierten Kapitalgesellschaft durch den Staat. Verkaufserlöse stellen keine staatliche Einnahme dar, sondern sind eine Finanztransaktion, die im Finanzierungskonto gebucht wird. Es ergeben sich keine Auswirkungen auf den Finanzierungssaldo, da dieses Ereignis sich nicht auf das Reinvermögen auswirkt und es sich dabei um eine Umbuchung (von AF.5 zu AF.2) in der Vermögensbilanz des Staates handelt. Ein direkter Verkauf von nichtfinanziellen Aktiva wie Gebäuden und Grundstücken anstelle einer vollständigen Kapitalgesellschaft wird im Vermögensbildungskonto als Abgänge des Anlagevermögens oder von nichtproduziertem Sachvermögen gebucht, sofern er nicht im Rahmen der Restrukturierung von Unternehmen erfolgt ist. |
|
20.211 |
Jeglicher Erwerb von Dienstleistungen für diesen Prozess sollte jedoch als Vorleistungen des Staates gebucht und nicht mit den Verkaufserlösen verrechnet werden. Folglich sind die Verkaufserlöse brutto in den Finanzierungskonten zu buchen. |
Indirekte Privatisierungen
|
20.212 |
Privatisierungen können auch unter komplizierteren institutionellen Konstellationen durchgeführt werden. So könnten die Aktiva einer öffentlichen Kapitalgesellschaft durch eine öffentliche Holdinggesellschaft oder eine andere vom Staat kontrollierte öffentliche Kapitalgesellschaft verkauft werden, und der gesamte Erlös oder Teile davon fließen dem Staat zu. In jedem Falle ist die Zahlung des Erlöses für den in dieser Form erfolgten Verkauf von Aktiva an den Staat als Finanztransaktion zu buchen, und zwar unabhängig davon, wie sie in den Büchern des Staates oder seines Tochterunternehmens präsentiert wird, und bei gleichzeitiger Reduzierung der Anteilsrechte entsprechend der Teilliquidierung der Aktiva der Holdingsgesellschaft. Von der Holdinggesellschaft einbehaltene Verkaufserlöse entsprechen Privatisierungserlösen, die der Staat per Kapitalspritze dem Unternehmen wieder zuführt und die dann dem Kapitalzuführungstest zu unterziehen sind, um die Art der Zahlung festzustellen. |
|
20.213 |
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die öffentliche Holdinggesellschaft oder eine andere öffentliche Kapitalgesellschaft als „Restrukturierungsstelle“ fungiert. In einem solchen Fall wird der Verkaufserlös nicht an den Staat abgeführt, sondern von der Restrukturierungsstelle einbehalten, um anderen Unternehmen Kapital zuzuführen. Wenn die Restrukturierungseinheit, ganz gleich, welche Rechtspersönlichkeit sie hat, als direkter Vertreter des Staates fungiert, besteht ihre Hauptfunktion darin, öffentlich kontrollierte Unternehmen umzustrukturieren und deren Eigentumsstatus zu ändern sowie Finanzmittel von einer Einheit zur anderen fließen zu lassen. Normalerweise wird diese Einheit dem Sektor Staat zugeordnet. Wenn die Restrukturierungseinheit jedoch eine Holdinggesellschaft ist, die eine Gruppe von Tochterunternehmen kontrolliert, und nur ein kleiner Teil ihrer Tätigkeit gemeinwohlbezogen ist und darin besteht, für den Staat in der oben beschriebenen Weise Mittel umzuverteilen, dann wird die Holdinggesellschaft entsprechend ihrer Haupttätigkeit in einen der Sektoren der Kapitalgesellschaften eingestuft, und die im Auftrag des Staates durchgeführten Transaktionen sind über den Staat umzuleiten. |
Verstaatlichung
|
20.214 |
Verstaatlichung bedeutet, dass der Staat die Kontrolle über bestimmte Vermögenswerte oder eine vollständige Kapitalgesellschaft übernimmt, indem er die Mehrheit oder Gesamtheit der Beteiligung an einem Unternehmen erwirbt. |
|
20.215 |
Eine Verstaatlichung erfolgt gewöhnlich durch den Kauf von Aktien: Der Staat erwirbt alle oder einen Teil der Aktien einer Kapitalgesellschaft zum Marktpreis oder einem diesem fast entsprechenden Preis, wobei er die in Bezug auf die Bewertung von Kapitalgesellschaften, die dieselbe Aktivität ausüben, üblichen Marktpraktiken berücksichtigt. Die Transaktion erfolgt einvernehmlich, auch wenn der frühere Eigentümer kaum die Möglichkeit besitzt, das Angebot abzulehnen oder über den Preis zu verhandeln. Der Erwerb von Aktien stellt eine Finanztransaktion dar, die im Finanzierungskonto zu buchen ist. |
|
20.216 |
In Ausnahmefällen erwirbt der Staat das Eigentum an einer Kapitalgesellschaft mittels Beschlagnahme oder Konfiszierung: Die Änderung der Eigentumsverhältnisse ist nicht das Ergebnis einer Transaktion in gegenseitigem Einvernehmen. Es erfolgt keine Zahlung an die Eigentümer, oder die Entschädigung entspricht nicht dem Zeitwert der Vermögenswerte. Die Differenz zwischen dem Marktwert der erworbenen Vermögenswerte und einer potenziellen Entschädigung ist als Enteignung im Konto für sonstige reale Vermögensänderungen auszuweisen. |
Transaktionen mit der Zentralbank
|
20.217 |
In der Praxis können zwei Arten der von der Zentralbank an den Staat geleisteten Zahlungen unterschieden werden:
Zahlungen des Staates an die Zentralbank sind in ähnlicher Form zu buchen wie im Falle anderer öffentlicher Kapitalgesellschaften. Vor allem umfangreiche Zahlungen unterliegen dem Kapitalzuführungstest, mit dem die Art der Zahlungen festgestellt wird. |
Restrukturierungen, Fusionen und Neueinstufungen
|
20.218 |
Bei der Restrukturierung einer öffentlichen Kapitalgesellschaft können entsprechend den neuen finanziellen Beziehungen Forderungen und Verbindlichkeiten entstehen und verschwinden. Diese Änderungen werden im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen als Änderung der Sektorzugehörigkeit ausgewiesen. Ein Beispiel für eine solche Restrukturierung ist die Aufteilung eines Unternehmens in zwei oder mehr institutionelle Einheiten, wobei neue Forderungen und Verbindlichkeiten entstehen. |
|
20.219 |
Andererseits ist der Erwerb von Anteilsrechten an einer Kapitalgesellschaft im Rahmen einer Fusion als Finanztransaktion zwischen der erwerbenden Kapitalgesellschaft und dem vorherigen Eigentümer zu buchen. |
|
20.220 |
Jede Änderung der Vermögensart, die nichts mit einer Restrukturierung oder Änderung der Sektorzuordnung zu tun hat, wie die Monetisierung oder Demonetisierung von Gold ist als Änderung der Vermögensart im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen zu buchen. |
Schulden
|
20.221 |
Vorgänge in diesem Bereich können für den Sektor Staat besondere Bedeutung erlangen, da sie für den Staat häufig ein Mittel darstellen, um andere Einheiten in wirtschaftlicher Hinsicht zu unterstützen. Die Buchung dieser Vorgänge wird in Kapitel 5 behandelt. Der allgemeine Grundsatz bei der einvernehmlichen Übernahme oder Aufhebung der Schulden einer Einheit durch eine andere Einheit besteht darin, dass anerkannt wird, dass es sich um einen freiwilligen Vermögenstransfer zwischen den beiden Einheiten handelt. Das bedeutet, dass die Übernahme oder Aufhebung einer Verbindlichkeit einen Vermögenstransfer darstellt. Da dabei im Allgemeinen keine Zahlungsströme beobachtet werden, kann dieser Vorgang als Sachvermögenstransfer eingeordnet werden. |
Schuldenübernahme, Schuldenaufhebung und einseitige Wertberichtigung
Schuldenübernahme und -aufhebung
|
20.222 |
Bei der Schuldenübernahme übernimmt eine Einheit die Verantwortung für die ausstehenden Verbindlichkeiten der anderen Einheit gegenüber dem Gläubiger. Das geschieht häufig, wenn der Staat für die Schulden einer anderen Einheit garantiert, und die Bürgschaft wird abgerufen oder aktiviert. |
|
20.223 |
Übernimmt ein Staat Schulden, so ist die Gegenbuchung der neuen Verbindlichkeit des Staates ein Vermögenstransfer zugunsten des seinen Verpflichtungen nicht nachkommenden Schuldners. Wird ein Vermögenswert als Gegenposten gebucht, ist dieser Fall sorgfältig zu untersuchen. Es sind dabei zwei Sachverhalte zu unterscheiden:
|
|
20.224 |
Schuldenzahlungen im Namen anderer weisen Ähnlichkeiten zur Schuldenübernahme auf, aber die die Zahlungen leistende Einheit übernimmt nicht die gesamten Schulden. Die Transaktionen werden auf ähnliche Weise gebucht. |
|
20.225 |
Bei der Schuldenaufhebung (oder dem Schuldenerlass) wird ein Anspruch durch vertragliche Vereinbarung zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner aufgehoben oder reduziert. Der Gläubiger weist eine Vermögenstransferleistung in Höhe des erlassenen Betrages aus und die andere Einheit bucht einen empfangenen Vermögenstransfer. Wenn der Staat Ansprüche verwirkt, wie es bei Studentendarlehen und Krediten für Landwirte der Fall sein kann, wird häufig gegenseitiges Einvernehmen vorausgesetzt, wenn auch nicht formal festgestellt. |
|
20.226 |
Schuldenübernahmen und -aufhebungen zugunsten einer kontrollierten Einheit haben einen Anstieg des Eigenkapitalwertes des Empfängers zur Folge, der im Umbewertungskonto zum Ausdruck kommt. Werden die Schulden eines Staates durch einen anderen Staat übernommen, dann weist der erstgenannte Staat eine Vermögenstransfereinnahme, eine neue Schuld für die übernehmende staatliche Einheit oder beides aus. |
|
20.227 |
Schuldenübernahmen und -aufhebungen, die im Rahmen von Privatisierungen durchgeführt werden, werden als Transaktionen mit Anteilsrechten in Höhe des Betrags, der den Verkaufserlös nicht überschreitet (der Rest bildet einen Vermögenstransfer) gebucht, um die Neutralität der Rechnungslegung bei der Durchführung der Privatisierung zu gewährleisten. Die Privatisierung muss binnen eines Jahres erfolgen. |
|
20.228 |
Wenn Schuldnerstaaten eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Schulden zu einem unter dem Wert der Kapitalsumme (einschließlich Zinsrückstände) liegenden Wert anbieten, dann hat dies eine Buchung im Vermögenskonto zur Folge und wirkt sich auf den Finanzierungssaldo des Staatshaushalts aus, da von einem Zuschuss des Gläubigers ausgegangen wird. Hat eine vorzeitige Rückzahlung vertragsgemäß die Zahlung von Gebühren an den Kreditgeber zur Folge, so ist der Betrag als Einkommen des Kreditgebers zu buchen. Im Falle von Wertpapieren hat ein Rückkauf am Markt eine Eintragung im Umbewertungskonto zur Folge, sofern dem Inhaber der Wertpapiere die vorzeitige Rückgabe nicht aufgezwungen wird. |
|
20.229 |
Die Wertdifferenz im Falle des Verkaufs von staatlichen Forderungen gegenüber anderen Staaten an Dritte hat eine Buchung im Vermögensbildungskonto (Vermögenstransfer) zur Folge und wirkt sich auf das Staatsdefizit aus, weil die Art der Forderung ursprünglich mit einer auf eine positive Wirkung abzielenden Absicht verbunden war und der Verkauf eine Möglichkeit der Umschuldung darstellt. |
|
20.230 |
Demnach stellen die Vermögenstransferausgaben des Staates, in Anerkennung der Tatsache, dass der Schuldner der eigentlich Begünstigte der Transaktion ist, eine Einnahme des Schuldners dar, wobei im Konto der übrigen Welt eine den Ausgaben des Gläubigerstaats entsprechende Buchung vorgenommen wird. Für den Verkäufer ist der Transaktionswert der veräußerten Forderung der Nennwert. Der Wert der Forderung wird sowohl in den Konten des neuen Gläubigers als auch des Schuldners (d. h. in der Bankbilanz und in den Konten der übrigen Welt — für den Auslandsvermögensstatus) zum reduzierten Wert ausgewiesen. |
|
20.231 |
In selteneren Fällen, in denen der mit Dritten oder einem Schuldner, der den Rückkauf seiner Schulden anbietet, ausgehandelte Abschlag lediglich die Veränderung der Marktzinssätze und keine Änderung der Bonität widerspiegelt, kann davon ausgegangen werden, dass der staatliche Gläubiger als normaler Investor fungiert. Die Differenz abzüglich gegebenenfalls anfallender Gebühren wird in den Umbewertungskonten ausgewiesen. Als Probe kann dienen, ob der zurückgezahlte Betrag den Nennwert übersteigen könnte. |
Schuldenübernahme mit einem Transfer von Vermögensgütern
|
20.232 |
Wenn ein Staat die Schuldenlast einer öffentlichen Kapitalgesellschaft verringern will, könnte eine staatliche Einheit zusätzlich zur Übernahme von Schulden auch Vermögensgüter wie die öffentliche Verkehrsinfrastruktur übernehmen. Diese Schuldenübernahme mit einem Transfer von Vermögensgütern an die staatliche Einheit wird als einvernehmlich betrachtet und hat exakt dieselbe Wirkung auf den Finanzierungssaldo des Staatshaushalts wie eine Schuldenübernahme: Die Höhe des zugunsten der Kapitalgesellschaft gebuchten Vermögenstransfers entspricht der Höhe der übernommenen Schulden. Der Erwerb von Vermögensgütern hat eine negative Wirkung auf den Finanzierungssaldo. |
Einseitige Wertberichtigungen oder Teilwertberichtigungen
|
20.233 |
Bei einseitigen Wertberichtigungen handelt es sich um die Reduzierung einer einem Gläubiger geschuldeten Summe in dessen Bilanz, und zwar gewöhnlich wenn der Gläubiger zu dem Schluss gelangt, dass die Schuldverbindlichkeit wertlos oder weniger wert ist, weil keine Rückzahlung der Schulden zu erwarten ist; der Schuldner ist zahlungsunfähig, verschwunden oder es bestehen keine realistischen Möglichkeiten zur Beitreibung der Forderungen, die die entstehenden Kosten rechtfertigen würden. Bei Teilwertberichtigungen reduziert der Gläubiger den Buchwert eines Vermögensgutes in seiner Bilanz. |
|
20.234 |
Wertberichtigungen und Teilwertberichtigungen stellen interne Buchführungsmaßnahmen des Gläubigers dar und werden daher vielfach nicht als Transaktionen ausgewiesen, weil sie nicht in gegenseitigem Einvernehmen durchgeführt werden. Es kommt jedoch vor, dass bei der Wertberichtigung und Teilwertberichtigung die Forderungen an den Schuldner nicht aufgehoben werden. Folglich kann es zu einer Umkehrung von Teilwertberichtigungen (was durchaus üblich ist) und von einseitigen Wertberichtigungen (was weniger häufig passiert) kommen. |
|
20.235 |
Teilwertberichtigungen als solche haben keine Buchung in der Bilanz des Gläubigers zur Folge, da der Buchwert der Schuld bereits den Marktwert des Instruments widerspiegelt oder im Fall von Krediten dem Nominalwert entspricht, es sei denn, der Marktwert wird durch den teilwertberichtigten Buchwert vertreten (wenn die Teilwertberichtigung in den Umbewertungskonten ausgewiesen wird). Dagegen haben einseitige Wertberichtigungen die Entfernung des Vermögenswertes aus der Bilanz des Gläubigers mittels sonstiger realer Vermögensänderung in Höhe des zu entfernenden Betrags (z. B. Nennwert eines Kredits, Marktwert von Wertpapieren) zur Folge, sofern die einseitige Wertberichtigung nicht Ausdruck einer Schuldenaufhebung ist. Folglich haben im Gegensatz zur Schuldenübernahme oder -aufhebung einseitige Wertberichtigungen und Teilwertberichtigungen keine Auswirkungen auf den Finanzierungssaldo des Staates. |
Sonstige Umschuldung
|
20.236 |
Die Umschuldung ist eine Vereinbarung zur Änderung der für die Bedienung von bestehenden Schulden geltenden Bedingungen, die gewöhnlich günstigere Bedingungen für den Schuldner vorsieht. Der von der Umschuldung betroffene Schuldtitel gilt als gelöscht und durch einen neuen Schuldtitel mit neuen Bedingungen ersetzt. Besteht eine wertmäßige Differenz zwischen dem gelöschten und dem neuen Schuldtitel, handelt es sich um eine Art von Schuldenaufhebung, und zur Buchung dieser Differenz ist ein Vermögenstransfer erforderlich. |
|
20.237 |
Eine Umwandlung von Schulden in Beteiligungen (Debt-for-equity-Swap) liegt dann vor, wenn ein Gläubiger bereit ist, eine ihm zustehende Schuld durch ein Anteilspapier zu ersetzen. So kann der Staat beispielsweise mit einer öffentlichen Kapitalgesellschaft, die ihm gehört, vereinbaren, dass er einen existierenden Kredit durch eine größere Kapitalbeteiligung an der öffentlichen Kapitalgesellschaft ersetzt. In diesem Fall sollte ein Kapitalspritzentest durchgeführt werden. Wertmäßige Differenzen zwischen dem zu löschenden Schuldtitel und der erworbenen Beteiligung stellen einen Vermögenstransfer dar, der im Umbewertungskonto auszuweisen ist. |
|
20.238 |
Rückstände bei der Begleichung von Schulden treten dann auf, wenn ein Schuldner einen Termin für die Zahlung von Zinsen oder der Kapitalsumme versäumt. Der Schuldtitel ändert sich normalerweise nicht, aber das Wissen um die Höhe der Zahlungsrückstände bietet gegebenenfalls wichtige Informationen. |
Erwerb von Schulden über dem Marktwert
|
20.239 |
Der Erwerb von Schulden über dem Marktwert wird zunächst als Kreditvergabe zu günstigen Konditionen und später als Entschuldung bezeichnet. In beiden Fällen soll Nutzen gestiftet werden; deshalb ist die Erfassung einer Ausgabe, z. B. eines Vermögenstransfers, erforderlich. |
|
20.240 |
Eine Entschuldung liegt dann vor, wenn ein Schuldner seine Schuldtitel auf finanzielle Aktiva abstimmt, die die gleichen oder höhere Zugänge beim Schuldendienst aufweisen. Selbst wenn die entschuldeten Titel auf eine separate Einheit übertragen wurden, sollte die Bruttoposition dennoch gebucht werden, indem die neue Einheit als Hilfseinheit behandelt und mit der entschuldenden Einheit konsolidiert wird. Ist die Hilfseinheit gebietsfremd, wird sie als Zweckgesellschaft behandelt, und die Transaktionen des Staates mit dieser Einheit sollten gemäß den Erläuterungen im Kapitel „Die Darstellung der staatlichen Finanzstatistiken“ behandelt werden. |
|
20.241 |
Gewährung von vergünstigten Konditionen für die Verbindlichkeit. Es gibt keine genaue Definition für Kredite mit günstigen Konditionen, aber allgemein gilt, dass sie dann zum Einsatz kommen, wenn dem Sektor Staat zugehörige Einheiten anderen Einheiten Kredite zu Zinssätzen gewähren, die bewusst unterhalb des normalerweise geltenden Marktzinssatzes festgesetzt werden. Die Vergünstigungen können durch tilgungsfreie Zeiten, Zugeständnisse in Bezug auf die Zahlungshäufigkeit und eine für den Schuldner günstige Laufzeit verbessert werden. Da die Bedingungen eines solchen Kredits für den Schuldner günstiger als die üblichen Marktbedingungen sind, beinhalten vergünstigte Kredite praktisch einen Transfer vom Gläubiger an den Schuldner. |
|
20.242 |
Vergünstigte Kredite werden so wie andere Kredite zu ihrem Nominalwert gebucht, doch bei der Kreditbereitstellung sollte ein Vermögenstransfer als nachrichtlicher Ausweis gebucht werden, der unter Berücksichtigung des entsprechenden marktüblichen Diskontsatzes der Differenz zwischen dem Vertragswert der Schuld und ihrem Gegenwartswert entspricht. Einen speziellen Marktzinssatz, der zur Messung des Vermögenstransfers genutzt werden sollte, gibt es nicht. Der von der OECD veröffentlichte kommerzielle Referenzzinssatz (Commercial Interest Reference Rate) kann bei Krediten zum Einsatz kommen, die von deren Mitgliedstaaten gewährt werden. |
Entschuldungen und Rettungsaktionen (Bailouts)
|
20.243 |
Ein Bailout dient dazu, in finanzielle Not geratene Einheiten zu retten. Er liegt häufig dann vor, wenn eine staatliche Einheit einer Kapitalgesellschaft kurzfristige finanzielle Unterstützung gewährt, um ihr über eine finanziell schwierige Zeit hinwegzuhelfen, oder durch eine permanentere Kapitalzufuhr versucht, die Rekapitalisierung der Kapitalgesellschaft zu unterstützen. Rettungsaktionen für Finanzinstitutionen werden häufig als Entschuldung bezeichnet. Bei Bailouts kommt es vielfach zu einmaligen Transaktionen mit großen Werten, über die in den Medien berichtet wird und die deshalb leicht zu ermitteln sind. |
|
20.244 |
Das Eingreifen des Sektors Staat kann in unterschiedlicher Form erfolgen. Beispiele hierfür sind:
|
|
20.245 |
Staatliche Garantien im Rahmen einer Rettungsaktion werden als einmalige Garantien an Einheiten in finanzieller Notlage behandelt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Einheit nicht in der Lage ist oder erhebliche Schwierigkeiten hat, ihren Verpflichtungen nachzukommen, weil ihre Fähigkeit, Cashflow zu generieren, eingeschränkt ist oder die Handelbarkeit ihrer Aktiva aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Das führt normalerweise zur Buchung eines Vermögenstransfers direkt bei Gewährung, so als sei die Bürgschaft abgerufen worden, und zwar für den Gesamtbetrag der Bürgschaft oder, sofern eine zuverlässige Schätzung vorliegt, für den Betrag, der voraussichtlich abgerufen wird (voraussichtlicher Verlust des Staates). Siehe auch Nummer 20.256. |
|
20.246 |
Erwirbt der Staat Aktiva von einem zu unterstützenden Unternehmen, so ist der gezahlte Betrag normalerweise höher als der tatsächliche Marktwert der Aktiva. Der Kauf wird zum tatsächlichen Marktwert gebucht, und als Vermögenstransfer wird die Differenz zwischen dem Marktpreis und der gezahlten Gesamtsumme erfasst. |
|
20.247 |
Bei einem Bailout erwirbt der Staat oftmals Kredite von Finanzinstitutionen zu deren Nominalwert und nicht zu deren Marktwert. Obwohl Kredite zum Nominalwert gebucht werden, wird die Transaktion in eine Vermögenstransferbuchung und einen Eintrag in den Umbewertungskonten aufgeteilt. Wenn verlässliche Informationen dahingehend vorliegen, dass einige Kredite in voller oder so gut wie voller Höhe verloren sind, oder wenn keine zuverlässigen Informationen über den voraussichtlichen Verlust vorliegen, werden diese mit Null gebucht, und für ihren ehemaligen Nominalwert wird ein Vermögenstransfer ausgewiesen. |
|
20.248 |
Wird vom Staat eine öffentliche institutionelle Einheit einzig zur Regelung der Rettungsaktion gebildet, so ist die Einheit in den Sektor Staat einzustufen. Wird die neue Einheit auf Dauer eingerichtet und die Rettungsaktion stellt lediglich eine zeitweilige Aufgabe dar, so erfolgt ihre Einstufung als staatliche Einheit oder öffentliche Kapitalgesellschaft nach den allgemeinen Regeln, die im Abschnitt über Restrukturierungsagenturen weiter oben beschrieben sind. Einheiten, die Forderungen von in Not geratenen Finanzkapitalgesellschaften erwerben, um diese dann in einem ordentlichen Verfahren zu veräußern, können nicht als finanzielle Mittler angesehen werden, da sie sich selbst keinem Risiko aussetzen. Sie werden dem Sektor Staat zugeordnet. |
Schuldengarantien
|
20.249 |
Eine Schuldengarantie stellt eine Regelung dar, bei der der Garant die Zahlung an den Gläubiger übernimmt, falls der Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Für den Staat bildet eine solche Bürgschaft eine Möglichkeit, wirtschaftliche Aktivitäten ohne eine unverzügliche Bereitstellung finanzieller Mittel zu unterstützen. Schuldengarantien wirken sich insofern nachhaltig auf das Verhalten von Wirtschaftsakteuren aus, als sie die Anleihens- und Darlehensbedingungen auf den Finanzmärkten verändern. |
|
20.250 |
An jeder Bürgschaft sind drei Parteien beteiligt: der Kreditgeber, der Kreditnehmer und der Garant. Zunächst erfolgt die Buchung der Strom- und Bestandsgrößen der Kreditbeziehung zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer, während die unter die Garantiebeziehung fallenden Strom- und Bestandsgrößen nach dem Abruf zwischen Kreditgeber und Garant auszuweisen sind. Damit hat eine Aktivierung von Bürgschaften die Buchung von Stromgrößen und Änderungen in den Bilanzen des Schuldners, Gläubigers und Garanten zur Folge. |
|
20.251 |
Es gibt drei Hauptarten von Garantien:
|
Derivatähnliche Garantien
|
20.252 |
Garantien, die der Definition von Finanzderivaten entsprechen, sind solche Bürgschaften, die aktiv an den Finanzmärkten gehandelt werden, wie Credit Default Swaps (Kreditausfallversicherungen). Das Derivat beruht auf dem Risiko des Ausfalls eines Referenzinstruments und ist im Allgemeinen nicht an einen konkreten Kredit oder eine konkrete Anleihe gebunden. |
|
20.253 |
Bei Übernahme einer solchen Bürgschaft zahlt der Käufer einen Betrag an das Finanzinstitut, das das Derivat ausgibt. Dieser Vorgang wird als eine Transaktion mit Finanzderivaten gebucht. Wertänderungen bei Derivaten werden als Umbewertungen ausgewiesen. Bei Ausfall des Referenzinstruments leistet der Garant eine Zahlung an den Käufer zur Abdeckung des theoretischen Verlustes der Referenzanleihe. Dieser Vorgang wird ebenfalls als eine Transaktion mit Finanzderivaten gebucht. |
Standardgarantien
|
20.254 |
Standardgarantien decken ähnliche Arten von Kreditrisiken für eine Vielzahl von Fällen ab. Es ist nicht möglich, das Ausfallrisiko für jede einzelne Anleihe zu bestimmen, aber es lässt sich bei Zugrundelegung einer hohen Anzahl von Anleihen abschätzen, wie viele davon ausfallen werden. Die Behandlung von Standardgarantien wird in Kapitel 5 erläutert. |
Einmalige Garantien
|
20.255 |
Bei einmaligen Garantien sind die Bedingungen einer Anleihe oder des Wertpapiers so speziell, dass es nicht möglich ist, das mit der Anleihe verbundene Risiko auch nur mit annähernder Genauigkeit zu bestimmen. In der Regel wird die Gewährung einer einmaligen Garantie als eine Eventualverpflichtung angesehen und nicht als Forderung/Verbindlichkeit in der Bilanz des Garanten ausgewiesen. |
|
20.256 |
In Ausnahmefällen werden einmalige Garantien, die vom Staat in bestimmten, klar definierten finanziellen Notsituationen (z. B. negative Eigenmittel eines Unternehmens) an Kapitalgesellschaften gewährt werden und bei denen höchstwahrscheinlich mit einem Abruf gerechnet werden muss, so behandelt, als seien solche Bürgschaften direkt bei Inkrafttreten abgerufen worden (siehe auch Nummer 20.245). |
|
20.257 |
Die Aktivierung einer einmaligen Garantie wird wie eine Schuldenübernahme behandelt. Die ursprüngliche Schuld wird gelöscht und durch eine neue Schuld zwischen dem Garanten und dem Gläubiger ersetzt. Die Schuldenübernahme impliziert die Buchung eines Vermögenstransfers zugunsten des säumigen Schuldners. Dem Vermögenstransfer steht eine Finanztransaktion gegenüber, bei der die Verbindlichkeit von der Kapitalgesellschaft an den Staat übertragen wird. |
|
20.258 |
Die Aktivierung einer Bürgschaft erfordert nicht notwendigerweise die sofortige Rückzahlung der Schuld. Gemäß dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung ist der Gesamtbetrag der übernommenen Schuld zum Zeitpunkt der Aktivierung der Bürgschaft und der Übernahme der Schuld zu buchen. Der Garantiegeber ist der neue Schuldner, und die Rückzahlungen der Kapitalsumme durch den Garantiegeber sowie aufgelaufene Zinsen für die übernommene Schuld sind dann zu buchen, wenn diese Ströme auftreten. Wenn es also beim Abruf einer Bürgschaft lediglich um die Leistung des Schuldendienstes für die während des Rechnungszeitraums fällige Schuld geht, wie bei einer Aufforderung zur Kapitalerhöhung, ist für die beglichenen Beträge ein Vermögenstransfer zu buchen. Kommt es jedoch wiederholt zu Abrufen, beispielsweise dreimal hintereinander, und ist von weiteren Abrufen auszugehen, wird eine Schuldenübernahme ausgewiesen. |
|
20.259 |
Leistet der ursprüngliche Schuldner gegenüber dem Garanten eine Rückzahlung, während für frühere Bürgschaftsabrufe eine Ausgabe gebucht wurde, wird durch den Garanten eine Einnahme ausgewiesen. Diese Einnahme ist jedoch einem Test in Bezug auf ihre Einstufung als Superdividende zu unterziehen, falls der Schuldner durch den Garanten kontrolliert wird; den Unternehmensgewinn übersteigende Rückzahlungsbeträge sind als Entnahme von Eigenkapital zu buchen. |
Verbriefung
Definition
|
20.260 |
Eine Verbriefung besteht in der Ausgabe von Wertpapieren auf der Basis von Cashflows, die von bestimmten Vermögenswerten erzeugt werden sollen, oder auf der Basis von sonstigen Einkommensströmen. Wertpapiere, die von Cashflows aus Vermögenswerten abhängen, werden als „forderungsbesicherte Wertpapiere“ (asset-backed securities — ABS) bezeichnet. |
|
20.261 |
Bei der Verbriefung überträgt der Originator die Eigentumsrechte an den Aktiva oder das Recht auf spezifische künftige Ströme an eine Verbriefungseinheit, die wiederum als Gegenleistung einen Betrag aus ihrer eigenen Finanzierungsquelle an den Originator zahlt. Die Verbriefungseinheit ist häufig eine Zweckgesellschaft. Sie beschafft sich eigene Finanzierungsmittel durch die Ausgabe von Wertpapieren, indem sie die vom Originator übertragenen Aktiva oder Rechte auf künftige Ströme als Sicherheit benutzt. Die entscheidende Frage bei der Buchung der von der Verbriefungseinheit an den Originator geleisteten Zahlung lautet, ob der Transfer des Aktivums den Verkauf eines existierenden Vermögenswerts an die Verbriefungseinheit darstellt oder eine Maßnahme, mithilfe künftiger Einkommensströme als Sicherheit Mittel aufzunehmen. |
Kriterien für die Anerkennung als Verkauf
|
20.262 |
Die Verbriefung kann nur dann als Verkauf behandelt werden, wenn die Vermögensbilanz des Staates bereits einen marktfähigen Vermögenswert aufweist und das Eigentum einschließlich aller Risiken und Vorteile in Verbindung mit dem Vermögenswert auf die Verbriefungseinheit übergeht. |
|
20.263 |
Somit ist die Verbriefung künftiger Einkommensströme, die nicht als Erträge wirtschaftlicher Vermögenswerte wie z. B. künftige Ölkonzessionen erfasst sind, eine Mittelaufnahme durch den Originator. |
|
20.264 |
Wenn eine Verbriefung Ströme in Verbindung mit finanziellen oder nichtfinanziellen Aktiva umfasst, dann müssen die mit dem Eigentum an den Aktiva verbundenen Risiken und Vorteile übertragen werden, damit ein Verkauf gebucht werden kann. |
|
20.265 |
Wenn der Staat bei der Verbriefung ein materielles Eigentumsrecht behält, z. B. durch einen gestundeten Kaufpreis, d. h. das Recht auf zusätzliche Ströme über den ursprünglichen Verbriefungswert hinaus, oder das Anrecht auf die letzte von der Verbriefungseinheit ausgegebene Tranche, oder durch eine andere Möglichkeit, dann hat kein Verkauf stattgefunden und es handelt sich um eine Mittelaufnahme durch den Originator. |
|
20.266 |
Wenn der Staat als Originator die Rückzahlung einer durch die Verbriefungseinheit in Verbindung mit dem Vermögenswert aufgenommenen Schuld garantiert, dann wurden die mit dem Vermögenswert verbundenen Risiken nicht übertragen. Es fand kein Verkauf statt, und bei dem Ereignis handelt es sich um eine Mittelaufnahme des Originators. Garantien können unterschiedliche Formen annehmen wie Versicherungsverträge, Derivate oder Bestimmungen über die Substitution von Aktiva. |
|
20.267 |
Wird festgestellt, dass der Verbriefungsvertrag die tatsächliche Veräußerung (True Sale — bilanzwirksamer Forderungsverkauf) eines marktfähigen Vermögenswerts beinhaltet, ist die Sektorzuordnung der Verbriefungseinheit zu untersuchen. Auf der Grundlage der Kriterien im Abschnitt „Abgrenzung des Sektors Staat“ kann festgestellt werden, ob die Verbriefungseinheit eine institutionelle Einheit ist und ob sie eine finanzielle Mittlerfunktion hat. Wird die Verbriefungseinheit dem Sektor Staat zugeordnet, handelt es sich bei der Verbriefung um eine Mittelaufnahme des Staates. Wird die Verbriefungseinheit als ein sonstiges Finanzinstitut (S.125) eingeordnet, dann wird die Verbriefung als Verkauf von Aktiva ausgewiesen: ohne direkte Auswirkungen auf die Staatsverschuldung und mit Auswirkungen auf das Staatsdefizit, wenn die verbrieften Stromgrößen Vermögensgüter betreffen. |
|
20.268 |
Leistet der Staat im Nachhinein eine gewisse Entschädigung, beispielsweise in Form von Barmitteln oder in anderer Form wie Bürgschaften, und ändert er damit die Risikoübertragung, so gilt die ursprünglich als Verkauf eingestufte Verbriefung von diesem Augenblick an als Mittelaufnahme mit Buchung der entsprechenden Transaktionen: Eingehen einer Verbindlichkeit und Erwerb einer Forderung mit einer Vermögenstransferausgabe, falls der Wert der Verbindlichkeit den der Forderung überschreitet. |
Buchung von Strömen
|
20.269 |
Wird eine Verbriefung als Anleihe gebucht, so werden die Zahlungsströme an die Verbriefungseinheit zunächst in den Konten des Staates und gleichzeitig als Schuldentilgung (Zinsen und Kapital) gebucht. |
|
20.270 |
Wenn Zahlungsströme vor der Tilgung von Schulden versiegen, wird die verbleibende Verbindlichkeit mittels sonstiger realer Vermögensänderung aus der Bilanz des Staates entfernt. |
|
20.271 |
Nach vollständiger Tilgung einer Schuld sind sämtliche verbleibenden Zahlungsströme, die der Verbriefungseinheit gemäß Verbriefungsvertrag zugehen, als Ausgaben des Originators zu buchen. |
Sonstige Punkte
Verpflichtungen der Alterssicherung
|
20.272 |
Die Behandlung von Pensionseinrichtungen ist in Kapitel 17 beschrieben. Dort findet sich auch eine Tabelle zur Ergänzung des Kernsystems des ESVG, in die alle Verpflichtungen der Alterssicherung einzutragen sind, darunter auch Verpflichtungen aus Sozialversicherungen. Die Alterssicherungsansprüche staatlich geförderter, beschäftigungsbezogen definierter Leistungssysteme ohne spezielle Deckungsmittel sind nur in diesen Ergänzungskonten anzugeben. |
Pauschalzahlungen
|
20.273 |
Es kommt gelegentlich vor, dass Einheiten eine Pauschale an den Staat zahlen als Gegenleistung dafür, dass der Staat einen Teil ihrer Alterssicherungspflichten übernommen hat. Diese einmaligen Großtransaktionen zwischen einem Staat und einer anderen Einheit, gewöhnlich einer öffentlichen Kapitalgesellschaft, erfolgen oftmals in Verbindung mit einer Statusänderung oder mit einer Privatisierung dieser Gesellschaft. Der Staat übernimmt in der Regel die fraglichen Verpflichtungen gegen eine Barzahlung, mit der das erwartete Defizit aus dem Transfer gedeckt wird. |
|
20.274 |
Vom Grundgedanken her erfolgt hier eine Barzahlung als Gegenleistung für die Entstehung einer Verpflichtung, die eine Verbindlichkeit darstellt, und somit dürfte die Transaktion keinen Einfluss auf das Reinvermögen und finanzielle Reinvermögen haben und keine Änderung des staatlichen Finanzierungssaldos bewirken. Es kann jedoch sein, dass die Alterssicherungsverpflichtung weder in den Vermögensbilanzen der die Verpflichtungen übertragenden noch in denen der die Verpflichtungen übernehmenden Einheit als Verbindlichkeit auftaucht. Werden beispielsweise Verpflichtungen der Alterssicherung an den Staat übertragen, können diese mit einem Sozialversicherungssystem zusammengeführt werden, für das keine Verbindlichkeit gebucht wird. |
|
20.275 |
Vor diesem Hintergrund ist eine derartige Pauschalzahlung als Vorauszahlung auf Sozialbeiträge zu betrachten. Da in der Praxis unterschiedlichste Ausgestaltungen zu beobachten sind, wird zur Vermeidung von Verzerrungen bei der Berechnung bestimmter Aggregate wie der Arbeitskosten, Pflichtabgaben usw. die Pauschalzahlung als finanzieller Vorschuss (F.8) gebucht, d. h. als eine Vorauszahlung auf übrige laufende Transfers (D.75), die in der Zukunft im Verhältnis zu den entsprechenden Leistungen der Alterssicherung gebucht werden. Infolge dessen wirkt sich die Pauschalzahlung nicht auf den Finanzierungssaldo des Staates in dem Jahr des Übergangs der Verpflichtungen aus. |
Öffentlich-private Partnerschaften
Der Umfang von öffentlich-privaten Partnerschaften
|
20.276 |
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sind komplexe, langfristige Verträge zwischen zwei Einheiten, wobei eine Einheit in der Regel eine Kapitalgesellschaft oder eine Gruppe von Kapitalgesellschaften, privat oder öffentlich, (als Betreiber oder Partner bezeichnet) ist, und die andere Einheit in der Regel eine staatliche Einheit (Lizenzgeberin). Eine ÖPP beinhaltet eine erhebliche Kapitalausgabe zur Schaffung oder Renovierung von Anlagegütern durch die Kapitalgesellschaft, welche diese Anlagen anschließend betreibt und verwaltet, um Dienstleistungen entweder für die staatliche Einheit oder für die Allgemeinheit im Auftrag der öffentlichen Einheit zu produzieren und zu liefern. |
|
20.277 |
Am Ende des Vertrages erwirbt gewöhnlich die Lizenzgeberin das rechtliche Eigentum an den Sachanlagen. Die Sachanlagen gehören in den meisten Fällen zum Kernbereich der Leistungen der öffentlichen Hand (wie Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Gefängnisse). Sie können auch Infrastruktureinrichtungen sein, denn viele auf ÖPP-Basis realisierte Großprojekte betreffen die Bereitstellung von Transport- und Beförderungsleistungen, Kommunikationsleistungen, Versorgungs- und Entsorgungsleistungen oder sonstige Leistungen, die typischerweise als Infrastrukturleistungen beschrieben werden. |
|
20.278 |
Eine allgemeine Beschreibung, die auch die häufigsten Buchungsprobleme beinhaltet, lautet wie folgt: Eine Kapitalgesellschaft verpflichtet sich dazu, einen Bestand von Sachanlagen zu erwerben und diese Anlagen dann gemeinsam mit anderen Produktionsvorleistungen zur Herstellung von Dienstleistungen zu verwenden. Diese Dienstleistungen können gegenüber dem Staat erbracht werden, der sie entweder als Vorleistung für die eigene Produktion (beispielsweise Kfz-Instandhaltung) oder für die kostenlose Versorgung der Öffentlichkeit (beispielsweise mit Bildung) verwendet. In diesem Falle leistet der Staat über den gesamten Vertragszeitraum regelmäßige Zahlungen, von denen sich die Kapitalgesellschaft die Deckung der Kosten und eine angemessene Investitionsrendite erwartet. |
|
20.279 |
ÖPP-Verträge nach dieser Definition beinhalten Bereitstellungs- oder Nutzungszahlungen der Lizenzgeberin an den Betreiber und stellen damit eine Art von Beschaffungsvereinbarung dar. Im Gegensatz zu anderen langfristigen Dienstleistungsverträgen wird ein aufgabenbezogenes Vermögensgut geschaffen. Ein ÖPP-Vertrag bedeutet somit, dass der Staat eine Dienstleistung kauft, die ein Partner durch die Schaffung eines Vermögensguts produziert. ÖPP-Verträge können vielfältig gestaltet sein, was die Verfügung über die Anlagen bei Vertragsende, den Anlagenbetrieb und die Anlageninstandhaltung während der Vertragslaufzeit oder den Preis, die Qualität und den Umfang der produzierten Dienstleistungen usw. betrifft. |
|
20.280 |
Wenn die Kapitalgesellschaft die Dienstleistungen direkt an die Allgemeinheit verkauft (beispielsweise in Gestalt einer mautpflichtigen Straße), wird der Vertrag nicht als ÖPP, sondern als Lizenz betrachtet. Der Preis wird vom Staat reguliert und auf eine Höhe festgesetzt, die der Kapitalgesellschaft die Deckung der Kosten und einen angemessenen Ertrag aus den getätigten Investitionen ermöglicht. Bei Ablauf des Vertrags können das rechtliche Eigentum und die betriebliche Verfügungsgewalt über die Anlagen an den Staat fallen, eventuell auch ohne Gegenleistung. |
|
20.281 |
Im Rahmen eines ÖPP-Vertrages erwirbt die Kapitalgesellschaft die Sachanlagen und ist über die gesamte Vertragslaufzeit der rechtliche Eigentümer der Anlagen, in manchen Fällen unterstützt durch den Staat. Der Vertrag enthält oftmals Festlegungen, dass die Anlagen die staatlichen Konstruktions-, Qualitäts- und Kapazitätsanforderungen einhalten müssen, bei Herstellung der vertraglich geforderten Dienstleistungen gemäß den staatlichen Vorgaben zu verwenden und gemäß staatlich definierten Normen und Standards in Stand zu halten sind. |
|
20.282 |
Außerdem geht die Nutzungsdauer der Anlagen gewöhnlich weit über die Vertragslaufzeit hinaus, sodass der Staat die Kontrolle über die Anlagen sowie die Risiken und Vorteile für einen wesentlichen Teil der Anlagennutzungsdauer übernehmen kann. Somit ist es häufig schwer zu entscheiden, ob die Kapitalgesellschaft oder der Staat die Mehrzahl der Risiken trägt und die Mehrzahl der Vorteile erhält. |
Wirtschaftliches Eigentum und Zuordnung des Anlagegutes
|
20.283 |
Wie beim Leasing erkennt man den wirtschaftlichen Eigentümer der Vermögensgüter in einer ÖPP daran, wer die Mehrzahl der Risiken trägt und wem vermutlich die meisten Vorteile aus den Vermögensgütern zufließen. Das Vermögensgut wird dieser Einheit zugeordnet, und folglich auch die Bruttoanlageinvestition. Bei den Risiken und Vorteilen sind folgende Hauptelemente zu beurteilen:
|
|
20.284 |
Die Risiken und Chancen liegen dann beim Betreiber, wenn das Baurisiko und entweder das Bedarfs- oder das Verfügbarkeitsrisiko effektiv übertragen wurden. Mehrheitsfinanzierungen, Bürgschaften über mehrheitliche Abgabenfinanzierung oder Kündigungsklauseln, denen zufolge der Finanzgeber seine Finanzierungsmittel mehrheitlich erstattet bekommt, wenn der Vertrag durch den Betreiber gekündigt wird, bedeuten, dass keines dieser Risiken effektiv übertragen wurde. |
|
20.285 |
Infolge der besonderen Gegebenheiten von ÖPP-Verträgen, die sich auf komplexe Vermögensgüter beziehen, liegt für den Fall, dass die Bewertung der Risiken und Chancen zu keinem schlüssigen Ergebnis führt, ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt in der Frage, welche Einheit einen maßgeblichen Einfluss auf die Beschaffenheit des Vermögensguts ausübt und wie die Bedingungen der mit dem Vermögensgut produzierten Dienstleistungen bestimmt werden, insbesondere
|
|
20.286 |
Um zu entscheiden, welche Einheit wirtschaftlicher Eigentümer ist, müssen die Bestimmungen des jeweiligen ÖPP-Vertrages untersucht werden. Bedingt durch die Komplexität und Variantenvielfalt der ÖPP müssen alle Fakten und Begleitumstände der einzelnen Verträge betrachtet werden, wonach die buchungstechnische Behandlung zu wählen ist, die die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Verhältnisse am besten abbildet. |
Buchungsprobleme
|
20.287 |
Wird die Kapitalgesellschaft als wirtschaftlicher Eigentümer angesehen und übernimmt der Staat — wie gemeinhin üblich — am Ende des Vertrages das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum ohne eine explizite Zahlung vorzunehmen, wird für den staatlichen Erwerb des Vermögensguts eine Transaktion gebucht. Ein genereller Ansatz sieht so aus, dass der Staat schrittweise eine finanzielle Forderung und die Kapitalgesellschaft analog dazu eine entsprechende Verbindlichkeit aufbaut, deren Wert am Ende der Vertragslaufzeit jeweils dem erwarteten Restwert der Vermögensgüter entspricht. Bei der Realisierung dieser Methode müssen, ausgehend von erwarteten Wert des Vermögensgutes und den Zinssätzen, bestehende monetäre Transaktionen angepasst oder neue Transaktionen angelegt werden. Dieses impliziert, dass bei ÖPP-Vermögensgütern, die nicht in der Bilanz des Staates erscheinen, die ÖPP-Zahlungen aufzugliedern sind, d. h. es ist, eine Komponente auszugliedern, die den Erwerb eines finanziellen Vermögenswertes abbildet. |
|
20.288 |
Ein alternativer Ansatz besteht darin, die Änderung des rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums am Ende als Sachvermögenstransfer zu buchen. Diese Methode des Vermögenstransfers bildet zwar die zugrunde liegende wirtschaftliche Realität auch nicht richtig ab, ist aber der vernünftigste Ansatz, wenn Datenbeschränkungen vorliegen, der erwartete Anlagenrestwert unsicher ist und Vertragsbestimmungen mit verschiedenen Optionen beider Parteien vorliegen. |
|
20.289 |
Ein anderes erhebliches Problem tritt auf, wenn der Staat als wirtschaftlicher Eigentümer der Anlagen betrachtet wird, aber bei Vertragsbeginn keine eigentliche Zahlung leistet. Für den Vollzug des Erwerbs muss eine Transaktion eingerichtet werden. Aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Finanzierungsleasing wird in solchen Fällen gemeinhin ein Erwerb durch Finanzierungsleasing unterstellt. Dies hängt jedoch von der konkreten Vertragsgestaltung, von der Lesart der Vertragsbedingungen und eventuell weiteren Faktoren ab. Es wäre beispielsweise möglich, einen Kredit zu buchen und die an die Kapitalgesellschaft tatsächlich geleisteten Zahlungen, wenn diese existieren, so anzupassen, dass ein Teil jeder Zahlung als Tilgung behandelt wird. Sofern es keine tatsächlichen staatlichen Zahlungen gibt, könnten nichtmonetäre Transaktionen für die Kreditzahlungen angelegt werden. Es gibt weitere Möglichkeiten, wie staatliche Zahlungen für das Vermögensgut behandelt werden können, beispielsweise als Vorauszahlung auf ein Operating Leasing, falls ein solches unterstellt wird, oder als immaterieller Vermögenswert für das Recht der Kapitalgesellschaft auf Zugang zu den Anlagen zum Zwecke der Produktion der Dienstleistungen. |
|
20.290 |
Ein anderes wesentliches Problem betrifft die Messung der Produktion. Unabhängig von der Entscheidung, welche Einheit für die Vertragslaufzeit als wirtschaftlicher Eigentümer der Anlagen betrachtet wird und auf welche Weise der Staat schließlich die Anlagen erwirbt, ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass die Produktion richtig gemessen wird. Auch hier gibt es Optionen mit unterschiedlicher Eignung je nach konkreter Situation und je nach Datenverfügbarkeit. Die Schwierigkeit tritt auf, wenn der Staat als wirtschaftlicher Eigentümer der Anlagen betrachtet wird, aber die Anlagen von der Kapitalgesellschaft zur Produktion von Dienstleistungen verwendet werden. Hier ist es ratsam, den Wert der vermögensbezogenen Dienstleistungen als Produktionskosten der Kapitalgesellschaft auszuweisen, wozu jedoch gegebenenfalls ein Operating Leasing zu buchen ist, was zur Feststellung der Leasing-Zahlungen wiederum eine Anpassung tatsächlicher Transaktionen oder eine Einrichtung nichtmonetärer Transaktionen erfordert. Alternativ können die Kosten der vermögensbezogenen Dienstleistungen im Produktionskonto des Sektors Staat ausgewiesen werden, wobei der Output des Staates in gleicher Weise wie der Output der Kapitalgesellschaft zu klassifizieren ist, sodass der gesamtwirtschaftliche Output korrekt klassifiziert wird. |
Transaktionen mit internationalen und supranationalen Organisationen
|
20.291 |
Transaktionen, die zwischen gebietsansässigen Einheiten und internationalen oder supranationalen Organisationen erfolgen, sind als solche der übrigen Welt zugeordnet. |
|
20.292 |
Ein Beispiel für solche Transaktionen betrifft nichtstaatliche gebietsansässige Einheiten und EU-Organe, soweit diese als Hauptparteien der Transaktion in Erscheinung treten, auch wenn staatliche Einheiten eine Mittlerrolle bei der Weiterleitung der Mittel einnehmen. Die Buchung der wesentlichen Transaktionen erfolgt unmittelbar zwischen den beiden Parteien und wirkt sich nicht auf den Sektor Staat aus. Die Rolle des Staates wird als finanzielle Transaktion abgebildet (F.89). |
|
20.293 |
Die Buchung spezieller Transaktionen zwischen gebietsansässigen Einheiten und EU-Organen wird nachstehend für die verschiedenen Kategorien dargestellt:
|
|
20.294 |
Die Organe der Europäischen Union leisten erhebliche laufende Transfers und Vermögenstransfers über Strukturfonds wie den Europäischen Sozialfonds, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds. Endbegünstigte solcher Transfers können staatliche oder nichtstaatliche Einheiten sein. |
|
20.295 |
Leistungen aus Strukturfonds gehen oft mit einer Kofinanzierung einher, bei der die Europäische Union eine staatliche Investition mitfinanziert. Hier kann ein Mix von Anzahlungen, Zwischenzahlungen und Schlusszahlungen vorliegen, die über mindestens eine staatliche Einheit geleitet werden. Gebietsansässige staatliche Einheiten können auch Vorschüsse auf die erwarteten Leistungen der Europäischen Union ausreichen. |
|
20.296 |
Soweit nichtstaatliche Einheiten die Begünstigten sind, werden staatliche Vorschusszahlungen auf die zu erwartenden Geldmittel der Europäischen Union als finanzielle Transaktionen unter sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten gebucht. Gegenpart der finanziellen Transaktion ist die Europäische Union, wenn der Zeitpunkt der nichtfinanziellen Transaktion eingetreten ist, sonst der Begünstigte. Die Forderungs- und Verbindlichkeitspositionen werden mit effektiver Zahlung aufgelöst. |
|
20.297 |
Die Buchung von kofinanzierten staatlichen Ausgabentransfers erfolgt zum Zeitpunkt der Genehmigung durch die Europäische Union. |
|
20.298 |
Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass staatliche Vorschusszahlungen höher sind als der im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelte Zahlungsbetrag. Wenn der Begünstigte diesen Überschussbetrag zurückzahlen kann, erlischt für ihn die übrige Verbindlichkeit gegenüber dem Staat. Kann er den überschüssigen Betrag nicht zurückzahlen, wird ein Vermögenstransfer vom Staat gebucht und die übrige Verbindlichkeit storniert. |
|
20.299 |
Wenn staatliche Einheiten die Begünstigten sind, wird die Einnahme des Staates auf den Zeitpunkt der Ausgabe vorgetragen, abweichend von den allgemeinen Buchungsregeln für solche Transfers. Bei einem erheblichen zeitlichen Abstand zwischen der effektiven staatlichen Ausgabe und dem Eingang der Mittel kann die Einnahme zu dem Zeitpunkt gebucht werden, an dem der Zahlungsantrag bei der Europäischen Union eingereicht wird. Dies gilt jedoch nur, wenn über den Zeitpunkt der Ausgabe keine zuverlässigen Informationen vorliegen, wenn hohe Beträge im Spiel sind oder wenn der Zeitabstand zwischen Ausgabe und Beantragung kurz ist. |
|
20.300 |
Alle Vorschussleistungen, die die Europäische Union an endbegünstigte staatliche Einheiten beim Anlaufen von Mehrjahresprogrammen zahlt, werden als finanzieller Vorschuss gebucht. |
Entwicklungshilfe
|
20.301 |
Staaten unterstützen andere Länder durch die Ausreichung von bewusst günstig gestalteten Krediten unterhalb des Zinssatzes, der für einen Kredit mit vergleichbarem Risiko marktüblich wäre (begünstigte Kredite gemäß dem Abschnitt „Buchungsprobleme in Bezug auf den Sektor Staat“, „Schulden“), oder durch Beihilfen in Form von Geld- oder Sachleistungen. |
|
20.302 |
Die Buchung von Sachleistungen im Rahmen der internationalen Hilfe wie Lebensmittellieferungen ist oft mit Schwierigkeiten verbunden. Die Preise der als Sachleistung gelieferten Waren oder Dienstleistungen wie Lebensmittelbestände können im Geber- und Nehmerland sehr unterschiedlich sein. Allgemein gilt der Grundsatz, dass der Wert der an das Nehmerland gelieferten Sachspende gleich den Erbringungskosten der Hilfsleistung sein soll. Daraus folgt, dass sich der Wert der Spende durch die Preise bestimmt, die im Geberland gelten. Zu den eigentlichen Waren und Dienstleistungen sind alle damit verbundenen feststellbaren Zusatzkosten hinzuzurechnen, wie Transport zum Nehmerland, Auslieferung im Nehmerland, Vergütung der staatlichen Mitarbeiter des Geberlandes im Bereich Versandvorbereitung oder Lieferüberwachung, Versicherungen usw. |
DER ÖFFENTLICHE SEKTOR
|
20.303 |
Der öffentliche Sektor umfasst den Staat und öffentliche Kapitalgesellschaften. Die Bestandteile des öffentlichen Sektors sind in der sektoriellen Großstruktur des Systems bereits vorgegeben und lassen sich auf die öffentlichen Sektorkonten abstellen. Dazu werden die Teilsektoren des Sektors Staat und die öffentlichen Teilsektoren der nichtfinanziellen und finanziellen Kapitalgesellschaften zusammengefasst.
|
|
20.304 |
Öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften lassen sich weiter untergliedern in Zentralbank und übrige öffentliche finanzielle Kapitalgesellschaften. Letztere lassen sich bei Bedarf in weitere Teilsektoren gliedern. Tabelle 20.2 — Der öffentliche Sektor und seine Teilsektoren
|
||||||||||||||||
|
20.305 |
Öffentliche Sektorkonten lassen sich gemäß Struktur und Kontenabfolge des ESVG einrichten und vom Grundsatz her sind sowohl konsolidierte als auch nichtkonsolidierte Versionen analytisch sinnvoll. Auch alternative Darstellungen sind aussagekräftig, wie die konsolidierten und nichtkonsolidierten Darstellungsäquivalente zur Staatlichen Finanzstatistik, wie weiter oben in diesem Kapitel beschrieben. |
|
20.306 |
Alle erfassten institutionellen Einheiten im öffentlichen Sektor sind gebietsansässige Einheiten, die vom Staat entweder unmittelbar oder mittelbar durch mehrere Einheiten des öffentlichen Sektors zusammen kontrolliert werden. Kontrolle ist definiert als die Entscheidungsgewalt über die allgemeine Politik der entsprechenden Einheit. Das wird in der Folge noch näher ausgeführt. |
|
20.307 |
Ob eine Einheit des öffentlichen Sektors ein Teil des Staates ist oder aber eine öffentliche Kapitalgesellschaft, wird durch Prüfung der Marktbestimmtheit ermittelt, wie in Kapitel 3 und weiter oben beschrieben. Nichtmarktbestimmte Einheiten des öffentlichen Sektors gelten als Staat und marktbestimmte Einheiten des öffentlichen Sektors als öffentlich kontrollierte Kapitalgesellschaften. Hiervon sind nur bestimmte Kreditinstitute ausgenommen, die den Finanzsektor entweder beaufsichtigen oder bedienen und als öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften eingestuft werden, unabhängig davon, ob ihre Tätigkeit marktbestimmt ist oder nicht. |
|
20.308 |
Die Rechtsform einer Körperschaft ist kein Anhaltspunkt für ihre sektorale Zuordnung. So kann es beispielsweise im öffentlichen Sektor Kapitalgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit geben, die nicht marktbestimmt arbeiten und demzufolge dem Staat zuzuordnen und nicht als öffentliche Kapitalgesellschaften zu behandeln sind. |
Kontrolle durch den öffentlichen Sektor
|
20.309 |
Die Kontrolle über eine gebietsansässige Einheit des öffentlichen Sektors ist definiert als die Möglichkeit, die allgemeine Politik dieser Einheit festzulegen. Das kann über unmittelbare Rechte einer einzelnen Einheit des öffentlichen Sektors oder aber über kollektive Rechte vieler Einheiten erfolgen. Folgende Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob Kontrolle vorliegt:
|
|
20.310 |
Jeder Klassifizierungsfall muss separat beurteilt werden und einige der genannten Indikatoren treffen nicht auf einen Einzelfall zu. Einige Indikatoren wie Buchstaben a, c und d in Nummer 20.309 sind zur Feststellung der Kontrolle selbstgenügend. In anderen Fällen können mehrere separate Indikatoren zusammen Aufschluss über die Ausübung der Kontrolle geben. |
Zentralbanken
|
20.311 |
Bei Zentralbanken wird generell davon ausgegangen, dass es sich um öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften handelt, auch dann, wenn der alleinige oder mehrheitliche rechtliche Eigentümer nicht der Staat ist. Sie werden als öffentliche Kapitalgesellschaften betrachtet, da der Staat jeweils der wirtschaftliche Eigentümer ist oder die Kontrolle auf anderem Wege ausübt. |
|
20.312 |
Eine Zentralbank ist als Finanzmittlerin („Finanzintermediär“) in ihrer Tätigkeit besonderen gesetzlichen Bestimmungen unterworfen und unterliegt allgemeiner staatlicher Kontrolle (im Sinne der Vertretung nationaler Interessen), auch wenn die Zentralbank einen hohen Grad von Autonomie oder Unabhängigkeit bei der Ausübung ihrer Haupttätigkeit (insbesondere der Geldpolitik) genießt. Der buchungstechnisch wesentliche Punkt ist hier die Hauptaufgabe und Haupttätigkeit der Zentralbank — Verwaltung der nationalen Währungsreserven, Ausgabe der nationalen Währung und Durchführung der Geldpolitik — und weniger ihr rechtlicher Status. Der Staat hat oftmals einen förmlichen Anspruch auf Liquidationserlöse. |
|
20.313 |
Aufgrund dieser bestehenden Ansprüche des Staates bzw. aufgrund der Rolle des Staates wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Staat als wirtschaftlicher Eigentümer der Eigenmittel der Zentralbank — oder zumindest des von der Zentralbank verwalteten Reservevermögens — geführt, und zwar auch in Fällen, in denen er nicht der rechtliche Eigentümer ist. |
Öffentliche Quasi-Kapitalgesellschaften
|
20.314 |
Öffentliche Quasi-Kapitalgesellschaften besitzen nicht die Rechtseigenschaften unabhängiger Kapitalgesellschaften, verhalten sich jedoch anders als ihre Eigentümer und mehr wie Einheiten in den Sektoren der nichtfinanziellen oder finanziellen Kapitalgesellschaften, sodass sie als institutionelle Einheiten erfasst werden. |
|
20.315 |
Die Aktivitäten der Quasi-Kapitalgesellschaften müssen in sich geschlossen sein, hinreichend Daten bereitstellen, um einen kompletten Kontensatz zu erstellen (siehe Nummer 2.13 Buchstabe f), und die Einheiten müssen marktbestimmt sein. |
Zweckgesellschaften und gebietsfremde Einheiten
|
20.316 |
Einheiten des öffentlichen Sektors können Zweckgesellschaften oder Projektgesellschaften gründen oder nutzen. Oft haben solche Einheiten weder Beschäftigte noch nichtfinanzielle Vermögensgüter und ihre Präsenz geht kaum über das Namensschild hinaus, das ihren Registrierungsort anzeigt. Sie können auf fremdem Territorium ansässig sein. |
|
20.317 |
Vom öffentlichen Sektor eingerichtete Zweckgesellschaften sind darauf zu prüfen, ob sie unabhängige Handlungsbefugnis haben, in ihren Aktivitäten eingeschränkt sind und die Risiken und Vorteile aus ihren Aktiva und Passiva tragen. Zweckgesellschaften, die solche Kriterien nicht erfüllen, werden nicht als separate institutionelle Einheiten behandelt und, sofern gebietsansässig, mit der Einheit des öffentlichen Sektors konsolidiert, die die Zweckgesellschaften geschaffen hat. Gebietsfremde Einheiten werden der übrigen Welt zugeordnet, und ihre Transaktionen werden über die Einheit des öffentlichen Sektors umgeleitet, die sie errichtet hat. |
|
20.318 |
Nichtgebietsansässige internationale Gemeinschaftsunternehmungen, bei denen keiner der beteiligten Staaten die Kontrolle über die Einheit hat, werden als fiktive gebietsansässige Einheiten anteilig auf die Staaten aufgeteilt. |
Gemeinschaftsunternehmen
|
20.319 |
Einheiten des öffentlichen und privaten Sektors können ein Gemeinschaftsunternehmen bilden und begründen damit eine institutionelle Einheit. Die Einheit kann Verträge im eigenen Namen abschließen und Finanzmittel für die eigenen Zwecke beschaffen. Diese Einheit wird dem öffentlichen oder dem privaten Sektor zugeordnet, je nachdem, wo die Kontrolle liegt. |
|
20.320 |
In der Praxis werden Gemeinschaftsunternehmen meist gemeinsam kontrolliert. Wird die Einheit als nichtmarktbestimmt eingestuft, wird sie vereinbarungsgemäß dem Staat zugeordnet, da sie sich wie eine staatliche Einheit verhält. Wird die Einheit bei gleichmäßig geteilter Kontrolle als Marktproduzent eingestuft, wird die Einheit halbiert und eine Hälfte dem öffentlichen Sektor, die andere Hälfte dem privaten Sektor zugeschrieben. |
(1) Die Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen im ESVG entsprechen den OECD-Richtlinien über die Steuern und Sozialbeiträge (mit Ausnahme der Buchung von ausgezahlten Steuergutschriften und von unterstellten Sozialbeiträgen) und sind außerdem auf das Handbuch des IWF über die staatlichen Finanzstatistiken abgestimmt, wobei gleichwohl in den Untergliederungen einige Unterschiede zum ESVG bestehen.
KAPITEL 21
VERBINDUNGEN ZWISCHEN DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG UND DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN UND DER MESSUNG UNTERNEHMERISCHEN HANDELNS
|
21.01 |
Die betriebliche Buchführung stellt zusammen mit Unternehmenserhebungen eine Hauptquelle für Informationen über das unternehmerische Handeln in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dar. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und die betriebliche Buchführung weisen eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen auf, darunter insbesondere
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unterscheiden sich jedoch in mehreren Punkten von der betrieblichen Buchführung, da sie ein anderes Ziel verfolgen: Sie sollen innerhalb eines kohärenten Rahmens alle Tätigkeiten eines Landes und nicht nur die eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe darstellen. Mit diesem Ziel der kohärenten Abbildung aller Einheiten in einer Volkswirtschaft und ihrer Beziehungen zu der übrigen Welt gehen Beschränkungen einher, denen die betriebliche Buchführung nicht unterworfen ist. |
|
21.02 |
Für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gelten in jedem Land der Welt gemeinsame Normen, während sich die Entwicklung und Anwendung der betrieblichen Buchführung von Land zu Land unterscheiden. Die betriebliche Buchführung befindet sich jedoch auf dem Wege hin zu einer Anwendung gemeinsamer internationaler Normen. Der Harmonisierungsprozess auf globaler Ebene setzte am 29. Juni 1973 mit der Einrichtung des Ausschusses für internationale Rechnungslegungsgrundsätze (International Accounting Standards Committee, IASC) ein. Seine Aufgabe war es, grundlegende Rechnungslegungsnormen, erst IAS (International Accounting Standards) und später IFRS (International Financial Reporting Standards) genannt, auszuarbeiten, die weltweit angewandt werden können. In der Europäischen Union werden die konsolidierten Abschlüsse börsennotierter EU-Unternehmen seit dem Jahr 2005 gemäß dem IFRS-Bezugsrahmen aufgestellt. |
|
21.03 |
Ausführliche Leitlinien zum Inhalt der betrieblichen Buchführung und zur Frage, wie die betriebliche Buchführung und die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verknüpft werden, werden in spezialisierten Handbüchern dargestellt. In diesem Kapitel werden die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf der Grundlage der betrieblichen Buchführung beantwortet und spezifische Aspekte der Messung unternehmerischen Handelns behandelt. |
EINIGE SPEZIFISCHE REGELN UND METHODEN DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG
|
21.04 |
Um Informationen aus den betrieblichen Abschlüssen herauszufiltern, sollten die Fachleute für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die internationalen Rechnungslegungsnormen für private Unternehmen und staatliche Stellen kennen. Die Normen für private Unternehmen werden vom International Accounting Standards Board (IASB) aufgestellt und gepflegt und die für staatliche Stellen vom International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). In den folgenden Abschnitten werden allgemeine Grundsätze der betrieblichen Buchführung dargestellt. |
Buchungszeitpunkt
|
21.05 |
In der betrieblichen Buchführung werden Transaktionen zu dem Zeitpunkt gebucht, zu dem sie erfolgen und unabhängig von der Zahlung zur Entstehung von Forderungen und Verbindlichkeiten führen. Die Buchung erfolgt nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung im Gegensatz zum Grundsatz des Zahlungszeitpunkts. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden ebenfalls nach dem Grundsatz der periodengerechten Zurechnung erstellt. |
Doppelte und vierfache Buchführung
|
21.06 |
In der betrieblichen Buchführung wird jede Transaktion eines Unternehmens in mindestens zwei verschiedenen Konten erfasst, einmal auf der Sollseite und einmal auf der Habenseite in derselben Höhe. Dieses System der doppelten Buchführung ermöglicht eine Prüfung der Konsistenz der Konten. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen kann für die meisten Transaktionen auch ein System der vierfachen Buchführung verwendet werden. Eine Transaktion wird von jeder der beteiligten institutionellen Einheiten zweimal gebucht, beispielsweise einmal als eine nichtfinanzielle Transaktion im Produktions-, Einkommens- und Vermögensbildungskonto und einmal als eine finanzielle Transaktion im Zusammenhang mit der Änderung der Forderungen und Verbindlichkeiten. |
Bewertung
|
21.07 |
In der betrieblichen Buchführung und in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden Transaktionen zu dem von den Transaktionspartnern vereinbarten Preis gebucht. Aktiva und Passiva werden im Jahresabschluss von Unternehmenseinheiten in der Regel zu ihren Herstellungs- oder Anschaffungskosten bewertet, möglicherweise in Verbindung mit anderen Preisen, wie Marktpreisen für Vorräte. Finanzinstrumente sollten mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet werden, wodurch die beobachteten Marktpreise widergespiegelt werden sollen, ggf. unter Verwendung spezifischer Bewertungsverfahren. In Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden Aktiva und Passiva zu den jeweiligen Werten zu dem Zeitpunkt gebucht, auf den sich die Vermögensbilanz bezieht, und nicht zu ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. |
Gewinn- und Verlustrechnung und Vermögensbilanz
|
21.08 |
Für die betriebliche Buchführung werden zwei Bilanzen erstellt: die Gewinn- und Verlustrechnung und die Vermögensbilanz. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Transaktionen im Zusammenhang mit den Einnahmen und den Kosten zusammengefasst und in der Vermögensbilanz die Vermögensbestände und die Verbindlichkeiten. Diese Bilanzen weisen die Kontensalden und die Transaktionen auf einer aggregierten Ebene aus. Sie werden in Form von Konten dargestellt und sind eng miteinander verknüpft. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist als Saldo einen Gewinn oder Verlust des Unternehmens aus. Dieser Gewinn oder Verlust wird auch in die Vermögensbilanz aufgenommen. |
|
21.09 |
Die Transaktionskonten, deren Saldo in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten ist, sind Stromkonten. In ihnen werden die Gesamterträge und –aufwendungen des Geschäftsjahres dargestellt. |
|
21.10 |
Vermögensbilanzen sind Bestandskonten. Sie bilden den Wert der Forderungen und Verbindlichkeiten am Ende eines Geschäftsjahres ab. |
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN UND BETRIEBLICHE BUCHFÜHRUNG: PRAKTISCHE FRAGEN
|
21.11 |
Damit die Fachleute für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die betriebliche Buchführung in großem Umfang und nicht nur in isolierten Fällen nutzen können, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Die erste Bedingung ist der Zugang zur betrieblichen Buchführung. Normalerweise ist die Veröffentlichung der Abschlüsse für große Unternehmen obligatorisch. Datenbanken über solche Abschlüsse werden von privaten oder staatlichen Stellen eingerichtet, und es ist wichtig, dass die Fachleute für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf diese zugreifen können. Bei großen Unternehmen besteht in der Regel die Möglichkeit, die Abschlüsse direkt von ihnen zu erhalten. Die zweite Bedingung besteht in einem Mindestmaß an Standardisierung im Hinblick auf die von den Unternehmen veröffentlichten Buchführungsdokumente, da dies eine notwendige Bedingung für die computergestützte Datenverarbeitung darstellt. Ein hohes Maß an Standardisierung geht häufig mit dem Vorhandensein einer Stelle einher, die Unternehmensabschlüsse in entsprechend standardisierter Form erfasst. Die Erfassung kann auf freiwilliger Basis erfolgen, wenn eine Stelle eine Bilanzzentrale betreibt, die Prüfungen für ihre Mitglieder durchführt, oder sie kann gesetzlich vorgeschrieben sein, wenn die Datenerfassungsstelle die Steuerbehörde ist. In beiden Fällen müssen die Fachleute für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unter Beachtung der geltenden Geheimhaltungsvorschriften Zugang zu den Datenbanken beantragen. |
|
21.12 |
Die betriebliche Buchführung kann genutzt werden, wenn die Abschlüsse nicht nach einem standardisierten Verfahren erstellt werden. In vielen Ländern werden die Wirtschaftsbereiche von einer kleinen Anzahl großer Unternehmen dominiert und die Abschlüsse dieser Unternehmen können für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen genutzt werden. Nützliche Informationen kann auch in den Anmerkungen zu den Abschlüssen gefunden werden, wie mehr Details oder Orientierungshilfen für die Auslegung der Angaben in den Abschlüssen. |
|
21.13 |
Unternehmenserhebungen sind die andere wichtige Datenquelle für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen über unternehmerische Tätigkeiten. Solche Erhebungen liefern zufriedenstellende Ergebnisse, wenn die darin gestellten Fragen mit den Angaben und Konzepten der betrieblichen Buchführung vereinbar sind. Ein Unternehmen wird keine zuverlässigen Informationen liefern, die nicht auf seinem internen Informationssystem basieren. Unternehmenserhebungen sind in der Regel notwendig, auch im günstigsten Fall, wenn die Fachleute für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen Zugang zu den Datenbanken der betrieblichen Buchführung haben, da die in solchen Datenbanken enthaltenen Informationen selten ausführlich genug sind, um allen Anforderungen der Fachleute für Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu genügen. |
|
21.14 |
Die Globalisierung erschwert die Nutzung der betrieblichen Buchführung zum Zwecke der Erstellung Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Um nützlich zu sein, muss die betriebliche Buchführung auf nationaler Basis erstellt werden, und dies ist nicht der Fall, wenn Unternehmen Niederlassungen im Ausland haben. Geht die Tätigkeit des Unternehmens über das eigene Staatsgebiet hinaus, sind Anpassungen notwendig, um anhand der betrieblichen Buchführung ein nationales Bild zu zeichnen. Die Unternehmen müssen der Datenbank über die betriebliche Buchführung entweder auf nationaler Basis erstellte Abschlüsse zur Verfügung stellen oder die Anpassungen zur Erstellung der betrieblichen Buchführung auf nationaler Ebene. Werden die Abschlüsse der Unternehmen von der Steuerbehörde erfasst, verlangt die Steuerbehörde in der Regel, dass die Daten auf nationaler Basis zur Verfügung gestellt werden, damit die Ertragssteuer berechnet werden kann. Dies ist der günstigste Fall für die Verwendung der Daten für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. |
|
21.15 |
Eine weitere praktische Voraussetzung ist, dass das Geschäftsjahr mit dem Bezugszeitraum der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen übereinstimmen sollte. Bei jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist dies in der Regel das Kalenderjahr; daher ist es erstrebenswert, dass die Mehrheit dieser Unternehmen ihr Geschäftsjahr am 1. Januar beginnt, um eine optimale Nutzung der betrieblichen Buchführung zu ermöglichen. Unternehmen können andere Anfangsdaten für ihr Geschäftsjahr wählen. Bei Transaktionen, die Strömen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entsprechen, ist es häufig akzeptabel, Abschlüsse auf der Basis eines Kalenderjahres durch Verknüpfung von Teilen zweier aufeinander folgenden Geschäftsjahren neu zu erstellen. Bei Vermögensbilanzen führt diese Methode jedoch zu weniger zufriedenstellenden Ergebnissen, insbesondere im Hinblick auf Positionen, die starken Schwankungen im Jahresverlauf unterworfen sind. Vierteljährliche Abschlüsse werden häufig von großen Unternehmen erstellt, aber selten systematisch erfasst. |
DER ÜBERGANG VON DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG ZU VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGEN AM BEISPIEL NICHTFINANZIELLER UNTERNEHMEN
|
21.16 |
Die Verwendung von Daten aus der betrieblichen Buchführung nichtfinanzieller Unternehmen zur Erstellung Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen macht mehrere Anpassungen erforderlich. Diese Anpassungen können in drei Kategorien eingeteilt werden: konzeptionelle Anpassungen, Anpassungen zur Ermöglichung der Konsistenz mit anderen Sektoren und Anpassungen zur Gewährleistung der Vollständigkeit. |
Konzeptionelle Anpassungen
|
21.17 |
Konzeptionelle Anpassungen sind erforderlich, da bei der betrieblichen Buchführung nicht genau dieselben Konzepte verwendet werden wie bei den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, und da in Fällen, in denen diese Konzepte nah beieinander liegen, unter Umständen unterschiedliche Bewertungsmethoden angewandt werden. Beispiele für konzeptionelle Anpassungen zur Berechnung des Produktionswerts sind im Folgenden aufgeführt:
|
Anpassungen zur Ermöglichung der Konsistenz mit der Buchführung anderer Sektoren
|
21.18 |
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erfordern, dass die betriebliche Buchführung mit der Buchführung anderer Unternehmen und Einheiten in anderen institutionellen Sektoren konsistent ist. Folglich müssen auf der Grundlage der betrieblichen Buchführung bewertete Steuern und Subventionen mit den vom Staat eingenommenen oder gezahlten konsistent sein. In der Praxis wird dies nicht beobachtet und es ist eine Vorschrift erforderlich, um Konsistenz herzustellen. In der Regel sind staatliche Informationen zuverlässiger sind als die von Unternehmen und an den Daten der betrieblichen Buchführung werden Anpassungen vorgenommen. |
Beispiele für Anpassungen zur Gewährleistung der Vollständigkeit
|
21.19 |
Beispiele für Anpassungen der betrieblichen Buchführungsdaten zur Gewährleistung der Vollständigkeit sind der Mangel an statistischen Daten, Steuer- und Sozialversicherungsbefreiung sowie die Umgehung von Steuern und Sozialabgaben. Im Folgenden sind Beispiele für besondere Anpassungen aufgeführt:
|
SPEZIFISCHE FRAGEN
Umbewertungsgewinne/-verluste
|
21.20 |
Umbewertungsgewinne/-verluste sind ein wesentliches Problem beim Übergang von der betrieblichen Buchführung zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, was hauptsächlich auf die Art der in der betrieblichen Buchführung enthaltenen Daten zurückzuführen ist. Beispielsweise ist ein Vorleistungsverbrauch an Rohstoffen unter Umständen kein direkter Kauf, sondern eine Bestandsentnahme. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird die Bestandsentnahme zum jeweiligen Marktpreis bewertet, während die Bestandsentnahme in der betrieblichen Buchführung zu Anschaffungskosten bewertet wird, d. h. zum Preis der Güter zum Zeitpunkt ihres Erwerbs. Die Differenz zwischen den beiden Preisen wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Umbewertungsgewinn/-verlust bezeichnet. |
|
21.21 |
Die Beseitigung der Umbewertungsgewinne/-verluste aus den Bestandsgrößen ist nicht einfach, da dabei eine Erfassung zahlreicher Teile von zusätzlichen Buchungsinformationen und die Verwendung vieler Annahmen erforderlich werden. Die erfassten Informationen müssen sich sowohl auf die Art der Bestandsgüter als auch auf die Preisänderungen im Jahresverlauf beziehen. Da sich die zur Verfügung stehenden Informationen über die Art der Güter in den meisten Fällen auf die Käufe und Verkäufe und nicht auf den Bestand selbst beziehen, müssen die Schätzungen auf der Grundlage von Modellen erfolgen, deren Aussagekraft schwer nachprüfbar ist. Doch trotz dieser Ungenauigkeit ist dies der Preis, der zu zahlen ist, um die Daten der betrieblichen Buchführung verwenden zu können. |
|
21.22 |
Die Bewertungen der Aktiva mit dem beizulegenden Zeitwert zeichnen ein genaueres Bild von der Vermögensbilanz als Bewertungen zu Anschaffungskosten, doch sie führen auch zu mehr Daten zu Umbewertungsgewinnen/-verlusten. |
Globalisierung
|
21.23 |
Die Globalisierung erschwert die Nutzung der betrieblichen Buchführung bei Unternehmen mit Auslandsniederlassungen. Die jenseits der nationalen Grenzen ausgeübte Tätigkeit muss aus den Abschlüssen herausgenommen werden, um sie für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nutzen zu können. Diese Nichtberücksichtigung ist schwierig, außer im bestmöglichen Fall, wenn Steuervorschriften die Unternehmen dazu verpflichten, Abschlüsse ausschließlich für ihre Tätigkeit auf dem nationalen Staatsgebiet zu veröffentlichen. Die Existenz multinationaler Unternehmensgruppen führt zu Problemen bei der Bewertung, da Tauschgeschäfte zwischen Filialen auf der Basis von Preisen vorgenommen werden können, die nicht auf dem freien Markt beobachtet werden, sondern zur Minimierung der globalen Steuerlast festgelegt werden. Die für die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zuständigen Personen nehmen Anpassungen vor, um die Preise von Transaktionen innerhalb von Unternehmensgruppen mit den Marktpreisen in Einklang zu bringen. In der Praxis ist dies äußerst schwierig, da es an Informationen fehlt und kein vergleichbarer freier Markt für hochspezialisierte Güter existiert. Anpassungen können nur in Ausnahmefällen auf der Basis einer von entsprechenden Fachleuten anerkannten Analyse vorgenommen werden. |
|
21.24 |
Die Globalisierung hat die Wiedereinführung der Erfassung der Importe und Exporte auf der Grundlage des Eigentumswechsels anstelle der Veränderung des Standorts gefördert. Dadurch wird die betriebliche Buchführung geeigneter für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, da in der betrieblichen Buchführung ebenfalls ein Eigentumswechsel der Waren anstelle der physischen Veränderung des Standorts zugrunde gelegt wird. Wenn ein Unternehmen die Verarbeitung von einem außerhalb des nationalen Wirtschaftsgebiets ansässigen Unternehmens vornehmen lässt, ist die betriebliche Buchführung die geeignete Grundlage als eine Datenquelle für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Obgleich dies hilfreich ist, verbleiben viele Bemessungsfragen bei der Schätzung von multinationalen Unternehmen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. |
Fusionen und Übernahmen
|
21.25 |
Die Restrukturierung von Unternehmen verursacht das Entstehen und Verschwinden von Forderungen und Verbindlichkeiten. Wenn eine Kapitalgesellschaft von einer oder mehreren anderen Kapitalgesellschaften übernommen wird, verschwinden alle Forderungen und Verbindlichkeiten einschließlich Aktien und sonstige Anteilsrechte zwischen dieser Kapitalgesellschaft und den sie übernehmenden Kapitalgesellschaften aus dem System. Dieses Verschwinden wird als Änderung der Sektorzuordnung im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen gebucht. |
|
21.26 |
Der Erwerb von Aktien und sonstigen Anteilsrechten an einer Kapitalgesellschaft im Rahmen einer Fusion wird jedoch als finanzielle Transaktion zwischen der erwerbenden Kapitalgesellschaft und dem bisherigen Eigentümer gebucht. Der Umtausch vorhandener Aktien in Aktien der übernehmenden oder neuen Kapitalgesellschaft wird als Rücknahme von Aktien und gleichzeitige Ausgabe neuer Aktien gebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der übernommenen Kapitalgesellschaft und Dritten bleiben unverändert und gehen auf die übernehmende(n) Kapitalgesellschaft(en) über. |
|
21.27 |
Wenn eine Kapitalgesellschaft rechtlich in zwei oder mehr institutionelle Einheiten geteilt wird, werden neue Forderungen und Verbindlichkeiten (Entstehen von Forderungen) als Änderung der Sektorzuordnung gebucht. |
KAPITEL 22
SATELLITENKONTEN
EINLEITUNG
|
22.01 |
Dieses Kapitel vermittelt einen allgemeinen Überblick über Satellitenkonten. Es wird beschrieben und erörtert, wie der zentrale Rahmen als Baukastensystem genutzt werden kann, um den spezifischen Datenbedarf zahlreicher wichtiger Bereiche zu decken. |
|
22.02 |
Satellitenkonten dienen der Erstellung oder Modifizierung von Tabellen und Konten im zentralen Rahmen und damit der Deckung eines spezifischen Datenbedarfs. |
|
22.03 |
Der zentrale Rahmen besteht aus folgenden Komponenten:
Diese Konten und Tabellen können jährlich oder vierteljährlich erstellt werden und sich auf das ganze Land oder auf Regionen beziehen. |
|
22.04 |
Satellitenkonten können einen spezifischen Datenbedarf decken, indem sie detailliertere Informationen bereitstellen, Konzepte aus dem zentralen Rahmen neu ordnen oder ergänzende Informationen beispielsweise zu nichtmonetären Strömen und Beständen liefern. Diese Konten können von den zentralen Konzepten abweichen. Eine Veränderung der Konzepte kann die Verknüpfung mit wirtschaftstheoretischen Konzepten (z. B. Wohlfahrts- oder Transaktionskosten), administrativen Konzepten (z. B. steuerpflichtiges Einkommen oder Gewinne in der betrieblichen Buchführung) und wirtschaftspolitischen Konzepten (z. B. Konzepten wie strategische Wirtschaftsbereiche, wissensbasierte Wirtschaft oder Investitionstätigkeit der Unternehmen), die in der nationalen oder europäischen Wirtschaftspolitik verwendet werden, verbessern. In solchen Fällen enthält das Satellitensystem eine Tabelle, aus der hervorgeht, wie die wichtigsten Gesamtgrößen des Satellitensystems mit denen des zentralen Rahmens zusammenhängen. |
|
22.05 |
Satellitenkonten können von einfachen Tabellen bis zu erweiterten Kontensätzen reichen. Sie können jährlich oder vierteljährlich erstellt und veröffentlicht werden. Bei einigen Satellitenkonten ist eine Erstellung in größeren Zeitabständen, z. B. alle fünf Jahre, sinnvoll. |
|
22.06 |
Satellitenkonten können verschiedene Merkmale aufweisen:
Im konkreten Einzelfall kann mit einem oder mehreren der unter Buchstaben a) bis h) genannten Merkmale gearbeitet werden. Siehe dazu Tabelle 22.1. Tabelle 22.1 — Übersicht über Satellitenkonten und ihre wichtigsten Merkmale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.07 |
Im vorliegenden Kapitel werden die Merkmale von Satellitenkonten erörtert und folgende neun Satellitenkonten kurz beschrieben:
In anderen Kapiteln werden weitere Satellitenkonten beschrieben, die beispielsweise die Zahlungsbilanz, die staatliche Finanzstatistik, die monetären und finanziellen Statistiken sowie die ergänzende Tabelle zur Alterssicherung betreffen. Im SNA 2008 werden mehrere Satellitenkonten ausführlich beschrieben, die bis zu einem gewissen Grad auch vom ESVG 2010 abgedeckt sind. Dazu gehören zum Beispiel:
Um Höhe und Zusammensetzung der Steuern international vergleichen zu können, werden der OECD, dem IWF und Eurostat nationale Steuerstatistiken vorgelegt. Die Konzepte und Daten sind vollständig mit denen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verknüpft. Steuerstatistiken sind ein Beispiel für ein Satellitensystem der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die genannten Beispiele beziehen sich auf etablierte Satellitenkonten, denn für sie gelten internationale Leitlinien oder sie sind bereits Teil eines internationalen Übermittlungsprogramms. In verschiedenen Ländern entwickelte Satellitenkonten verdeutlichen die Bedeutung und Nützlichkeit solcher Konten; Beispiele hierfür sind
|
|
22.08 |
Bei einer großen Gruppe von Satellitenkonten wird ein funktionsspezifischer Ansatz verfolgt. Die verschiedenen funktionalen Untergliederungen werden in diesem Kapitel beschrieben. |
|
22.09 |
Die Vielfalt der Satellitenkonten macht deutlich, dass die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Referenzrahmen für unterschiedliche Arten von Statistiken dienen. Die Satellitensysteme veranschaulichen auch die Vorzüge und Grenzen des zentralen Rahmens. Bei der Anwendung der Konzepte, Klassifikationen und Darstellungen (z. B. der Aufkommens- und Verwendungstabellen) des zentralen Rahmens auf eine Vielzahl von Themen erweist sich die Flexibilität und Relevanz des Satellitenkonten-Ansatzes für diese Themen. Gleichzeitig machen die Zusätze, Umstellungen und konzeptionellen Modifikationen deutlich, wo die Grenzen des zentralen Rahmens bei der Untersuchung dieser Themen liegen. So weiten die Umweltkonten zum Beispiel den zentralen Rahmen aus, um externe Umweltkosten zu berücksichtigen, und die Konten zur Haushaltsproduktion erweitern die Produktionsgrenze, damit sie auch unentgeltliche häusliche Dienste erfasst. Damit wird klar, dass die im zentralen Rahmen verwendeten Konzepte Produkt, Einkommen und Konsum kein umfassendes Maß für Wohlstand sind. |
|
22.10 |
Zu den wesentlichen Vorteilen der Satellitenkonten gehören folgende Aspekte:
|
Funktionale Untergliederungen
|
22.11 |
Funktionale Untergliederungen unterscheiden die Ausgaben nach Sektoren und Verwendungszweck. Damit wird das Verhalten der Verbraucher, des Staates, der Organisationen ohne Erwerbszweck und der Produzenten verdeutlicht. |
|
22.12 |
Im ESVG gibt es folgende vier funktionale Untergliederungen:
|
|
22.13 |
In der COICOP wird zwischen 14 Hauptkategorien unterschieden:
Die ersten zwölf Kategorien ergeben zusammen die Konsumausgaben der privaten Haushalte. Die letzten beiden stehen für die individuell zurechenbaren Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und des Staates, also deren soziale Sachleistungen. Zusammen repräsentieren alle 14 Posten den Konsum (Verbrauchskonzept) der privaten Haushalte. |
|
22.14 |
Die individuell zurechenbaren Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und des Staates werden nach fünf gemeinsamen Unterkategorien unterteilt, die wichtige Politikbereiche repräsentieren: Wohnungswesen, Gesundheitswesen, Freizeit- und Kulturdienstleistungen, Bildungswesen, Dienstleistungen sozialer Einrichtungen. Das sind auch COICOP-Funktionen der Konsumausgaben der privaten Haushalte; Dienstleistungen sozialer Einrichtungen bilden eine Untergruppe der Kategorie 12 (Andere Waren und Dienstleistungen). Folglich geht aus der COICOP für jede dieser fünf gemeinsamen Unterkategorien auch die Bedeutung der privaten Haushalte, des Staates und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck hervor. So kann die COICOP zum Beispiel die Rolle des Staates bei der Bereitstellung von Wohnraum, Gesundheitsdienstleistungen und Bildung beschreiben. |
|
22.15 |
Die COICOP dient darüber hinaus weiteren wichtigen Zwecken; so können anhand der Unterkategorien die Ausgaben der privaten Haushalte für langlebige Konsumgüter dargestellt werden. Im Rahmen der Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte wird häufig eine Unterteilung auf der Grundlage der COICOP zur Erfassung von Informationen über die Ausgaben dieses Sektors verwendet. Die Ergebnisse können wiederum den Gütern in einer Aufkommens- und Verwendungstabelle zugewiesen werden. |
|
22.16 |
Die Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates (COFOG) ist ein wichtiges Instrument zur Beschreibung und Analyse der staatlichen Finanzen. Dabei wird zwischen zehn Hauptkategorien unterschieden:
Die Unterteilung kann zur Klassifizierung der Konsumausgaben des Staates für den Individual- und Kollektivverbrauch genutzt werden. Damit lässt sich aber auch die Bedeutung anderer Ausgabenarten wie Subventionen, Investitionszuschüsse und soziale Geldleistungen für die Verfolgung politischer Zwecke erhellen. |
|
22.17 |
Zur Beschreibung und Analyse der Ausgaben privater Organisationen ohne Erwerbszweck wird die COPNI genutzt. Dabei wird zwischen neun Hauptkategorien unterschieden:
|
|
22.18 |
Zur Beschreibung und Analyse des Produzentenverhaltens kann die COPP (Klassifikation der Herstellungskosten nach Zwecken) genutzt werden. Dabei wird zwischen sechs Hauptkategorien unterschieden:
In Verbindung mit nach Transaktionen aufgegliederten Informationen kann die COPP Informationen über die Ausgliederung („Outsourcing“) unternehmensbezogener Dienstleistungen bereitstellen, d. h. die Ablösung von Hilfstätigkeiten durch den Kauf entsprechender Dienstleistungen bei anderen Produzenten (z. B. Reinigungsarbeiten, Catering, Transport und Forschung). |
|
22.19 |
COFOG und COPP weisen die Ausgaben für Umweltschutz durch den Staat und die Produzenten aus. Diese Informationen werden zur Beschreibung und Analyse der Wechselwirkung zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt herangezogen. |
|
22.20 |
Einige Ausgaben wie Konsum und Vorleistungen können nach Funktion und nach Gütergruppe klassifiziert werden. Aus der Güterklassifikation geht hervor, um welche Güter es geht, und es werden die verschiedenen Produktionsprozesse und ihre Verbindung zu Aufkommen und Verwendung der Güter beschrieben. Ganz anders die funktionale Untergliederung:
|
HAUPTMERKMALE VON SATELLITENKONTEN
Funktionsspezifische Satellitenkonten
|
22.21 |
Bei funktionsspezifischen Satellitenkonten geht es um die Beschreibung und Analyse der Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt einer Funktion, wie Umwelt, Gesundheit sowie Forschung und Entwicklung. Für jede Funktion liegt ein Gesamtrechnungssystem vor. Mit den Satellitenkonten wird kein Überblick über die Volkswirtschaft gegeben, sondern sie konzentrieren sich auf die für die jeweilige Funktion relevanten Aspekte. Aus diesem Grund werden in ihnen Einzelinformationen ausgewiesen, die im aggregierten zentralen Rahmen nicht sichtbar sind, Informationen werden neu zusammengestellt oder Daten über nichtmonetäre Ströme und Bestände hinzugefügt, Aspekte, die für die gewählte Funktion irrelevant sind, werden vernachlässigt und funktionsspezifische Aggregate als Schlüsselkonzepte definiert. |
|
22.22 |
Der zentrale Rahmen ist vor allem institutioneller Natur. Bei einem funktionsspezifischen Satellitenkonto kann ein funktionsspezifischer Ansatz mit einer Analyse von Tätigkeiten und Gütern kombiniert werden. Ein solcher kombinierter Ansatz ist für viele Bereiche wie Kultur, Sport, Bildung, Gesundheit, Sozialschutz, Tourismus, Umweltschutz, Forschung und Entwicklung (F&E), Entwicklungshilfe, Verkehr, Sicherheit und Wohnungswesen relevant. Die meisten Bereiche beziehen sich auf Dienstleistungen; sie erstrecken sich im Allgemeinen auf eine Reihe von Tätigkeiten und entsprechen in vielen Fällen Themen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum oder sozialen Belangen. |
|
22.23 |
Ein Schlüsselkonzept der funktionsspezifischen Satellitenkonten sind die nationalen Ausgaben für die jeweilige Funktion, wie in Tabelle 22.2 dargestellt. Dieses Schlüsselkonzept ist auch für die Festlegung der Bereiche, auf die sich das funktionsspezifische Satellitenkonto erstrecken soll, nützlich. |
|
22.24 |
Um die Verwendung für eine Funktion zu analysieren, müssen Fragen gestellt werden wie: „Welche Ressourcen werden bereitgestellt für Bildung, Verkehr, Tourismus, Umweltschutz und Datenverarbeitung?“. Zur Beantwortung dieser Fragen müssen folgende Aspekte entschieden werden:
Tabelle 22.2 — Nationale Ausgaben für eine spezifische Funktion oder ein spezifisches Gut
Tabelle 22.3 — Aufkommen an charakteristischen und verwandten Gütern
Tabelle 22.4 — Verwendung charakteristischer und verwandter Güter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.25 |
Je nach Bereich ist ein Satellitenkonto ausgelegt für folgende Aspekte:
|
|
22.26 |
Es lassen sich zwei Arten von Gütern unterscheiden: charakteristische Güter und verwandte Güter. Die erste Kategorie erstreckt sich auf Güter, die für den untersuchten Bereich typisch sind. Dabei kann das Satellitenkonto aufzeigen, wie die Güter produziert werden, welche Art von Produzenten daran beteiligt ist, welche Art von Arbeitskräften und Anlagekapital sie dabei einsetzen und wie effizient der Produktionsprozess ist. Im Bereich Gesundheitswesen wären Gesundheitsdienstleistungen, Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, sowie Bildungs- und F&E-Dienstleistungen für diesen Bereich charakteristische Güter. |
|
22.27 |
Verwandte Güter sind entweder aufgrund ihrer Art oder ihrer Zuordnung zu breiter gefassten Güterkategorien für eine Funktion relevant, ohne dafür typisch zu sein. So stellt im Gesundheitswesen die Beförderung von Patienten eine verwandte Dienstleistung dar. Weitere Beispiele für verwandte Güter sind pharmazeutische Erzeugnisse und andere medizinische Produkte wie Brillen. Für solche Güter weist das Satellitenkonto keine Produktionsmerkmale aus. Die exakte Trennlinie zwischen charakteristischen und verwandten Gütern richtet sich nach der wirtschaftlichen Organisation eines Landes und dem Zweck des Satellitenkontos. |
|
22.28 |
Einige Dienstleistungen können in zwei oder mehr Satellitenkonten erscheinen. So ist die Forschung im Bereich Gesundheit an Hochschuleinrichtungen ein Produkt, das für Satellitenkonten des Bereichs Forschung und Entwicklung ebenso wie für solche Konten zu Bildung und Gesundheit von Bedeutung ist. Das bedeutet auch, dass sich die nationalen Ausgaben für verschiedene Funktionen teilweise überschneiden. Aggregiert man solche Ausgaben einfach, um den Gesamtbetrag als Anteil am BIP zu ermitteln, kann dies zu doppelter Erfassung führen. |
|
22.29 |
Die Konzepte in den Satellitenkonten können von denen im zentralen Rahmen abweichen. So kann die Freiwilligenarbeit in Satellitenkonten der Bereiche Gesundheit und Bildung aufgenommen werden. Bei einem Satellitenkonto für den Bereich Verkehr können die Hilfstätigkeiten des Transportgewerbes gesondert ausgewiesen werden. Bei einem Satellitenkonto für den Bereich Entwicklungshilfe werden die zu Vorzugsbedingungen gewährten Darlehen ausgewiesen. Die Vorteile bzw. Kosten, die aus unter den marktüblichen Sätzen liegenden Zinssätzen resultieren, werden als implizite Transfers gebucht. |
|
22.30 |
Bei Satellitenkonten der Bereiche Sozialschutz und Entwicklungshilfe bilden spezifische Transfers die wichtigste Komponente der nationalen Ausgaben. In anderen Bereichen wie Bildung und Gesundheit dient der größte Teil der Transfers (die meist Sachtransfers sind) zur Finanzierung des Erwerbs durch die Nutzer. Das bedeutet, dass sie bereits in den Ausgaben der Kategorien Endverbrauch, Vorleistungen und Investitionen erfasst sind und nicht doppelt erfasst werden sollten. Das trifft jedoch nicht auf alle Transfers zu; so können Stipendien neben der Finanzierung der Studiengebühren oder von Lehrbüchern beispielsweise zur Finanzierung verschiedener weiterer Ausgaben genutzt werden; dieser verbleibende Teil sollte dann als Transfer im Satellitenkonto ausgewiesen werden. |
|
22.31 |
Ein funktionsspezifisches Satellitenkonto kann einen Überblick über die Nutzer oder Leistungsempfänger vermitteln. Die Klassifizierung der Nutzer und Leistungsempfänger kann analog zur Sektorgliederung und der Klassifizierung der Produzententypen erfolgen, also Marktproduzenten, Nichtmarktproduzenten, Staat als kollektiver Verbraucher, private Haushalte als Verbraucher und übrige Welt. Dabei kann zwischen mehreren Unterkategorien unterschieden werden, z. B. nach Wirtschaftsbereich und nach institutionellen Teilsektoren. |
|
22.32 |
In zahlreichen Satellitenkonten bilden private Haushalte oder Einzelpersonen die wichtigste Art von Nutzern und Leistungsempfängern. Aus sozialpolitischer und analytischer Sicht macht dies eine weitere Aufschlüsselung der Haushalte erforderlich. Je nach Zweck können unterschiedliche Kriterien wie Einkommen, Alter, Geschlecht, Standort usw. herangezogen werden. Unter politischen und analytischen Gesichtspunkten wird die Zahl der in jeder Kategorie betroffenen Personen benötigt, um den durchschnittlichen Verbrauch oder Transfer oder die Zahl der Personen, die von einer Maßnahme nicht profitieren, zu berechnen. |
Spezielle Sektorkonten
|
22.33 |
Spezielle Sektorkonten bieten einen Überblick über einen Wirtschaftsbereich oder ein Gut, eine Zusammenfassung verschiedener Wirtschaftsbereiche oder Güter, einen Teilsektor oder eine Zusammenfassung verschiedener Teilsektoren. Es kann zwischen drei Arten von speziellen Sektorkonten unterschieden werden:
Beispiele für spezielle Sektorkonten, die eine Verknüpfung zu Wirtschaftsbereichen oder Gütern aufweisen, sind Konten für die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Tourismus, IKT, Energie, Verkehr, Wohnungswesen sowie für den Kreativbereich. Beispiele für spezielle Sektorkonten, die eine Verknüpfung zu institutionellen Sektoren aufweisen, sind staatliche Finanzstatistiken, monetäre und Finanzstatistiken, Zahlungsbilanz, Konten des öffentlichen Sektors, Konten für Organisationen ohne Erwerbszweck, Konten der privaten Haushalte sowie Konten zur Unternehmenstätigkeit. Die Steuerstatistiken können als ergänzende Tabellen zu den Staatsfinanzen betrachtet werden. |
|
22.34 |
Im Mittelpunkt von speziellen Sektorkonten kann auch eine integrierte Analyse der wirtschaftlichen Vorgänge innerhalb eines oder mehrerer institutioneller Sektoren stehen. So können beispielsweise durch eine Zusammenfassung nach der jeweiligen Haupttätigkeit Konten für Teilsektoren der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften erstellt werden. Die Analyse kann sich auf den gesamten Wirtschaftskreislauf von der Produktion bis zur Akkumulation erstrecken. Dies kann systematisch auf ziemlich aggregierter Ebene der gängigen Klassifikation der Wirtschaftsbereiche erfolgen. Das kann auch für eine Auswahl bestimmter Wirtschaftsbereiche geschehen, die für ein Land von besonderem Interesse sind. Ähnliche Analysen lassen sich auch für die Haushaltsproduktion durchführen, zumindest bis zu dem Punkt, an dem Unternehmensgewinne ermittelt werden. Ferner kann es sinnvoll sein, Tätigkeiten hervorzuheben, die für die Transaktionen einer Volkswirtschaft mit der übrigen Welt von besonderer Bedeutung sind. Dazu können der Mineralölsektor, das Bankgewerbe, der Bergbau, Tätigkeiten in Verbindung mit bestimmten Anbaukulturen, Nahrungsmitteln und Getränken (wie Kaffee, Blumen, Wein und Whiskey) und der Tourismus zählen. Durch ihren wesentlichen Anteil an den Ausfuhren, der Beschäftigung, den Devisenbeständen und den staatlichen Ressourcen können sie einen maßgeblichen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten. Zu den wichtigen Sektoren zählen gegebenenfalls auch solche, die aus sozialökonomischer Sicht besondere Aufmerksamkeit verdienen. Ein Beispiel dafür sind landwirtschaftliche Tätigkeiten, die auf zentralstaatlicher, lokaler oder europäischer Ebene subventioniert werden, in den Genuss anderweitiger Transfers kommen oder durch Einfuhrzölle in erheblicher Höhe geschützt werden. |
|
22.35 |
Zur Erstellung spezieller Sektorkonten sind zunächst die Haupttätigkeiten und die dazugehörigen Güter zu definieren. Zu diesem Zweck sind gegebenenfalls Posten der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC) oder der entsprechenden nationalen Klassifikation zusammenzufassen. Die Erweiterung des Schlüsselsektors richtet sich nach den wirtschaftlichen Bedingungen und den politischen und analytischen Anforderungen. |
|
22.36 |
Ein Waren- und Dienstleistungskonto für die Schlüsselgüter weist die Ressourcen und die Verwendung dieser Güter aus. Ein Produktionskonto und ein Einkommensentstehungskonto für die wichtigsten Wirtschaftsbereiche werden erstellt. Für die wichtigsten Wirtschaftsbereiche und Güter wird mit detaillierten Klassifikationen gearbeitet, um ein umfassendes Verständnis des Wirtschaftskreislaufs und der entsprechenden Bewertungsverfahren in diesem Bereich zu ermöglichen. Im Allgemeinen liegen eine Kombination aus Marktpreisen und administrierten Preisen und ein komplexes System von Steuern und Subventionen vor. |
|
22.37 |
Die Schlüsselgüter und -wirtschaftsbereiche können im Rahmen einer Aufkommens- und Verwendungstabelle analysiert werden, wie aus den Tabellen 22.5 und 22.6 hervorgeht. Die Schlüsselbereiche werden detailliert in den Spalten aufgeführt, während andere Wirtschaftsbereiche aggregiert werden können. In den Zeilen werden die Schlüsselgüter ähnlich detailliert ausgewiesen, während andere Güter aggregiert werden können. Die Zeilen am unteren Ende der Verwendungstabelle zeigen den Arbeitseinsatz, die Bruttoanlageinvestitionen und den Bestand der Anlagegüter an. Wenn die Haupttätigkeiten von sehr heterogenen Produzententypen, wie Kleinbauern und Großplantagen, die großen Unternehmen gehören und von ihnen betrieben werden, ausgeführt werden, wird zwischen den beiden Gruppen von Produzenten unterschieden, da sie unterschiedliche Kostenstrukturen und Verhaltensmuster aufweisen. |
|
22.38 |
Für den Schlüsselsektor wird ein Kontensystem erstellt. Zu diesem Zweck muss der Schlüsselsektor abgegrenzt werden. Im Falle der Mineralölgewinnung und des Bergbaus setzt sich der Schlüsselsektor im Allgemeinen aus einer begrenzten Anzahl großer Kapitalgesellschaften zusammen. Sämtliche Transaktionen dieser Unternehmen werden erfasst, einschließlich Nebentätigkeiten. Auch die Unterscheidung zwischen öffentlich kontrollierten, ausländisch kontrollierten und inländisch privat kontrollierten Kapitalgesellschaften kann im Zusammenhang mit Schlüsselsektoren von grundlegender Bedeutung sein. Die betriebliche Buchführung jeder großen Kapitalgesellschaft muss zum Zweck einer integrierten Analyse eingehend untersucht werden. Einige Bergbautätigkeiten werden gegebenenfalls von kleinen Kapitalgesellschaften oder von Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit durchgeführt. Diese Einheiten müssen in den Schlüsselsektor aufgenommen werden, auch wenn man sich dazu auf Teilinformationen aus statistischen Erhebungen oder administrative Angaben stützen muss. |
|
22.39 |
In vielen Fällen spielt der Staat in Verbindung mit Haupttätigkeiten eine wichtige Rolle, und zwar entweder über Steuereinnahmen und Einnahmen aus Vermögenseinkommen oder über Regulierungstätigkeit und Subventionen. Folglich gilt es, die Transaktionen zwischen dem Schlüsselsektor und dem Staat eingehend zu untersuchen. Die Klassifikation der Transaktionen kann dahingehend erweitert werden, dass jene Ströme ermittelt werden, die eine Verbindung zur Haupttätigkeit aufweisen, einschließlich der entsprechenden Gütersteuern. Solche Ströme fließen neben dem Haushalt selbst verschiedenen staatlichen Stellen zu, wie Ministerien zur Sonderverwendung, Universitäten, Fonds und Sonderkonten. Zu Analysezwecken kann es sehr sinnvoll sein, eine Aussage zur Verwendung solche Mittel durch den Staat zu treffen. Dies erfordert eine Analyse, die sich an den Zwecken dieses Teils der Ausgaben des Staates orientiert. Tabelle 22.5 — Aufkommenstabelle für Schlüsselwirtschaftsbereiche und -güter
Tabelle 22.6 — Verwendungstabelle für Schlüsselwirtschaftsbereiche und -güter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.40 |
Wenn den Haupttätigkeiten natürliche nicht erneuerbare Ressourcen wie Bodenschätze zugrunde liegen, werden in den Konten der Schlüsselsektoren die Veränderungen dieser Ressourcen aufgrund von Neuerschließungen und Abbau im Konto sonstiger realer Vermögensänderungen und ihre Umbewertungsgewinne/-verluste im Umbewertungskonto aufgeführt. Solche Angaben sind für die Bewertung der wirtschaftlichen Ergebnisse der betreffenden Volkswirtschaft von entscheidender Bedeutung. Generell können die Konten der Schlüsselsektoren zu einem Umweltgesamtrechnungssystem erweitert werden. |
|
22.41 |
Die Konten der Schlüsselsektoren können im Rahmen zusammengefasster Konten dargestellt werden. Dazu wird eine Spalte oder eine Gruppe von Spalten für Schlüsselsektoren eingeführt, und andere Spalten werden erforderlichenfalls umbenannt, z. B. in „sonstige nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften“ oder „sonstige Haushalte“. Damit wird es möglich, die jeweiligen Anteile des Schlüsselsektors und weiterer Sektoren an Transaktionen und Kontensalden zu erfassen. Das genaue Format einer derartigen Tabelle richtet sich nach den verfolgten Zielen. Ferner könnten in zusätzlichen Tabellen die genauen Beziehungen zwischen dem Schlüsselsektor und weiteren Sektoren einschließlich der übrigen Welt („von wem zu wem“) aufgeführt werden. |
Berücksichtigung nichtmonetärer Angaben
|
22.42 |
Ein wichtiges Merkmal vieler Satellitenkonten ist die Berücksichtigung nichtmonetärer Angaben wie Daten zu CO2-Emission nach Wirtschaftsbereich in den Umweltkonten oder die Zahl der Behandlungen nach Gesundheitsleistung in den Gesundheitskonten. Die Verbindung solcher nichtmonetärer Daten mit monetären Daten kann wichtige Verhältniszahlen liefern, z. B. CO2-Emission je Milliarde Euro Wertschöpfung oder die Kosten je Behandlung. Tabelle 22.7 enthält zahlreiche Beispiele. |
Detailgenauigkeit und ergänzende Konzepte
|
22.43 |
Zwei weitere wichtige Merkmale von Satellitenkonten sind deren zusätzliche Details und ergänzende Konzepte. Die Tabellen 22.8 und 22.9 enthalten eine Vielzahl von Beispielen. Tabelle 22.7 — Beispiele für nichtmonetäre Angaben in Satellitenkonten
Tabelle 22.8 — Beispiele besonderer Detailgenauigkeit in verschiedenen Satellitenkonten
Tabelle 22.9 — Beispiele für ergänzende Konzepte in verschiedenen Satellitenkonten
|
Andere grundlegende Konzepte
|
22.44 |
Die Anwendung anderer Grundkonzepte ist bei Satellitensystemen selten. Eine relativ geringfügige Abweichung besteht darin, dass bei verschiedenen Satellitenkonten einige Dienstleistungen nicht als Hilfstätigkeiten behandelt werden. So werden bei einem Satellitenkonto des Bereichs Verkehr Verkehrsdienstleistungen nicht als Hilfstätigkeiten behandelt. Bei einigen Satellitenkonten können jedoch wesentliche Änderungen in Bezug auf die grundlegenden Konzepte erforderlich sein; so könnte im Umweltkonto das Inlandsprodukt um den Abbau natürlicher Ressourcen bereinigt werden. Beispiele dafür liefert Tabelle 22.10. |
Nutzung von Modellen und Versuchsergebnissen
|
22.45 |
Einige Satellitensysteme zeichnen sich durch die Einbeziehung von Versuchsergebnissen oder die Nutzung von Modellen aus; die Angaben in solchen Satellitenkonten sind weniger zuverlässig als die in den Kernkonten. Doch erfordert auch die Erstellung von Kernkonten die Nutzung ökonometrischer oder mathematischer Modelle sowie von Versuchsergebnissen. Es besteht folglich kein grundlegender Unterschied zwischen dem Rahmen für Kernkonten und den Satellitenkonten. Diese Punkte werden anhand der Beispiele in Tabelle 22.11 veranschaulicht. Tabelle 22.10 — Beispiele für andere Grundkonzepte in Satellitenkonten
Tabelle 22.11 — Beispiele für die Nutzung ökonometrischer oder mathematischer Modelle bei der Erstellung des zentralen Rahmens und von Satellitenkonten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestaltung und Erstellung von Satellitenkonten
|
22.46 |
Ein Satellitenkonto wird in vier Schritten gestaltet und erstellt:
|
|
22.47 |
Wird erstmals ein Satellitenkonto gestaltet und erstellt, kommt es bei den vier Schritten häufig zu unerwarteten Ergebnissen. Folglich ist die Erstellung von Satellitenkonten ein Prozess, der sich nicht ohne weiteres abschließen lässt. Erst wenn Erfahrungen bei der Erstellung und Nutzung von Satellitenkonten gesammelt und die notwendigen Änderungen eingearbeitet worden sind, ist es möglich, einen experimentellen Tabellensatz in ein ausgereiftes statistisches Produkt zu verwandeln. |
|
22.48 |
Bei der Auswahl der erforderlichen Elemente aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) können drei Aspekte hervorgehoben werden: die internationalen Konzepte der VGR, die in den VGR eines Landes genutzten operationellen Konzepte und die Zuverlässigkeit der VGR. |
|
22.49 |
Werden bei der Gestaltung und Erstellung eines Satellitenkontos die Konzepte des zentralen Rahmens angewendet, treten häufig bestimmte Merkmale zutage. Diese können im Hinblick auf den Zweck sowohl hilfreich sein als auch unerwartete Beschränkungen darstellen. Wird beispielsweise erstmals ein Satellitenkonto für den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) erstellt, so können Probleme auftreten, die z. B. eine Überschneidung mit der F&E bei Software und im Gesundheitswesen oder die Rolle von multinationalen Unternehmen bei der Einfuhr und Ausfuhr von F&E betreffen. |
|
22.50 |
Ähnlich verhält es sich bei den operationellen Konzepten, die bei der Erstellung der Statistiken im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen genutzt werden. So stellt sich möglicherweise heraus, dass wesentliche Details fehlen, weil die Daten auf der Ebene der Erstellung oder Veröffentlichung zu stark aggregiert sind, oder dass die weltweiten Konzepte nicht präzise angewandt wurden. So werden die F&E-Tätigkeiten einiger großer multinationaler Unternehmen möglicherweise im Wirtschaftsbereich ihrer Haupttätigkeit berücksichtigt und nicht im Bereich von F&E-Leistungen. |
|
22.51 |
Die Zuverlässigkeit von Teilen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen kann ein Problem darstellen. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wurden ohne Berücksichtigung des Zwecks des Satellitenkontos erarbeitet und veröffentlicht. Wählt man lediglich die entsprechenden Zahlen aus den offiziellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen aus, wird man oftmals feststellen, dass Umfang und Zusammensetzung der Daten oder deren Entwicklung im Zeitverlauf für den speziellen Zweck nicht plausibel sind. Folglich müssen aktuelle Datenquellen und Berechnungsmethoden überprüft und durch zusätzliche Datenquellen oder verbesserte Berechnungsverfahren ergänzt werden. |
|
22.52 |
Die Auswahl der entsprechenden Informationen aus anderen Quellen als den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (z. B. sonstige amtliche Statistiken oder administrative Datenquellen) kann in Bezug auf Konzepte und Zahlen ähnlich problematisch sein: Die offiziell genutzten Konzepte können mit Blick auf den speziellen Zweck des Satellitenkontos unerwartete Schwächen offenbaren, die tatsächlich genutzten Konzepte weichen u. U. von den offiziellen Konzepten ab, und Zuverlässigkeit, Ausführlichkeit, Zeitpunkt und Häufigkeit können sich ebenfalls als problematisch erweisen. All diese Probleme sollten angegangen werden, entweder durch zusätzliche Schätzungen, um Unterschiede bei den Konzepten auszugleichen, oder durch die Klassifikation von Stromgrößen in nichtmonetären Kategorien nach Wirtschaftsbereich oder Sektor oder durch eine Anpassung der im Satellitenkonto verwendeten Konzepte. |
|
22.53 |
Die Verbindung von Informationen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit den anderen Informationen zu einem einzigen Satz von Tabellen oder Konten erfordert zusätzliche Arbeit: So sollten Auslassungen, Überschneidungen und zahlenmäßige Widersprüche beseitigt und die Plausibilität der Ergebnisse überprüft werden. Nach Möglichkeit sollte sich ein ausgewogener Tabellensatz ergeben. Gegebenenfalls ist es jedoch erforderlich, auf Diskrepanzen zwischen verschiedenen Datenquellen und Ansätzen hinzuweisen. |
|
22.54 |
Die Umwandlung eines in sich schlüssigen Satellitenkontos in ein Produkt für Datennutzer kann zusätzliche Schritte erfordern. So könnte eine Übersichtstabelle mit Schlüsselindikatoren für eine Reihe von Jahren vorgesehen werden. Diese Schlüsselindikatoren könnten der Beschreibung des Umfangs sowie von Komponenten und Entwicklungen der jeweiligen Problematik dienen, oder sie könnten Bezüge zur Volkswirtschaft und deren wichtigsten Komponenten herstellen. Das Konto könnte für politische oder analytische Zwecke um zusätzliche Details oder Klassifikationen ergänzt werden. Details, die mit wenig Zugewinn oder einem relativ hohen Kostenaufwand verbunden sind, können weggelassen werden. Ferner sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Komplexität der Tabellen zu verringern, sie einfacher und transparenter für Datennutzer zu gestalten, und es sollte eine gesonderte Tabelle mit gängigen Buchführungsuntergliederungen vorgesehen werden. |
NEUN SPEZIFISCHE SATELLITENKONTEN
|
22.55 |
Im verbleibenden Teil dieses Kapitels sollen die folgenden Satellitenkonten kurz erörtert werden:
|
Landwirtschaftskonten
|
22.56 |
Ein Beispiel für ein Landwirtschaftskonto ist die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR) (1). Sie dient der Beschreibung der landwirtschaftlichen Produktion und der Entwicklung des landwirtschaftlichen Einkommens. Diese Informationen werden genutzt, um die Wirtschaftslage der Landwirtschaft eines Mitgliedstaats zu analysieren und die Gemeinsame Agrarpolitik in der Union zu überwachen und zu evaluieren. |
|
22.57 |
Die LGR umfasst ein Produktionskonto, ein Einkommensentstehungskonto, ein Unternehmensgewinnkonto und ein Vermögensbildungskonto für die Agrarproduktion. Das Produktionskonto enthält eine systematische Gliederung, aus der die Produktion für eine Reihe von Agrarerzeugnissen sowie aus nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten hervorgeht; auch Vorleistungen und Investitionen werden sehr detailliert erfasst. Die Daten für Produktionskonto und Bruttoanlageinvestitionen sind sowohl in jeweiligen Preisen als auch in preisbereinigter Form ausgewiesen. Zusätzlich sind folgende drei Einkommensindikatoren des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs vorgesehen:
Die Indizes und Änderungsraten der Einkommensindikatoren in realen Größen werden durch Deflationierung der entsprechenden nominalen Angaben mit dem impliziten Preisindex des BIP ermittelt. |
|
22.58 |
Der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft in der LGR ähnelt stark dem landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereich im zentralen Rahmen. Es bestehen jedoch einige Unterschiede. So sind Einheiten, die Saatgut für Forschungszwecke oder zur Zertifizierung erzeugen oder Einheiten, für die die landwirtschaftliche Tätigkeit lediglich eine Freizeitbeschäftigung darstellt, nicht berücksichtigt. Doch die meisten landwirtschaftlichen Tätigkeiten von Einheiten, deren Haupttätigkeit nichtlandwirtschaftlicher Art ist, werden im Rahmen des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft in der LGR erfasst. |
|
22.59 |
Im Mittelpunkt der LGR stehen der Produktionsprozess und das damit erzielte Einkommen. Im Prinzip muss ein landwirtschaftliches Satellitenkonto der LGR jedoch nicht vollständig entsprechen. Landwirtschaftliche Konten könnten auch eine Aufkommens- und Verwendungstabelle enthalten, die einen systematischen Überblick über das Aufkommen und die Verwendung von Agrarerzeugnissen bietet. Darin wären Informationen zur Rolle von Importen (einschließlich der Rolle von Importabgaben) und zur Entwicklung der Nachfrage nach Agrarerzeugnissen (z. B. Exporte und Konsum der privaten Haushalte) sowie zur Rolle damit verbundener Steuern und Subventionen enthalten. Die Landwirtschaftskonten könnten durch Aufnahme nichtlandwirtschaftlicher Nebentätigkeiten wie jene, die eine Freizeitbeschäftigung darstellen, erweitert werden. Dies könnte wichtige Tendenzen und Substitutionsmechanismen aufzeigen. Die Wechselwirkung mit dem Staat kann anhand einer Tabelle veranschaulicht werden, die sämtliche Einkommens- und Vermögenstransfers des Staates auf der lokalen, zentralstaatlichen und europäischen Ebene an den Wirtschaftsbereich Landwirtschaft ausweist; das kann auch die Sonderbehandlung im Rahmen des Abgabensystems beinhalten. Landwirtschaftliche Konten können auch wie spezielle Sektorkonten gestaltet werden und eine vollständige Kontenabfolge einschließlich Vermögensbilanz und Finanzierungskonten für Landwirte und in der Landwirtschaft tätige Kapitalgesellschaften umfassen. |
Umweltkonten
|
22.60 |
In den internationalen Leitlinien für Umweltkonten (System für umweltökonomische Gesamtrechnungen — System of Environmental and Economic Accounting (SEEA), 2003) (2) wird ein kompliziertes Rechnungssystem zur Beschreibung und Analyse der Umwelt und ihrer Wechselwirkung mit der Wirtschaft vorgestellt. Die Umweltkonten sind ein Satellitenkonto der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Das bedeutet, dass dieselben Klassifikationen und Konzepte verwendet werden; Modifikationen werden nur dann vorgenommen, wenn das für den Zweck der Umweltkonten erforderlich ist. |
|
22.61 |
Die integrierte Gesamtrechnung für umweltökonomische Informationen gestattet eine Analyse des Beitrags, den die Umwelt zur Wirtschaft leistet sowie der Auswirkungen der Wirtschaft auf die Umwelt. Sie liefert den politischen Entscheidungsträgern Indikatoren und deskriptive Statistiken, zur Überwachung der Wechselbeziehungen zwischen Umwelt und Wirtschaft. Sie kann zudem für die strategische Planung und politische Analyse zur Ermittlung von Wegen zu einer nachhaltigeren Entwicklung nützlich sein. So müssen sich politische Entscheidungsträger, die die Entwicklung von Wirtschaftsbereichen bestimmen, welche in großem Umfang Umweltressourcen entweder als Input oder als Senke nutzen, der langfristigen Umweltauswirkungen bewusst sein. Politiker, die Umweltnormen festlegen, müssen dabei an die wahrscheinlichen Auswirkungen für die Wirtschaft denken. Zum Beispiel ist zu bedenken, für welche Industriezweige das wahrscheinlich mit Nachteilen verbunden ist und mit welchen Auswirkungen auf Beschäftigung und Kaufkraft gerechnet werden muss. Beim Vergleich alternativer Umweltstrategien sollten die jeweiligen wirtschaftlichen Konsequenzen in Betracht gezogen werden. |
|
22.62 |
Im zentralen Rahmen werden verschiedene Aspekte der Umweltgesamtrechnung berücksichtigt. So werden vor allem viele kosten- und kapitalbezogene Bilanzierungsposten für natürliche Ressourcen in den Klassifikationen und Konten für Bestände und sonstige reale Änderungen an Vermögensgütern gesondert ausgewiesen. Zum Beispiel weist die Kategorie der nicht produzierten Vermögensgüter die Bodenschätze Erdöl- und mineralische Reserven, freie Tier- und Pflanzenbestände sowie Wasserreserven getrennt aus. Solche Merkmale erleichtern die Nutzung des zentralen Rahmens als Ausgangspunkt für die Umweltgesamtrechnung. Doch einige Elemente des zentralen Rahmens, insbesondere jene im Konto für sonstige reale Vermögensänderungen, werden im Satellitenkonto weiter aufgeschlüsselt und neu klassifiziert, und es kommen weitere Elemente hinzu. |
|
22.63 |
Aus ökologischer Sicht weisen der zentrale Rahmen und seine Schlüsselaggregate wie BIP, Investitionen und Sparen zwei wesentliche Nachteile auf. Erstens werden der Abbau und die Knappheit natürlicher Ressourcen nur begrenzt berücksichtigt, und diese Faktoren können die Produktivität der Wirtschaft auf lange Sicht gefährden. Zweitens wird im zentralen Rahmen nicht auf die Degradation der Umwelt und ihre Folgen für die menschliche Gesundheit und die Wohlfahrt der Menschen eingegangen. |
|
22.64 |
Im zentralen Rahmen werden bei der Berechnung der Nettowertschöpfung lediglich produzierte Vermögensgüter berücksichtigt. Die Kosten ihrer Verwendung kommen in den Vorleistungen und Abschreibungen zum Ausdruck. Nicht produziertes Naturvermögen — wie Grund und Boden, Bodenschätze und Wälder — gehört insofern zu den Vermögensgütern, als es der effektiven Kontrolle institutioneller Einheiten unterliegt. Die Verwendung dieses Vermögens wird jedoch bei den Produktionskosten nicht berücksichtigt. Das bedeutet entweder, dass der Preis der produzierten Güter diese Kosten nicht reflektiert oder dass diese Kosten — im Falle von Abbaukosten — anderen nicht ausgewiesenen Elementen bei der auf dem Restwert basierenden Ableitung des Betriebsüberschusses zugeordnet werden. Umweltkonten ermöglichen die explizite Ausweisung und Schätzung derartiger Kosten. |
|
22.65 |
Der Umweltgesamtrechnungsrahmen des SEEA 2003 umfasst fünf Kategorien:
|
|
22.66 |
Physische und hybride Stromgrößenkonten erfassen vier verschiedene Arten von Stromgrößen:
|
|
22.67 |
Physische Stromgrößen werden in Mengeneinheiten angegeben, die die physischen Merkmale des entsprechenden Materials bzw. der entsprechenden Energie oder der entsprechenden Reststoffe wiedergeben. Eine physische Stromgröße kann je nach dem zu berücksichtigenden Merkmal in unterschiedlichen Einheiten gemessen werden. Welche Einheit angemessen ist, richtet sich nach dem Zweck und der beabsichtigten Verwendung des Stromgrößenkontos. Bei der Gesamtrechnung physischer Stromgrößen sind Gewicht und Volumen die am häufigsten verwendeten physischen Merkmale. Bei Energieströmen sind Joule oder Tonnen Öläquivalent die am weitesten verbreiteten Einheiten. Die Mengeneinheiten der physischen Stromgrößenkonten unterscheiden sich von dem im zentralen Rahmen verwendeten Volumen. So kommt im zentralen Rahmen das Volumen eines Computers nicht in seinem Gewicht zum Ausdruck, sondern besteht aus einer gewichteten Mischung vom Nutzer gewünschter Merkmale, z. B. der Rechengeschwindigkeit. |
|
22.68 |
Physische Stromgrößenkonten lassen sich als Aufkommens- und Verwendungstabellen darstellen. Dies zeigen die Tabellen 22.12 und 22.13. |
|
22.69 |
Hybride Stromgrößenkonten enthalten sowohl monetäre Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als auch physische Stromgrößenkonten und stellen diese in Matrixform dar. Hybride Aufkommens- und Verwendungskonten sind eine wichtige Art von Hybridkonten; sie kombinieren Informationen aus physischen Aufkommens- und Verwendungstabellen mit Informationen aus monetären Aufkommens- und Verwendungstabellen. |
|
22.70 |
Die Informationen in den hybriden Stromgrößenkonten können mit Umweltthemen von besonderem Belang verknüpft werden, wie die Wirkung von Treibhausgasen, der Abbau der Ozonschicht und die Versauerung. Dazu sind die Angaben für spezifische Substanzen mithilfe von Umrechnungsfaktoren in aggregierte Indikatoren für die entsprechenden Umweltthemen umzuwandeln. Daraus lässt sich eine Übersichtstabelle erstellen, aus der der Beitrag des Verbrauchs und der Produktion einzelner Wirtschaftsbereiche zu verschiedenen Umweltthemen und zum BIP hervorgeht wie in Tabelle 22.14. Tabelle 22.12 — Physische Aufkommens- und Verwendungstabelle Physisches Aufkommen
Tabelle 22.13 — Physische Aufkommens- und Verwendungstabelle (Fortsetzung) Physische Verwendung
Tabelle 22.14 — Nettobeitrag von Verbrauch und Produktion zum BIP und zu sechs Umweltthemen in den Niederlanden, 1993 Prozentualer Anteil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.71 |
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für umweltbezogene Transaktionen bestehen aus Umweltschutzkonten und Konten für sonstige umweltbezogene Transaktionen wie Steuern, Subventionen, Investitionsbeihilfen, Vermögenseinkommen und Erwerb von Emissions- und Eigentumsrechten. |
|
22.72 |
Für die Beschreibung des Umweltschutzes ist ein funktionaler Ansatz in Verbindung mit einer Analyse von Tätigkeiten und Gütern sehr nützlich. Unter den Umweltschutz fällt eine Vielzahl an wirtschaftlichen Tätigkeiten und Erzeugnissen. Beispiele sind Investitionen in saubere Technologien, Sanierung der Umwelt nach Verschmutzung, Wiederverwertung, Erzeugung von Umweltgütern und -dienstleistungen, Erhaltung und Verwaltung von Naturvermögen und natürlichen Ressourcen. Es kann eine nationale Gesamtgröße der Umweltschutzausgaben definiert werden, um Hilfstätigkeiten und verwandte Produkte einzuschließen. |
|
22.73 |
Bei den Umweltvermögenskonten werden drei Arten von Umweltvermögensgütern unterschieden: natürliche Ressourcen, Land und Oberflächengewässer sowie Ökosysteme. Mehrere dieser Umweltvermögensgüter werden nicht im zentralen Rahmen erfasst. Dies gilt für Umweltvermögensgüter, bei denen kein Eigentumsrecht ermittelt werden kann. Dazu gehören Bestandteile der Umwelt wie Luft, große Gewässer und Ökosysteme, die so umfassend oder unkontrollierbar sind, dass wirksame Eigentumsrechte nicht durchgesetzt werden können. Ebenso gelten Ressourcen, deren Bestehen nicht durch Exploration und Entwicklung einwandfrei festgestellt werden kann (z. B. prognostische Erdöllagerstätten) oder die derzeit nicht zugänglich sind (z. B. abgelegene Wälder), im zentralen Rahmen nicht als Vermögensgüter. Dies gilt auch für Ressourcen, die geologisch erfasst oder leicht zugänglich sind, derzeit jedoch keinen wirtschaftlichen Nutzen bringen, weil sie noch nicht profitabel abgebaut werden können. |
|
22.74 |
Umweltvermögenskonten in physischer und monetärer Hinsicht beschreiben die Vorkommen der einzelnen Umweltvermögensgüter und ihre Veränderungen. Ein solches Konto kann zwar für einige Vermögensgüter in monetärer Hinsicht erstellt werden, für einige andere sind jedoch nur physische Konten möglich. Für Ökosystem-Vermögensgüter liegen wahrscheinlich keine ausreichenden Informationen vor, um Bestände oder Änderungen während eines Jahres in genau der gleichen Weise zu ermitteln wie für die anderen Umweltvermögensgüter. Bei diesen Vermögensgütern ist es sinnvoller, sich auf die Messung von Änderungen der Qualität zu konzentrieren, die sich größtenteils auf die Schädigung beziehen, z. B. Versauerung von Boden und Gewässern und Entlaubung von Forsten. |
|
22.75 |
Die Aggregate im zentralen Rahmen können geändert werden, um die Umweltaspekte besser zu berücksichtigen. Drei Arten von Anpassungen werden gemeinhin empfohlen: aufgrund von Abbau, defensiven Ausgaben des Staates und Schädigung (Degradation). |
|
22.76 |
Aus ökologischer Sicht sollte die Anpassung aufgrund von Abbau vorgenommen werden, weil das BIP und seine Wachstumsrate den Abbau verschiedener Umweltvermögensgüter wie Erdöl und freie Fisch- und Waldbestände nicht berücksichtigen. Die Berücksichtung des Abbaus ist nicht einfach; es stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Eine extreme Option besteht darin, die gesamte Nutzung solcher nicht produzierter natürlicher Vermögensgüter als Abbau und somit nicht als Einkommen aus der Produktion zu betrachten. Das entgegengesetzte Extrem besteht darin, alle Einnahmen aus dem Verkauf solcher Vermögensgüter als Einkommen zu betrachten, das zum Inlandsprodukt beiträgt. Bei allen anderen Optionen wird die Nutzung der Vermögensgüter in eine Komponente für Abbau und eine Komponente für Einkommen aufgespalten. Unterschiedliche Grundsätze und unterschiedliche Annahmen für Lebensdauer und Abzinsungsfaktoren führen zu unterschiedlichen Zahlen für die Anpassung aufgrund von Abbau. |
|
22.77 |
Defensive Ausgaben für die Umwelt umfassen nicht nur Umweltschutzausgaben. Sie können sich auf die Verwaltung im Zusammenhang mit der Aufstellung und Überwachung von Fangquoten oder auf Gesundheitsausgaben im Zusammenhang mit der Luftverschmutzung oder einem Unglück in einem Kernkraftwerk beziehen. Eine Anpassung aufgrund defensiver Ausgaben des Staates wird empfohlen, damit diese das BIP nicht erhöhen: Sie sollen negative externe Umweltkosten der Produktion oder des Konsums, die im BIP in keiner Weise erfasst sind, abmildern oder rückgängig machen. In Hinblick auf das Nettoinlandsprodukt kann eine Lösung darin bestehen, alle defensiven Ausgaben des Staates als Investitionen und gleichzeitig als Abschreibungen zu erfassen. In Hinblick auf das häufiger verwendete BIP macht dies jedoch keinen Unterschied. |
|
22.78 |
Inlandsprodukt, Sparen und andere Schlüsselaggregate können aufgrund von Schädigungen wie den Auswirkungen von Luft- und Wasserverschmutzung angepasst werden. Die Berücksichtigung der Folgen der Degradation ist jedoch schwieriger, weniger sicher und stärker umstritten als Anpassungen der Konten aufgrund von Abbau oder defensiver Ausgaben. Wie können beispielsweise der Schaden für die menschliche Gesundheit oder das langsamere Wachstum von Pflanzen und Tieren, die geringere Fortpflanzung und das frühere Absterben wegen Umweltverschmutzung berücksichtigt werden? Sollten Umweltkatastrophen als das Ergebnis der Wirtschaftstätigkeit des Menschen erfasst und daher vom BIP abgezogen werden? |
Gesundheitskonten
|
22.79 |
Die Gesundheitskonten (siehe OECD 2000, „A System of Health Accounts“) sind ein internationaler Rahmen für Daten zum Gesundheitswesen, die der Analyse und politischen Zwecken auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene dienen. Der Rahmen ist für Länder konzipiert, die ihre nationalen Gesundheitssysteme nach ganz verschiedenen Modellen organisieren. Er ist ein wichtiges Instrument für die Überwachung sich rasch verändernder und zunehmend komplexer Gesundheitsversorgungssysteme. In diesem Rahmen werden strukturelle Veränderungen gemessen und dargestellt, wie zum Beispiel die Verlagerung von der stationären zur ambulanten Behandlung und das Auftreten multifunktionaler Anbieter. |
|
22.80 |
Die Gesundheitskonten behandeln drei grundlegende Fragen:
|
|
22.81 |
Waren und Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung werden nach Funktionen aufgeteilt. Dabei werden drei Kategorien unterschieden: individuelle Gesundheitsleistungen für Einzelpersonen, kollektive Versorgungsleistungen im Gesundheitswesen und gesundheitsbezogene Funktionen im weiteren Sinne. |
|
22.82 |
Die wichtigsten Arten von Dienstleistungen der personenbezogenen Gesundheitsversorgung sind: kurative Versorgung, Rehabilitation, Langzeitpflege, Heilhilfsleistungen und -mittel sowie ambulant verabreichte Medizinprodukte. Für diese personenbezogenen Dienstleistungen ist eine Unterteilung nach Produktionsart sehr hilfreich: stationäre Behandlung, Tagespflege, ambulante Behandlung und häusliche Pflege. Viele andere Dimensionen der Klassifizierung der personenbezogenen Gesundheitsversorgung sind ebenfalls wichtig, z. B. Klassifizierung nach Alter, Geschlecht und Einkommensniveau bei großen Kategorien der Gesundheitsversorgung oder Klassifizierung nach wichtigen Krankheitsgruppen (relevant für Krankheitskostenstudien). |
|
22.83 |
Im Vergleich zum zentralen Rahmen wird der Produktionsbegriff in zweierlei Hinsicht ausgeweitet:
|
|
22.84 |
Zwei Arten der Gesundheitsdienstleistungen für die Allgemeinheit werden unterschieden:
|
|
22.85 |
Sieben Arten der im weiteren Sinne gesundheitsbezogenen Funktionen werden unterschieden:
|
|
22.86 |
Für die Leistungserbringer des Gesundheitsbereichs wurde eine ausführliche Klassifikation nach Wirtschaftsbereichen entwickelt. Zu diesem Zweck wurde die internationale Systematik der Wirtschaftszweige präzisiert und geändert. |
|
22.87 |
Grundsätzlich kann die Finanzierung der Gesundheitsversorgung unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten erfasst werden. Im ersten Fall werden die Gesundheitsausgaben in das komplexe Spektrum der Drittzahlervereinbarungen zuzüglich der Direktzahlungen durch private Haushalte oder andere direkte Finanzierungsquellen wie vom Staat erbrachte Gesundheitsversorgung aufgeschlüsselt. Im zweiten Fall geht es um die endgültige Finanzierungsbelastung, aufgegliedert nach Finanzierungsquelle. Dies bedeutet, dass die Finanzierungsquellen intermediärer Finanzierungen bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden. Zusätzliche Transfers wie zwischenstaatliche Transfers, Steuerabzüge, Subventionen für Leistungserbringer und Finanzmittel aus der übrigen Welt sind eingeschlossen, um das Bild zu vervollständigen. |
|
22.88 |
Aus den Gesundheitskonten lassen sich vereinfachte Übersichtstabellen ableiten, die die Bedeutung des Gesundheitswesens in der Volkswirtschaft zeigen, wie aus Tabelle 22.15 ersichtlich. Tabelle 22.15 — Schlüsselzahlen zum Gesundheitswesen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten Haushaltsproduktion
|
22.89 |
Im zentralen Rahmen werden Tätigkeiten wie die Dienstleistungen aus eigengenutztem Wohnungsbesitz, die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse für den Eigenbedarf und die Eigenleistung im Wohnungsbau als Haushaltsproduktion erfasst. Zwei wichtige Arten von Haushaltstätigkeiten, nämlich unbezahlte Dienstleistungen, die im selben Haushalt erbracht und verbraucht werden, und freiwillig erbrachte Dienstleistungen, werden nicht als Produktion erfasst. Auch im Rahmen eines Satellitenkontos stellen sich durch unbezahlte und freiwillige Haushaltsdienstleistungen schwierige begriffliche und messtechnische Probleme. In diesem Bereich laufen Forschungsarbeiten. Der Zweck eines Satellitenkontos für die Haushaltsproduktion (3) besteht darin, ein vollständiges Bild der Haushaltsproduktion zu liefern, Einkommen, Verbrauch und Spartätigkeit verschiedener Arten privater Haushalte darzustellen und die Wechselwirkungen mit der übrigen Wirtschaft zu verdeutlichen. Wichtige Fragen lauten dabei:
|
|
22.90 |
Haushaltsproduktionskonten können für die Untersuchung langfristiger wirtschaftlicher Entwicklungen und für den internationalen Vergleich des Umfangs von Produktion, Einkommen und Konsum von besonderem Interesse sein. Die wichtigsten Datenquellen, die für die Zusammenstellung der Haushaltsproduktionskonten verwendet werden, sind Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen und zum Zeitbudget; die jährlichen Aggregate aus diesen Quellen sind durch Stichprobenfehler verzerrt, weshalb korrekte jährliche Steigerungsraten nicht zu berechnen sind. Haushaltsproduktionskonten werden daher auf einer regelmäßigen, aber nicht jährlichen Basis erstellt, z. B. alle fünf Jahre, und mit einer umfangreichen Zeitbudgeterhebung verknüpft. |
|
22.91 |
Die Haushaltsproduktion umfasst nur Dienstleistungen, die von einer anderen Person als der, die davon begünstigt ist, erbracht wird (dies wird als „third party-principle“ bezeichnet). Infolgedessen sind persönliche Körperpflege, Lernen, Schlafen und Freizeitaktivitäten ausgeschlossen. |
|
22.92 |
Bei der Haushaltsproduktion können verschiedene Hauptaufgabenbereiche unterschieden werden: Wohnung, Ernährung, Kleidung, Betreuung von Kindern, Erwachsenen und Haustieren sowie freiwillige Arbeit, die per definitionem in einem anderen Haushalt verbraucht wird. Zu jeder dieser Hauptaufgabenbereiche können hauptsächliche oder charakteristische Tätigkeiten festgelegt werden. So können die Ausgaben oder die aufgewendete Zeit für solche Tätigkeiten diesen Hauptaufgabenbereichen zugeordnet werden. Einige Tätigkeiten, wie Einkaufen, Reisen und Haushaltsführung, können sich jedoch auf mehrere Aufgabenbereiche beziehen. Daher werden die Ausgaben oder das Zeitbudget für diese Tätigkeiten auf diese Aufgabenbereiche aufgeteilt. |
|
22.93 |
Im zentralen Rahmen sind Ausgaben für langlebige Konsumgüter Teil der Konsumausgaben. In den Konten für die Haushaltsproduktion werden jedoch Ausgaben wie solche für Fahrzeuge, Kühlschränke und Ausrüstungen für Bau und Reparatur als Investitionen gebucht. Die Kapitalnutzungskosten solcher Vermögensgüter gelten als Input der Haushaltsproduktion. |
|
22.94 |
Output und Wertschöpfung der Haushaltsproduktion können unter Verwendung einer Input- oder Output-Methode bewertet werden. Bei der Output-Methode wird die Haushaltsproduktion zum Marktpreis bewertet, d. h. zum Preis ähnlicher Dienstleistungen, die auf dem Markt verkauft werden. Bei der Input-Methode, der Bewertung der Produktion als Summe der Kosten, ist die Wahl der Bewertungsmethode für den Arbeitseinsatz entscheidend. Hier können z. B. Löhne einschließlich oder ausschließlich der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt und verschiedene Bezugsgruppen (Durchschnittslöhne, Löhne von Fachpersonal oder Haushaltspersonal ohne Ausbildung) gewählt werden. |
|
22.95 |
Eine wichtige Frage für Konten der Haushaltproduktion ist die Größe und Zusammensetzung der Haushaltproduktion und die Verbindungen zum zentralen Rahmen. Dies wird anhand einer Verwendungstabelle wie in Tabelle 22.16 gezeigt. Tabelle 22.16 — Verwendungstabelle für Haushaltsproduktion
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitskräftekonten und SAM
|
22.96 |
In vielen Ländern wird ein breites Spektrum an Arbeitsmarktdaten erhoben. Volks- und Betriebszählungen, Haushalts- und Unternehmenserhebungen zu Arbeitskräften, Arbeitszeiten, Verdiensten und Arbeitskosten sowie Bevölkerungs-, Steuer- und Sozialversicherungsregister liefern Daten für die regelmäßige Überwachung und Analyse der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Obwohl diese statistischen Daten in großem Umfang vorliegen, bieten sie kein vollständiges und zuverlässiges Bild des Arbeitsmarktes. Die wichtigsten Messprobleme sind
Mit einem System der Arbeitskräftekonten können solche Probleme gelöst werden, indem alle Informationen zum Arbeitsmarkt kombiniert und die Verbindungen zu den wichtigen Konzepten und Klassifikationen des Arbeitsmarkts in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen aufgezeigt werden, z. B. zum Konzept des Arbeitnehmerentgelts und zur Klassifizierung nach Wirtschaftszweigen. Eine starke Verknüpfung mit den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dient der Erstellung sowohl der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als auch der Arbeitskräftekonten und ist hilfreich für die Beschreibung des Verhältnisses zwischen Arbeitsmarkt und der übrigen Wirtschaft. |
|
22.97 |
Ein vereinfachtes System der Arbeitskräftekonten ist in Tabelle 22.17 dargestellt. Es verwertet Identitätsbeziehungen zwischen Arbeitnehmerentgelt, geleisteten Arbeitsstunden, Anzahl der Arbeitsplätze, der beschäftigten Personen sowie der erwerbsaktiven und potenziellen Arbeitskräfte. Es handelt sich um ein einfaches System; so ist die Aufschlüsselung nach sozioökonomischen Merkmalen eingeschränkt (es werden z. B. Geschlecht, nicht aber Alter oder Bildungsstand berücksichtigt), und es wird nur nach drei Wirtschaftsbereichen aufgeschlüsselt, ohne Berücksichtigung von Grenzgängern. |
|
22.98 |
Eine Gesamt- oder Sozialrechnungsmatrix (Social Acounting Matrix, SAM) ist eine Matrixdarstellung, die die Verbindungen zwischen den Aufkommens- und Verwendungstabellen und den Konten für die institutionellen Sektoren angibt. Eine SAM liefert in der Regel durch eine Aufgliederung des Arbeitnehmerentgelts und des Selbständigeneinkommens nach Gruppen von Beschäftigten zusätzliche Informationen über den Umfang und die Zusammensetzung der Erwerbstätigkeit. Die erwähnte Aufgliederung betrifft sowohl den aus den Verwendungstabellen ableitbaren Arbeitseinsatz nach Wirtschaftsbereichen als auch das Arbeitsangebot nach Haushaltsgruppen innerhalb des Sektors private Haushalte. Auf diese Weise werden das Angebot und der Einsatz verschiedener Kategorien von Arbeitskräften vergleichbar dargestellt. Eine SAM kann als ein erweitertes System von Arbeitskräftekonten betrachtet werden, das in einem Matrix-Format dargestellt wird. Wie die Arbeitskräftekonten und die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zeigt eine SAM Aggregate und ermöglicht eine Analyse nur im Hinblick auf Aggregate und Durchschnitte. Daher basieren die bevorzugten Modelle für viele sozioökonomische Analysen auf einer erweiterten Mikrodatenbasis mit Angaben zu sozioökonomischen Merkmalen pro Person und Haushalt. Tabelle 22.17 — Vereinfachtes System der Arbeitskräftekonten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivitäts- und Wachstumskonten
|
22.99 |
Eine wichtige Verwendung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist die Beschreibung, Überwachung und Analyse des Produktivitätswachstums (für einen breiteren Überblick über die Produktivitätsanalyse siehe OECD 2001, OECD Manual Measuring Productivity: Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth). Die Messung und Analyse des Produktivitätswachstums dient dem Verständnis der großen Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und der Steigerung des Lebensstandards, die im letzten Jahrhundert in vielen Ländern zu beobachten waren. Die Messung und Analyse des Produktivitätswachstums wird auch zur Konzipierung politischer Strategien genutzt, die unter Berücksichtigung weiterer politischer Erwägungen (z. B. Gleichheit und ökologische Aspekte) den Produktivitätszuwachs stimulieren und den Wohlstand erhöhen. |
|
22.100 |
Das Wirtschaftswachstum wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als realer Zuwachs des BIP ausgedrückt; dieser kann in Komponenten wie Änderungen bei der Arbeitsproduktivität, Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen und Änderungen beim Arbeitsvolumen aufgegliedert werden. Dieselbe Aufschlüsselung lässt sich für die reale Veränderung der Wertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen vornehmen. Dieser einfache Ansatz bietet einen Rahmen für die Überwachung und Analyse des Wirtschaftswachstums nach Wirtschaftsbereichen. Homogenere Zahlen zum Arbeitseinsatz, die man durch Heranziehung nicht nur der Anzahl der Beschäftigten, sondern von Vollzeitäquivalenten oder geleisteten Arbeitsstunden und durch die Unterscheidung zwischen verschiedenen Qualitäten der Arbeit erhält, ergeben detailliertere Daten zur Arbeitsproduktivität. |
|
22.101 |
Bei diesem einfachen Ansatz wird die Rolle anderer Inputs, wie Kapitalnutzungskosten und Vorleistungen, nicht beachtet. Dies kann sehr irreführend sein. Beispielsweise kann die Arbeitsproduktivität aufgrund einer sehr viel höheren Kapitalintensität scheinbar erheblich zunehmen, sie kann sich aber auch aufgrund von Effizienzsteigerungen erhöhen, während der Umfang des eingesetzten Kapitals gleich bleibt. Wenn mehrere Inputs berücksichtigt werden, wird die Multifaktorproduktivität gemessen und die Ursachen des Produktivitätszuwachses sind besser verständlich. Die Messung der Multifaktorproduktivität besteht darin, die Änderung beim Umfang des Outputs in Änderungen bei den verschiedenen Volumen aller Inputs zuzüglich eines Restwerts aufzugliedern: des Multifaktor-Produktivitätszuwachses. Der Multifaktor-Produktivitätszuwachs drückt alles aus, was nicht durch die verschiedenen Inputs, d. h. die Rolle anderer Inputs, erklärt wird. Er kann jedoch auch Messfehler bei den Outputs oder Inputs widerspiegeln. |
|
22.102 |
Der Umfang des Kapitaleinsatzes aus dem Anlagevermögen kann in verschiedener Weise gemessen werden. Dabei ist über drei wichtige Aspekte zu entscheiden:
|
|
22.103 |
Die Messung der Multifaktor-Produktivität trägt dazu bei, die direkten Wachstumsbeiträge von Arbeit, Kapital, Vorleistungen und Änderung der Multifaktor-Produktivität zu ermitteln. Sie wird bei der Überprüfung von Wachstumsmustern der Vergangenheit und zur Bewertung des Potenzials eines künftigen Wirtschaftswachstums genutzt. Interpretiert man Messwerte der Multifaktor-Produktivität zu Analyse- und politischen Zwecken, ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen:
|
|
22.104 |
Um Wachstum und Produktivität besser messen, analysieren und überwachen zu können, wurden weltweit die KLEMS-Produktivitäts- und Wachstumskonten entwickelt. Ein wichtiges Ziel besteht darin, die Ebene unter der gesamtwirtschaftlichen Ebene, das heißt, die Produktivitätsentwicklung einzelner Wirtschaftsbereiche und ihre Beiträge zum Wirtschaftswachstum, zu untersuchen. Um die enorme Heterogenität bei Produktions- und Produktivitätszuwachs in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen hervorzuheben, wird zwischen vielen Wirtschaftszweigen unterschieden; in der Union unterscheidet das Projekt EU KLEMS 72 Wirtschaftsbereiche. Die Konten umfassen Mengen und Preise des Outputs, sowie Inputs an Kapital (K), Arbeit (L), Energie (E), Material (M) und Dienstleistungen (S) auf der Ebene der Wirtschaftsbereiche. Produktion und Produktivität werden dabei in Form von Wachstumsraten und relativen Größen dargestellt. Ergänzende Maßeinheiten zur Erfassung der Schaffung von Wissen (wie F&E, Patente, produktgebundener technologischer Wandel, andere Innovationstätigkeiten und Zusammenarbeit) werden entwickelt. Solche Maße werden für einzelne Mitgliedstaaten erarbeitet und mit KLEMS-Datenbanken in der übrigen Welt verbunden. |
|
22.105 |
Die Konten bestehen aus drei miteinander verknüpften Modulen: einem analytischen Modul und zwei statistischen Modulen. |
|
22.106 |
Das analytische Modul liefert eine Forschungsdatenbank, die in der Wissenschaft und von der Politik genutzt wird. Es verwendet als vorbildliche Praxis geltende Techniken für die Wachstumsrechnung, konzentriert sich auf die internationale Vergleichbarkeit und zielt auf eine vollständige Erfassung im Hinblick auf Anzahl der Länder, Wirtschaftsbereiche und Variablen ab. Das Modul kann auch alternative oder zukunftsweisende Hypothesen hinsichtlich statistischer Konventionen übernehmen, z. B. zur Behandlung von IKT-Gütern, nicht marktbestimmten Dienstleistungen und zur Messung von Kapitalnutzungskosten. |
|
22.107 |
Die statistischen Module der Datenbank werden parallel zum analytischen Modul entwickelt. Sie umfassen Daten, die weitgehend mit denen übereinstimmen, die von nationalen Statistikämtern veröffentlicht werden. Ihre Methoden entsprechen denen des zentralen Rahmens der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, z. B. werden Aufkommens- und Verwendungstabellen als Koordinierungsrahmen für die Produktivitätsanalyse benutzt und Kettenindizes angewendet. Das statistische Modul enthält nicht nur Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, sondern auch ergänzende Informationen, z. B. Beschäftigungsstatistiken zur Quantität (Personen und Arbeitszeiten) und Qualität (Verteilung der Mengen nach Alter, Geschlecht und Bildungsniveau) des Arbeitseinsatzes je Wirtschaftsbereich. |
Forschungs- und Entwicklungskonten
|
22.108 |
Im zentralen Rahmen werden Forschungs- und Entwicklungsausgaben als Vorleistungen behandelt, d. h. als laufende Ausgaben, die allein der Produktion im jeweiligen Zeitraum zugute kommen. Dies läuft dem Charakter von F&E zuwider, deren Ziel es ist, die Produktion für künftige Zeiträume zu verbessern. Um die begrifflichen und praktischen Probleme der Erfassung von F&E als Investitionen zu lösen, werden zunächst Satellitentabellen, in denen F&E als Investitionen gebucht sind, von den Mitgliedstaaten erstellt. Dies ermöglicht es den Mitgliedstaaten, robuste und vergleichbare Methoden und Schätzungen zu entwickeln. In einem zweiten Schritt werden, sobald ein ausreichend hohes Maß an Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit erreicht ist, F&E in den Kernkonten der Mitgliedstaaten aktiviert. |
|
22.109 |
Neben dieser ergänzenden Versuchstabelle kann eine Reihe von F&E-Konten aufgestellt werden. Der Zweck dieser F&E-Konten besteht darin, die Rolle von F&E in der Volkswirtschaft zu zeigen. Damit werden u. a. folgende Fragen beantwortet:
Eine Aufkommens- und Verwendungstabelle bietet einen Überblick darüber, wer F&E produziert und nutzt, wie aus den Tabellen 22.18 und 22.19 ersichtlich. Tabelle 22.18 — Aufkommen von F&E
Tabelle 22.19 — Verwendung von F&E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sozialschutzkonten
|
22.110 |
Der Sozialschutz und sein Zusammenwirken mit Themen wie Alterung, Gesundheitsversorgung und sozialer Ausgrenzung sind eine wichtige Frage für die nationale und europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik. Für die Überwachung, Prognose, Analyse und Diskussion von Sozialschutzfragen sind detaillierte, vergleichbare und aktuelle Angaben zu Organisation, derzeitigem Stand und Entwicklungen des Sozialschutzes in den Mitgliedstaaten und darüber hinaus erforderlich. |
|
22.111 |
Sozialschutzleistungen sind Transferzahlungen an private Haushalte oder Einzelpersonen in Form von Geld- oder Sachleistungen, um die Lasten zu erleichtern, die diesen Personen durch bestimmte Risiken oder Bedürfnisse entstehen. Die Sozialschutzrisiken oder -bedürfnisse beziehen sich auf die Aufgabenbereiche Invalidität, Krankheit/Gesundheitsversorgung, Alter, Hinterbliebene, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit, Wohnen und die keiner anderen Kategorie zugeordnete soziale Ausgrenzung. Bildung gilt grundsätzlich nicht als Risiko oder Bedürfnis, sofern es sich nicht um eine Unterstützung für bedürftige Familien mit Kindern handelt. |
|
22.112 |
Sozialschutzleistungen werden über Sozialschutzsysteme erbracht. Diese werden von öffentlichen oder privaten Stellen wie Sozialversicherungen, staatlichen Stellen, Versicherungsgesellschaften, öffentlichen oder privaten Arbeitgebern sowie privaten Wohltätigkeits- und Sozialfürsorgeeinrichtungen verwaltet und organisiert. In den Systemen wird nicht notwendigerweise auf bestimmte Institutionen, Verordnungen oder Gesetze Bezug genommen, auch wenn dies häufig der Fall ist. Alle Systeme, die ausschließlich auf individuellen Vereinbarungen beruhen oder bei denen es sich um Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit handelt, gelten nicht als Sozialschutzsysteme. |
|
22.113 |
Erfolgt die Vereinbarung auf Gegenseitigkeit durch den Arbeitnehmer nicht gleichzeitig, werden die Aufwendungen als Sozialschutz eingestuft. Dies gilt für vom Arbeitgeber gezahlte Altersruhegeldleistungen und Hinterbliebenenrenten sowie für kostenlose Wohnungen für im Ruhestand befindliche ehemalige Beschäftigte. Die Lohn- und Gehaltsfortzahlung in Zeiten, in denen der Arbeitnehmer wegen Krankheit, Mutterschaft, Invalidität, Entlassung usw. arbeitsunfähig ist, gilt als Sozialschutz, der vom Arbeitsgeber geleistet wird. |
|
22.114 |
Um staatlich kontrollierte Systeme handelt es sich, wenn der Staat alle wichtigen Entscheidungen über die Höhe der Leistungen, die Zahlungsmodalitäten und die Art der Finanzierung des Systems trifft. Der staatlich kontrollierte Sozialschutz wird normalerweise durch Gesetz oder Verordnung eingesetzt. Er schließt alle Systeme ein, die für Beamte auf dieselbe Weise Schutz bieten wie die staatlich kontrollierten Systeme für die allgemeine Bevölkerung, schließt jedoch Systeme aus, die der Staat in seiner Rolle als Arbeitgeber einrichten kann, zu denen es aber kein Pendant eines staatlich kontrollierten Systems im privaten Sektor gibt. |
|
22.115 |
Beispiele für staatlich kontrollierte Systeme sind
|
|
22.116 |
Beispiele für nicht staatlich kontrollierte Systeme sind
|
|
22.117 |
Die Sozialschutzkonten bieten ausgehend von Informationen zu bestimmten einzelnen Systemen einen mehrdimensionalen Überblick über den sozialen Schutz, wie in der Veröffentlichung „Das europäische System der integrierten Sozialschutzstatistik“, ESSOSS, Eurostat, 2008 beschrieben. Diese Konten beschreiben den Umfang und die Zusammensetzung von Sozialschutzleistungen, ihre Finanzierung und die damit zusammenhängenden Verwaltungskosten. Sozialschutzleistungen werden nach Aufgabenbereich klassifiziert (z. B. Krankheit und Alter), nach Typ (z. B. Geld- und Sachleistungen) und danach, ob sie einer Bedürftigkeitsprüfung unterliegen. Die zugrundeliegenden Systeme werden eingeteilt in staatlich kontrollierte und nicht staatlich kontrollierte Systeme oder Basissysteme und Zusatzsysteme. |
|
22.118 |
Zu jedem einzelnen Sozialschutzsystem werden Angaben zu Einnahmen und Ausgaben und eine Vielzahl an qualitativen Angaben gemacht, z. B. Umfang, Finanzierung, Geschichte und größere Veränderungen im Laufe der Zeit. |
|
22.119 |
Die Standardangaben zu den verschiedenen einzelnen Sozialschutzsystemen gelten als das Kernsystem des Sozialschutzes und werden durch verschiedene Module ergänzt. Dazu gehören etwa folgende Module:
|
|
22.120 |
Die Begriffe und Klassifikationen in den Sozialschutzkonten sind mit denen des zentralen Rahmens eng verknüpft. Die wichtigsten Unterschiede zwischen Sozialschutzleistungen und Sozialleistungen im zentralen Rahmen bestehen darin, dass unter letztere auch die Ausgaben für Bildung fallen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Sozialschutzleistungen Vermögenstransfers mit einem sozialen Zweck einschließen können. Eine vereinfachte Übersichtstabelle wie in Tabelle 22.20 zeigt diese Verbindungen und bietet gleichzeitig einen Überblick über Umfang und Zusammensetzung der Sozialschutzleistungen in einem Land. Tabelle 22.20 — Überblick über Sozial(schutz)leistungen nach sozialem Risiko/Bedürfnis und Transaktion
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.121 |
Aufgrund der engen Verknüpfung zwischen den standardmäßigen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und den Sozialschutzstatistiken bieten sich Möglichkeiten für beide Arten von Statistiken. Was die Sozialschutzstatistiken betrifft, so können sie zu den offiziellen Statistiken zur Volkswirtschaft in Beziehung gesetzt werden (z. B. zu Wirtschaftswachstum und öffentlichen Finanzen). Statistiken der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen aufgeschlüsselt nach Sozialschutzsystemen können auch zur Überprüfung der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Sozialschutzstatistiken dienen. Die Erstellungsprozesse beider Statistiken können auch miteinander verknüpft werden, dies spart Erstellungskosten, erhöht die Zuverlässigkeit und bietet neue Möglichkeiten, z. B. Sozialschutzstatistiken so zeitnah zu erstellen wie die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (4). Ähnliche Vorteile gelten für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Sozialschutzkonten sind verhältnismäßig einfach von den Sektorkonten und der Tabelle über die Ausgaben des Staates nach dem Aufgabenbereich (COFOG) abzuleiten; sie werden zur Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialpolitik herangezogen. Ferner dienen sie zur Überprüfung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Standarddaten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, z. B. zu Sozialleistungen und Sozialbeiträgen. |
|
22.122 |
Die OECD veröffentlicht ebenfalls Daten zu Sozialausgaben nach Einzelsystemen (Social Expenditure Database, SOCX). Sie erfasst Daten zu Nicht-EU-Staaten, während Eurostat der OECD Daten zu den Sozialschutzausgaben der Mitgliedstaaten liefert. Ein besonderes Merkmal der Arbeit der OECD zu den Sozialausgaben ist ihr Schwerpunkt auf dem internationalen Vergleich von Nettosozialausgaben; dazu gehört eine Anpassung aufgrund der Auswirkungen der Unterschiede bei den Produktions- und Importabgaben auf den Verbrauch der privaten Haushalte. |
Tourismus-Satellitenkonten
|
22.123 |
Das Tourismus-Satellitenkonto (5) bietet einen Überblick über das Angebot an und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen für die verschiedenen Arten des Tourismus und ihre Bedeutung für die Beschäftigungslage im Inland, Zahlungsbilanz, Staatsfinanzen sowie privates Einkommen und Unternehmenseinkünfte |
|
22.124 |
„Tourismus“ umfasst die Tätigkeiten von Personen, die an Orte außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und sich dort weniger als ein Jahr aufhalten, wobei der Hauptzweck nicht darin besteht, von einem gebietsansässigen Wirtschaftsbeteiligten an dem besuchten Ort angestellt zu werden. Solche Tätigkeiten umfassen alle Tätigkeiten der Besucher in Vorbereitung auf oder während einer Reise. „Tourismus“ beschränkt sich nicht auf typische Tourismusaktivitäten wie Rundfahrten, Sonnenbaden und Besichtigungen. Reisen zum Zwecke von Geschäften oder im Rahmen von Bildung und Ausbildung können auch Teil des Tourismus sein. |
|
22.125 |
Die durch den Tourismus entstehende Nachfrage umfasst verschiedene Waren und Dienstleistungen, bei denen insbesondere Beförderungs- und Beherbergungsleistungen sowie Gastronomiedienstleistungen eine Rolle spielen. Um international vergleichbar zu sein, werden für den Tourismus charakteristische Güter als Produkte definiert, die ohne Besucher in den meisten Ländern wahrscheinlich nicht in einer nennenswerten Menge bestünden oder deren Verbrauch deutlich zurückginge und zu denen statistische Angaben vorliegen. Tourismusverwandte Produkte sind eine Restwertkategorie und schließen die Produkte ein, die in einem bestimmten Land als tourismusspezifisch ermittelt wurden, für die dieses Merkmal jedoch auf internationaler Ebene nicht anerkannt wurde. |
|
22.126 |
Einige der Dienstleistungen zu touristischen Zwecken, wie Unterbringung in Zweitwohnungen oder Beförderung in Personenkraftfahrzeugen, können in beträchtlichem Umfang für eigene Rechnung erbracht werden. Im zentralen Rahmen gelten Beförderungsdienste, die innerhalb von Haushalten zu deren Nutzen erbracht werden, anders als Dienstleistungen aus eigengenutzten Wohnungen, nicht als Produktion. Es wird empfohlen, diese Vereinbarung auch beim Tourismus-Satellitenkonto einzuhalten. Für Länder, in denen selbstgenutzte Beförderungsdienste beträchtlichen Umfang haben, können diese separat im Tourismus-Satellitenkonto angegeben werden. |
|
22.127 |
Die wichtigste Messgröße für die Beschreibung der Nachfrage nach Tourismus ist der touristische Konsum von privaten Haushalten, Staat, Einrichtungen ohne Erwerbszweck und Unternehmen. Der touristische Konsum setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
|
|
22.128 |
Das Angebot und die Nutzung von Waren und Dienstleistungen zu Zwecken des Tourismus, wie auch die Wertschöpfung und durch den Tourismus geschaffene Arbeitsplätze, können in einer Aufkommens- und Verwendungstabelle dargestellt werden, in der seine charakteristischen Produkte und Wirtschaftsbereiche und die tourismusverwandten Produkte unterschieden werden. |
|
22.129 |
Die Länder haben in ihrem Tourismus-Satellitenkonto die Möglichkeit, ihre Märkte anhand der Aufenthaltsdauer, des Besuchszwecks und der Merkmale der Besucher (z. B. international oder national) weiter zu untergliedern. |
(1) Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in der Gemeinschaft (ABl. L 33 vom 5.2.2004, S. 1).
(2) Das Handbuch wird unter gemeinsamer Federführung der Vereinten Nationen, der Europäischen Kommission, des Internationalen Währungsfonds, der OECD und der Weltbank veröffentlicht.
(3) Siehe z. B. Eurostat 2003, Haushaltsproduktion und Haushaltskonsum - Vorschlag einer Methodik für Haushaltssatellitenkonten; J. Varjonen und K. Aalto, 2006, Household production and consumption in Finland, household satellite account, Statistics Finland & National consumer research centre; S. Holloway, S. Short, S. Tamplin, 2002, Household Satellite account, ONS London; S.J. Landefeld und S.H. McCulla, 2000, Accounting for nonmarket household production within a national accounts framework, Review of Income and Wealth.
(4) Der Zeitplan für die Verbreitung des ESSOSS ist in der Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. April 2007 über das Europäische System integrierter Sozialschutzstatistiken (ESSOSS) (ABl. L 113 vom 30.4.2007, S. 3) festgelegt.
(5) Siehe Tourism satellite account: recommended methodological framework, 2008, Veröffentlichung unter der gemeinsamen Verantwortung der Europäischen Kommission (Eurostat), der OECD, der Welt-Tourismusorganisation und der Statistikabteilung der Vereinten Nationen.
KAPITEL 23
KLASSIFIKATIONEN
EINLEITUNG
|
23.01 |
Die Klassifikationen des ESVG stehen in völliger Übereinstimmung mit der neuen Codierung des SNA 2008, der NACE Rev. 2, der CPA 2008 (auf den im Lieferprogramm verwendeten Aggregationsebenen), der COFOG, COICOP, COPNI und COPP. Es wurde nur eine sehr begrenzte Zahl zusätzlicher Codes eingeführt. |
|
23.02 |
Die Konten stützen sich auf eine kleine Zahl konzeptioneller Elemente, vor allem Sektoren, Transaktionen und Klassifikationen der Positionen, die Gegenstand von Transaktionen und sonstigen Strömen sind, insbesondere Aktiva und Passiva. Für jedes dieser Elemente gibt es eine hierarchische Klassifikation. Die Konten können in einer größeren oder geringeren Gliederungstiefe erstellt werden, indem höhere oder niedrigere Ebenen dieser Klassifikationen herangezogen werden. |
|
23.03 |
Die Konteneinträge werden in Typen unterteilt, die mit einem oder zwei Buchstaben wie folgt bezeichnet werden:
|
|
23.04 |
Im Rahmen des Produktionsansatzes („Entstehungsrechnung“) zur BIP-Berechnung, der Erstellung von Tabellen nach Wirtschaftszweigen und der Input-Output-Rechnung werden auch zwei europäische Klassifikationen herangezogen: die NACE Rev. 2 für Wirtschaftszweige und die CPA 2008 für Güter in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen. Die NACE Rev. 2 ist die europäische Fassung der ISIC Rev. 4. Im Rahmen des Ausgabenansatzes („Verwendungsrechnung“) zur BIP-Berechnung werden zudem die CPA 2008, die COFOG (Klassifikationen der Ausgaben nach dem Verwendungszweck: Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates) und die COICOP (Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualkonsums) herangezogen; die letzten beiden Klassifikationen werden von den Vereinten Nationen aufgestellt. |
|
23.05 |
Zu den funktionsspezifischen Klassifikationen gehören nicht nur die COFOG und die COICOP, sondern auch die COPNI (Klassifikation der Aufgabenbereiche der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck) und die COPP (Klassifikation der Ausgabenarten nach Zwecken). Diese Klassifikationen werden für die funktionsspezifische Analyse der Ausgaben von Kapitalgesellschaften, des Staates, von privaten Haushalten, von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und für funktionsspezifische Satellitenkonten verwendet. |
SEKTOREN (S)
|
S.1 |
Volkswirtschaft (1) |
|
S.11 |
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
|
S.11001 |
Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
|
S.11002 |
Inländisch privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
|
S.11003 |
Ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
|
S.12 |
Finanzielle Kapitalgesellschaften |
|
S.121 |
Zentralbank (2) (öffentlich) |
|
S.122 |
Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (2) |
|
S.12201 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12202 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12203 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.123 |
Geldmarktfonds |
|
S.12301 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12302 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12303 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.124 |
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
|
S.12401 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12402 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12403 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.125 |
Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) |
|
S.12501 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12502 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12503 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.126 |
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten |
|
S.12601 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12602 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12603 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.127 |
Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
|
S.12701 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12702 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12703 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.128 |
Versicherungsgesellschaften (3) |
|
S.12801 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12802 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12803 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.129 |
Altersvorsorgeeinrichtungen (3) |
|
S.12901 |
Öffentlich kontrolliert |
|
S.12902 |
Inländisch privat kontrolliert |
|
S.12903 |
Ausländisch kontrolliert |
|
S.121 + S.122 + S.123 |
Monetäre Finanzinstitute |
|
S.13 |
Staat |
|
S.1311 |
Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung) |
|
S.1312 |
Länder (ohne Sozialversicherung) |
|
S.1313 |
Gemeinden (ohne Sozialversicherung) |
|
S.1314 |
Sozialversicherung |
|
S.14 |
Private Haushalte |
|
S.141 |
Selbständigenhaushalte mit Arbeitnehmern |
|
S.142 |
Selbstständigenhaushalte ohne Arbeitnehmer |
|
S.143 |
Arbeitnehmerhaushalte |
|
S.144 |
Nichterwerbstätigenhaushalte |
|
S.1441 |
Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern |
|
S.1442 |
Haushalte von Empfängern von Zahlungen aus Alterssicherungssystemen |
|
S.1443 |
Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte |
|
S.15 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck |
|
S.15002 |
Inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck |
|
S.15003 |
Ausländische private Organisationen ohne Erwerbszweck |
|
S.2 |
Übrige Welt |
|
S.21 |
Mitgliedstaaten und Organe und Einrichtungen der Europäischen Union |
|
S.211 |
Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
|
S.2111 |
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets |
|
S.2112 |
Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets |
|
S.212 |
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union |
|
S.2121 |
Europäische Zentralbank (EZB) |
|
S.2122 |
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union (ohne die EZB) |
|
S.22 |
Drittländer und in der Europäischen Union gebietsfremde internationale Organisationen |
TRANSAKTIONEN UND SONSTIGE STRÖME
Gütertransaktionen (P)
|
P.1 |
Produktionswert |
|
P.11 |
Marktproduktion |
|
P.119 |
Unterstellte Bankdienstleistungen (FISIM) |
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
|
P.13 |
Nichtmarktproduktion |
|
P.2 |
Vorleistungen |
|
P.3 |
Konsumausgaben |
|
P.31 |
Konsumausgaben für den Individualverbrauch |
|
P.32 |
Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch |
|
P.4 |
Konsum (Verbrauchskonzept) |
|
P.41 |
Individualkonsum (Verbrauchskonzept) |
|
P.42 |
Kollektivkonsum (Verbrauchskonzept) |
|
P.5 |
Bruttoinvestitionen/P.5n Nettoinvestitionen |
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
P.51c |
Abschreibungen (–) |
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss (–) |
|
P.51c2 |
Abschreibungen bezüglich Bruttoselbständigeneinkommen (–) |
|
P.51n |
Nettoanlageinvestitionen |
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
|
P.6 |
Exporte |
|
P.61 |
Warenexporte |
|
P.62 |
Dienstleistungsexporte |
|
P.7 |
Importe |
|
P.71 |
Warenimporte |
|
P.72 |
Dienstleistungsimporte |
Transaktionen mit nichtproduzierten nichtfinanziellen Vermögensgütern (Codes NP)
Die für Transaktionen mit nichtproduzierten nichtfinanziellen Vermögensgütern verwendeten Codes können bei Bedarf analog der Klassifikation der nichtproduzierten nichtfinanziellen Vermögensgüter, AN.2, weiter disaggregiert werden.
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
Verteilungstransaktionen (D)
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
|
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
|
D.21 |
Gütersteuern |
|
D.211 |
Mehrwertsteuer (MwSt.) |
|
D.212 |
Importabgaben |
|
D.2121 |
Zölle |
|
D.2122 |
Importsteuern |
|
D.214 |
Sonstige Gütersteuern |
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
|
D.3 |
Subventionen |
|
D.31 |
Gütersubventionen |
|
D.311 |
Importsubventionen |
|
D.319 |
Sonstige Gütersubventionen |
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
|
D.41 |
Zinsen |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
|
D.421 |
Ausschüttungen |
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Alterssicherungssystemen |
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
Laufende Geld- oder Sachtransfers (D.5-D.8)
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
|
D.6 |
Sozialbeiträge und Sozialleistungen |
|
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
|
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
|
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
|
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
|
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
|
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
|
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
|
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
|
D.614 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
|
D.6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Alterssicherungssystemen |
|
D.6142 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen) |
|
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger (–) (4) |
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
|
D.621 |
Geldleistungen der Sozialversicherung |
|
D.6211 |
Geldleistungen der Sozialversicherung zur Alterssicherung |
|
D.6212 |
Geldleistungen der Sozialversicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
|
D.623 |
Sonstige soziale Geldleistungen |
|
D.63 |
Soziale Sachleistungen |
|
D.631 |
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion |
|
D.632 |
Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion |
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
|
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
|
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
|
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
|
D.76 |
MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel |
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
|
D.9 |
Vermögenstransfers |
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
|
D.91r |
Empfangene vermögenswirksame Steuern |
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
|
D.92p |
Geleistete Investitionszuschüsse |
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten (F)
(Nettozugang an finanziellen Aktiva/Nettozugang an Passiva)
|
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
F.11 |
Währungsgold |
|
F.12 |
SZR |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
F.21 |
Bargeld |
|
F.22 |
Sichteinlagen |
|
F.221 |
Interbankpositionen |
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
|
F.4 |
Kredite (5) |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
F.51 |
Anteilsrechte |
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Alterssicherungssystemen |
|
F.64 |
Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen |
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
F.71 |
Finanzderivate |
|
F.711 |
Optionen |
|
F.712 |
Terminkontrakte |
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
Sonstige Vermögensänderungen (Codes K)
|
K.1-5 |
Volumenänderungen |
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
KONTENSALDEN UND REINVERMÖGEN (B) (6)
|
B.1g |
Wertschöpfung, brutto/Bruttoinlandsprodukt |
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
|
B.3g |
Selbständigeneinkommen, brutto |
|
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto / Nationaleinkommen, brutto |
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
|
B.8g |
Sparen, brutto |
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
|
B.9N |
Finanzierungssaldo der Konten für nicht finanzielle Transaktionen |
|
B.9F |
Finanzierungssaldo der Konten für finanzielle Transaktionen |
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (7) (8) |
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
B.11 |
Außenbeitrag |
|
B.12 |
Saldo der laufenden Außentransaktionen |
|
B.90 |
Reinvermögen |
|
BF. 90 |
Finanzielles Reinvermögen |
KLASSIFIKATION DER ANGABEN IN DER VERMÖGENSBILANZ (L)
Für eine Gesamtbilanz sind wie für das Finanzierungskonto nur die Codes notwendig, die Aufschluss über die Art der Vermögensgüter (Codes AN und AF) geben. Es ist jedoch möglich, ein Konto zu erstellten, in dem der Bestand zu Beginn (LS) und am Ende (LE) eines Zeitraums ausgewiesen wird sowie die gesamten in dieser Zeit eingetretenen Veränderungen (LX). Aus allen drei Codes muss die Art der Vermögensgüter ersichtlich sein. Bei den Einträgen mit dem Code LX handelt es sich um die Summe der Einträge mit den Codes P.5, NP, F und K für die betreffenden Vermögensgüter im jeweiligen Zeitraum.
Anhand der Einträge in der Bilanz am Jahresanfang kann ein Wert für das Reinvermögen (B.90) ermittelt werden. Die Differenz zwischen diesem Wert und dem Wert von B.90 in der Bilanz am Jahresende muss gleich dem Saldo aller Codes LX sein, der wiederum dem Wert von B.10 entsprechen muss.
|
LS |
Bilanz am Jahresanfang |
|
LX |
Änderung der Bilanz |
|
LE |
Bilanz am Jahresende |
KLASSIFIKATION DER AKTIVA UND PASSIVA (A)
Nichtfinanzielle Vermögensgüter (AN)
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
|
AN.111 |
Wohnbauten |
|
AN.112 |
Nichtwohnbauten |
|
AN.1121 |
Nichtwohngebäude |
|
AN.1122 |
Sonstige Bauten |
|
AN.1123 |
Bodenverbesserungen |
|
AN.113 |
Ausrüstungen |
|
AN.1131 |
Fahrzeuge |
|
AN.1132 |
Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik |
|
AN.1139 |
Sonstige Ausrüstungen |
|
AN.114 |
Militärische Waffensysteme |
|
AN.115 |
Nutztiere und Nutzpflanzungen |
|
AN.1151 |
Nutztiere |
|
AN.1152 |
Nutzpflanzungen |
|
(AN.116) |
(Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter) (9) |
|
AN.117 |
Geistiges Eigentum |
|
AN.1171 |
Forschung und Entwicklung |
|
AN.1172 |
Suchbohrungen |
|
AN.1173 |
Software und Datenbanken |
|
AN.11731 |
Software |
|
AN.11732 |
Datenbanken |
|
AN.1174 |
Urheberrechte |
|
AN.1179 |
Sonstiges geistiges Eigentum |
|
AN.12 |
Vorräte nach Art des Vorrats |
|
AN.121 |
Vorleistungsgüter |
|
AN.122 |
Unfertige Erzeugnisse |
|
AN.1221 |
Lebende Tier- und Pflanzenvorräte |
|
AN.1222 |
Sonstige unfertige Erzeugnisse |
|
AN.123 |
Fertigerzeugnisse |
|
AN.124 |
Militärische Vorräte |
|
AN.125 |
Handelsware |
|
AN.13 |
Wertsachen |
|
AN.131 |
Edelmetalle und Edelsteine |
|
AN.132 |
Antiquitäten und Kunstgegenstände |
|
AN.133 |
Sonstige Wertsachen |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte nichtfinanzielle Vermögensgüter |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
|
AN.211 |
Grund und Boden |
|
AN. 2111 |
Bebautes Land |
|
AN. 2112 |
Land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche |
|
AN. 2113 |
Erholungsflächen |
|
AN. 2119 |
Sonstige Flächen |
|
AN.212 |
Bodenschätze |
|
AN.213 |
Freie Tier- und Pflanzenbestände |
|
AN.214 |
Wasserreserven |
|
AN.215 |
Sonstige natürliche Ressourcen |
|
AN.2151 |
Funkspektren |
|
AN.2159 |
Übrige |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
|
AN.221 |
Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern |
|
AN.222 |
Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen |
|
AN.223 |
Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten |
|
AN.224 |
Exklusivrechte auf künftige Waren und Dienstleistungen |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
Forderungen (AF)
Zwischen den Codes für Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten (Codes F) und den Codes für die Bestände oder Positionen (Codes AF) derselben Forderungen und Verbindlichkeiten besteht theoretisch eine Eins-zu-eins-Entsprechung. In der Praxis sind die Vermögensbilanzdaten jedoch unter Umständen weniger tief gegliedert und liegen nur auf der ersten, nachstehend angegebenen Untergliederungsebene vor. Bei Bedarf können die Codes AF entsprechend der Gliederung der Codes F wie folgt disaggregiert werden:
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
AF.11 |
Währungsgold |
|
AF.12 |
SZR |
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
AF.21 |
Bargeld |
|
AF.22 |
Sichteinlagen |
|
AF.221 |
Interbankpositionen |
|
AF.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
|
AF.29 |
Sonstige Einlagen |
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
AF.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
|
AF.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
|
AF.4 |
Kredite (10) |
|
AF.41 |
Kurzfristige Kredite |
|
AF.42 |
Langfristige Kredite |
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
AF.51 |
Anteilsrechte |
|
AF.511 |
Börsennotierte Aktien |
|
AF.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
|
AF.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
|
AF.52 |
Anteile an Investmentfonds |
|
AF.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
|
AF.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
AF.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
|
AF.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
|
AF.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen |
|
AF.64 |
Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen |
|
AF.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
|
AF.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
AF.71 |
Finanzderivate |
|
F.711 |
Optionen |
|
F.712 |
Terminkontrakte |
|
AF.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
AF.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
|
AF.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
KLASSIFIKATION ZUSÄTZLICHER POSITIONEN
Vereinbarungsgemäß beginnt ein zusätzlicher Code mit X und wird mit dem Code einer Standardposition verknüpft, auf dem er aufbaut.
Notleidende Kredite
Die folgenden Codes beziehen sich auf Bestände und Ströme notleidender Kredite. Da Kredite die Codes AF.4 und F.4 haben, beginnen die zusätzlichen Codes für Bestände mit XAF4 und für Ströme mit XF4.
Die Codes für Bestände lauten:
|
XAF4_NNP |
Kredite: Nominalwert, notleidend |
|
XAF4_MNP |
Kredite: Marktwert, notleidend |
und für die entsprechenden Ströme:
|
XF4_NNP |
Kredite: Nominalwert, notleidend |
|
XF4_MNP |
Kredite: Marktwert, notleidend |
Bei beiden Codesätzen dient die Unterstreichung ggf. als Platzhalter für die detaillierten Codes für Kredite, beispielsweise in der Vermögensbilanz:
|
XAF41NNP |
Kurzfristige Kredite: Nominalwert, notleidend |
|
XAF42MNP |
Langfristige Kredite: Marktwert, notleidend |
Kapitalnutzungskosten
Die folgenden Codes gelten für Kapitalnutzungskosten.
|
XCS |
Kapitalnutzungskosten |
|
XCSC |
Kapitalnutzungskosten — Kapitalgesellschaften |
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
|
XRC |
Kapitalverzinsung — Kapitalgesellschaften |
|
XOC |
Sonstige Kapitalkosten — Kapitalgesellschaften |
|
XCSU |
Kapitalnutzungskosten — Nichtkapitalgesellschaften |
|
P.51c2 |
Abschreibungen bezüglich Bruttoselbständigeneinkommen |
|
XRU |
Kapitalverzinsung — Nichtkapitalgesellschaften |
|
XOU |
Sonstige Kapitalkosten — Nichtkapitalgesellschaften |
Alterssicherungsbilanz
Die folgenden Codes gelten für die zusätzliche Tabelle, die im Kapitel über Alterssicherung dargestellt wird. Für die Spalten und Zeilen der Tabelle sind unterschiedliche Codes vorgesehen.
Spalten
Bei der Bezeichnung der Spalten steht der Buchstabe „W“ für „nichtstaatlich“ und die Zahlen in diesen Codes beziehen sich auf die entsprechenden institutionellen Sektoren.
a) In der Hauptkontenabfolge erfasste Verbindlichkeiten
Systeme, für deren Konzipierung und Durchführung der Staat nicht verantwortlich ist.
|
XPC1W |
Systeme mit Beitragszusagen |
|
XPB1W |
Systeme mit Leistungszusagen |
|
XPCB1W |
Insgesamt |
Systeme, für deren Konzipierung und Durchführung der Staat verantwortlich ist.
|
XPCG |
Systeme mit Beitragszusagen |
Systeme mit Leistungszusagen für Arbeitnehmer des Staates
|
XPBG12 |
Im Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften |
|
XPBG13 |
Im Sektor Staat |
b) In der Hauptkontenabfolge nicht erfasste Verbindlichkeiten
|
XPBOUT13 |
Im Sektor Staat |
|
XP1314 |
Altersvorsorgeeinrichtungen der Sozialversicherung |
|
XPTOT |
Altersvorsorgeeinrichtungen insgesamt |
|
XPTOTNRH |
darunter: Gebietsfremde Haushalte |
Zeilen
a) Bilanz am Jahresanfang
|
XAF63LS |
Ansprüche gegenüber Altersvorsorgeeinrichtungen |
b) Transaktionen
|
XD61p |
Sozialbeiträge an Alterssicherungssysteme |
|
XD6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
XD6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
|
XD6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
|
XD6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
|
XD619 |
Sonstiger (versicherungsmathematischer) Erwerb von Alterssicherungsansprüchen in der Sozialversicherung |
|
XD62p |
Alterssicherungsleistungen |
|
XD8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
|
XD81 |
Veränderung der Versorgungsansprüche aufgrund von Anwartschaftsübertragungen |
|
XD82 |
Veränderung der Anwartschaften aufgrund verhandelter Änderungen des Alterssicherungssystems |
c) Sonstige Wirtschaftsströme
|
XK7 |
Umbewertungen |
|
XK5 |
Sonstige Volumenänderungen |
d) Bilanz am Jahresende
|
XAF63LE |
Ansprüche gegenüber Altersvorsorgeeinrichtungen |
e) Weitere Indikatoren
|
XP1 |
Produktionswert |
|
XAFN |
Aktiva der Altersvorsorgeeinrichtungen am Jahresende |
Langlebige Konsumgüter
Die Codes der langlebigen Konsumgüter beginnen mit einem „X“ gefolgt von den Buchstaben „DHHCE“ (Ausgaben der privaten Haushalte für langlebige Konsumgüter) plus einer einstelligen Ziffer für die Untergruppen und einer zweistelligen Ziffer für die Positionen. Die entsprechenden Nummern der COICOP werden ebenfalls angegeben.
|
Coicop |
SNA-Codes |
|
|
|
XDHHCE1 |
Möbel und Haushaltsgeräte |
|
05.1.1 |
XDHHCE11 |
Möbel und Einrichtungsgegenstände |
|
05.1.2 |
XDHHCE12 |
Teppiche u. a. Bodenbeläge |
|
05.3.1 |
XDHHCE13 |
Elektrische u. a. Haushaltsgroßgeräte |
|
05.5.1 |
XDHHCE14 |
Motorbetriebene Werkzeuge und Geräte |
|
|
XDHHCE2 |
Personenfahrzeuge |
|
07.1.1 |
XDHHCE21 |
Kraftfahrzeuge |
|
07.1.2 |
XDHHCE22 |
Motorräder |
|
07.1.3 |
XDHHCE23 |
Fahrräder |
|
07.1.4 |
XDHHCE24 |
Kutschen u. ä. von Tieren gezogene Fahrzeuge |
|
|
XDHHCE3 |
Güter für Freizeit- und Unterhaltungszwecke |
|
08.2.0 |
XDHHCE31 |
Telefon- und Telefaxgeräte, einschl. Reparatur |
|
09.1.1 |
XDHHCE32 |
Geräte für den Empfang, die Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild |
|
09.1.2 |
XDHHCE33 |
Foto- und Filmausrüstung, optische Geräte und Zubehör |
|
09.1.3 |
XDHHCE34 |
Informationsverarbeitungsgeräte |
|
09.2.1 |
XDHHCE35 |
Größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit im Freien |
|
09.2.2 |
XDHHCE36 |
Musikinstrumente und größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit in Räumen |
|
|
XDHHCE4 |
Sonstige langlebige Güter |
|
12.3.1 |
XDHHCE41 |
Schmuck und Uhren |
|
06.1.3 |
XDHHCE42 |
Therapeutische Geräte und Ausrüstungen |
Ausländische Direktinvestitionen
Zusätzliche Positionen für ausländische Direktinvestitionen können kodiert werden, indem dem Code F oder AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz „FDI“ nachgestellt wird, z. B.:
|
XF42FDI |
für ausländische Direktinvestitionstransaktionen in Form langfristiger Kredite |
Eventualpositionen
Bei zusätzlichen Codes für Eventualpositionen wird dem Code AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz „CP“ nachgestellt, z. B.:
|
XAF11CP |
Währungsgold, dessen Verpfändung seinen Einsatz als Reservemittel beeinflussen kann |
Bargeld und Einlagen
Bei zusätzlichen Positionen für die Klassifikation von Bargeld und Einlagen, die auf Landeswährung und Fremdwährung lauten, wird dem Code F oder AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz „NC“ für Bargeld und Einlagen in Landeswährung oder der Zusatz „FC“ mit einem internationalen Währungscode für Bargeld und Einlagen in Fremdwährung nachgestellt, z. B.:
Für Transaktionen
|
XF21NC |
Banknoten und Münzen in lokaler Währung |
|
XF22FC |
Einlagen in Fremdwährung |
Für Bestände
|
XAF21NC |
Banknoten und Münzen in lokaler Währung |
|
XAF22FC |
Einlagen in Fremdwährung |
Klassifikation von Schuldverschreibungen nach ihrer Fälligkeit
Schuldverschreibungen sollten nach ihrer Fälligkeit klassifiziert werden. Dies kann dadurch erfolgen, dass dem Code AF ein „X“ vorangestellt und ein Zusatz zur Angabe des Fälligkeitsdatums nachgestellt wird, z. B.:
|
XAF32Y20 |
für Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2020 |
Börsennotierte und nicht börsennotierte Schuldverschreibungen
Zusätzliche Positionen zu Schuldverschreibungen werden kodiert, indem dem Code F oder AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz 1 für börsennotiert oder 2 für nicht börsennotiert nachgestellt wird, z. B.:
Für Transaktionen
|
XF321 |
für Transaktionen mit börsennotierten langfristigen Schuldverschreibungen |
|
XF322 |
für Transaktionen mit nicht börsennotierten langfristigen Schuldverschreibungen |
Für Bestände
|
XAF321 |
für Bestände an börsennotierten langfristigen Schuldverschreibungen |
|
XAF322 |
für Bestände an nicht börsennotierten langfristigen Schuldverschreibungen |
Langfristige Kredite mit einer Fälligkeit unter einem Jahr und hypothekarisch gesicherte langfristige Kredite
Langfristige Kredite mit einer Fälligkeit unter einem Jahr und hypothekarisch gesicherte langfristige Kredite werden kodiert, dem Code F oder AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz L1 für Kredite mit einer Fälligkeit unter einem Jahr oder der Zusatz LM für hypothekarisch gesicherte langfristige Kredite nachgestellt wird, z. B.:
Für Transaktionen
|
XF42L1 |
für langfristige Kredite mit einer Fälligkeit unter einem Jahr |
|
XF42LM |
für hypothekarisch gesicherte langfristige Kredite |
Für Bestände
|
XAF42L1 |
für langfristige Kredite mit einer Fälligkeit unter einem Jahr |
|
XAF42LM |
für hypothekarisch gesicherte langfristige Kredite |
Börsennotierte und nicht börsennotierte Anteile an Investmentfonds
Börsennotierte und nichtbörsennotierte Anteile an Investmentfonds werden kodiert, indem dem Code F oder AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz 1 für börsennotiert oder 2 für nicht börsennotiert nachgestellt wird, z. B.:
Für Transaktionen
|
XF5221 |
für Transaktionen mit börsennotierten Anteilen an Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
|
XF5222 |
für Transaktionen mit nicht börsennotierten Anteilen an Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
Für Bestände
|
XAF5221 |
für Bestände an börsennotierten Anteilen an Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
|
XAF5222 |
für Bestände an nicht börsennotierten Anteilen an Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
Zins- und Rückzahlungsrückstände
Zins- und Rückzahlungsrückstände werden kodiert, indem dem Code AF ein „X“ vorangestellt und der Zusatz „IA“ für Zinsrückstände oder „PA“ für Rückzahlungsrückstände nachgestellt wird.
|
XAF42IA |
für Zinsrückstände bei langfristigen Krediten |
|
XAF42PA |
für Rückzahlungsrückstände bei langfristigen Krediten |
Private Überweisungen und gesamte Überweisungen
Private Überweisungen und die gesamten Überweisungen zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden privaten Haushalten werden kodiert, indem dem Code des laufenden Transfers ein „X“ vorangestellt und der Zusatz „PR“ für private Überweisungen oder „TR“ für die gesamten Überweisungen nachgestellt wird.
|
XD5452PR |
für private Überweisungen zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden privaten Haushalten |
|
XD5452TR |
für gesamte Überweisungen zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden privaten Haushalten |
ZUSAMMENFASSUNG UND CODIERUNG DER WIRTSCHAFTSBEREICHE (A) UND GÜTERGRUPPEN (P)
Als Wirtschaftszweig- und Güterklassifikationen sind die NACE Rev. 2 bzw. die CPA 2008 heranzuziehen. Die entsprechenden Aggregationen für das ESVG-Lieferprogramm sind A*3, A*10, A*21, A*38 und A*64 für Wirtschaftszweige und P*3, P*10, P*21, P*38 sowie P*64 für Güter. Die Ebenen A*88 (NACE Rev. 2) und P*88 (CPA) werden in diesem Kapitel ebenfalls aufgeführt, im ESVG-Lieferprogramm aber nicht verwendet.
Folgendes sind die neuen Aggregationen.
A*3
|
Lfd. Nr. |
Abschnitte der NACE REV. 2 |
Bezeichnung |
|
1 |
A |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
|
2 |
B, C, D, E und F |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren; Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen; Baugewerbe/Bau |
|
3 |
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T und U |
Dienstleistungen |
A*10
|
Lfd. Nr. |
Abschnitte der NACE REV. 2 |
Bezeichnung |
|
1 |
A |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
|
2 |
B, C, D und E |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren; Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
|
2a |
C |
darunter: Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren |
|
3 |
F |
Baugewerbe/Bau |
|
4 |
G, H und I |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Verkehr und Lagerei; Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie |
|
5 |
J |
Information und Kommunikation |
|
6 |
K |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
|
7 |
L |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
8 |
M und N |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
|
9 |
O, P und Q |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen |
|
10 |
R, S, T und U |
Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung von sonstigen Dienstleistungen; Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt; Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
A*21
|
Lfd. Nr. |
Abschnitt der NACE REV. 2 |
Abteilung der NACE REV. 2 |
Bezeichnung |
|
1 |
A |
01-03 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
|
2 |
B |
05-09 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
|
3 |
C |
10-33 |
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren |
|
4 |
D |
35 |
Energieversorgung |
|
5 |
E |
36-39 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
|
6 |
F |
41-43 |
Baugewerbe/Bau |
|
7 |
G |
45-47 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
|
8 |
H |
49-53 |
Verkehr und Lagerei |
|
9 |
I |
55-56 |
Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie |
|
10 |
J |
58-63 |
Information und Kommunikation |
|
11 |
K |
64-66 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
|
12 |
L |
68 |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
13 |
M |
69-75 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
|
14 |
N |
77-82 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
|
15 |
O |
84 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
|
16 |
P |
85 |
Erziehung und Unterricht |
|
17 |
Q |
86-88 |
Gesundheits- und Sozialwesen |
|
18 |
R |
90-93 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung |
|
19 |
S |
94-96 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen |
|
20 |
T |
97-98 |
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
21 |
U |
99 |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
A*38
|
Lfd. Nr. |
Abteilungen der NACE REV. 2 |
Bezeichnung |
|
1 |
01-03 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
|
2 |
05-09 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
|
3 |
10-12 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung, Tabakverarbeitung |
|
4 |
13-15 |
Herstellung von Textilien, Bekleidung sowie von Leder, Lederwaren und Schuhen |
|
5 |
16-18 |
Herstellung von Erzeugnissen aus Holz und Papier sowie Druckerzeugnissen |
|
6 |
19 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung |
|
7 |
20 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
|
8 |
21 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
|
9 |
22-23 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren sowie von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
|
10 |
24-25 |
Metallerzeugung und -bearbeitung; Herstellung von Metallerzeugnissen |
|
11 |
26 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
|
12 |
27 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
|
13 |
28 |
Maschinenbau |
|
14 |
29-30 |
Herstellung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen |
|
15 |
31-33 |
Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren sowie Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
|
16 |
35 |
Energieversorgung |
|
17 |
36-39 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
|
18 |
41-43 |
Baugewerbe/Bau |
|
19 |
45-47 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
|
20 |
49-53 |
Verkehr und Lagerei |
|
21 |
55-56 |
Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie |
|
22 |
58-60 |
Verlagswesen, audiovisuelle Medien und Rundfunk |
|
23 |
61 |
Telekommunikation |
|
24 |
62-63 |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informationsdienstleistungen |
|
25 |
64-66 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
|
26 |
68 |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
26a |
|
darunter: unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen |
|
27 |
69-71 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung; Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
|
28 |
72 |
Forschung und Entwicklung |
|
29 |
73-75 |
Werbung und Marktforschung; Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten; Veterinärwesen |
|
30 |
77-82 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
|
31 |
84 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
|
32 |
85 |
Erziehung und Unterricht |
|
33 |
86 |
Gesundheitswesen |
|
34 |
87-88 |
Sozialwesen |
|
35 |
90-93 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung |
|
36 |
94-96 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen |
|
37 |
97-98 |
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
38 |
99 |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
A*64
|
Lfd. Nr. |
Abteilungen der NACE REV. 2 |
Bezeichnung |
|
1 |
01 |
Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
|
2 |
02 |
Forstwirtschaft und Holzeinschlag |
|
3 |
03 |
Fischerei und Aquakultur |
|
4 |
05-09 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
|
5 |
10-12 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung, Tabakverarbeitung |
|
6 |
13-15 |
Herstellung von Textilien, Bekleidung sowie von Leder, Lederwaren und Schuhen |
|
7 |
16 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
|
8 |
17 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
|
9 |
18 |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
|
10 |
19 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung |
|
11 |
20 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
|
12 |
21 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
|
13 |
22 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
|
14 |
23 |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
|
15 |
24 |
Metallerzeugung und -bearbeitung |
|
16 |
25 |
Herstellung von Metallerzeugnissen |
|
17 |
26 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
|
18 |
27 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
|
19 |
28 |
Maschinenbau |
|
20 |
29 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
|
21 |
30 |
Sonstiger Fahrzeugbau |
|
22 |
31-32 |
Herstellung von Möbeln; Herstellung von sonstigen Waren |
|
23 |
33 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
|
24 |
35 |
Energieversorgung |
|
25 |
36 |
Wasserversorgung |
|
26 |
37-39 |
Abwasserentsorgung; Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung; Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
|
27 |
41-43 |
Baugewerbe/Bau |
|
28 |
45 |
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
|
29 |
46 |
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) |
|
30 |
47 |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
|
31 |
49 |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
|
32 |
50 |
Schifffahrt |
|
33 |
51 |
Luftfahrt |
|
34 |
52 |
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
|
35 |
53 |
Post-, Kurier- und Expressdienste |
|
36 |
55-56 |
Beherbergung; Gastronomie |
|
37 |
58 |
Verlagswesen |
|
38 |
59-60 |
Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik; Rundfunkveranstalter |
|
39 |
61 |
Telekommunikation |
|
40 |
62-63 |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informationsdienstleistungen |
|
41 |
64 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen |
|
42 |
65 |
Versicherungen, Rückversicherungen und Alterssicherung (ohne Sozialversicherung) |
|
43 |
66 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
|
44 |
68 |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
44a |
|
darunter: unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen |
|
45 |
69-70 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
|
46 |
71 |
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
|
47 |
72 |
Forschung und Entwicklung |
|
48 |
73 |
Werbung und Marktforschung |
|
49 |
74-75 |
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten; Veterinärwesen |
|
50 |
77 |
Vermietung von beweglichen Sachen |
|
51 |
78 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
|
52 |
79 |
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
|
53 |
80-82 |
Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien; Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau; Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. |
|
54 |
84 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
|
55 |
85 |
Erziehung und Unterricht |
|
56 |
86 |
Gesundheitswesen |
|
57 |
87-88 |
Sozialwesen |
|
58 |
90-92 |
Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten; Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten; Spiel-, Wett- und Lotteriewesen |
|
59 |
93 |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
|
60 |
94 |
Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) |
|
61 |
95 |
Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern |
|
62 |
96 |
Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
|
63 |
97-98 |
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
64 |
99 |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
A*88
|
Lfd. Nr. |
Abteilungen der NACE REV. 2 |
Bezeichnung |
|
1 |
01 |
Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
|
2 |
02 |
Forstwirtschaft und Holzeinschlag |
|
3 |
03 |
Fischerei und Aquakultur |
|
4 |
05 |
Kohlenbergbau |
|
5 |
06 |
Gewinnung von Erdöl und Erdgas |
|
6 |
07 |
Erzbergbau |
|
7 |
08 |
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau |
|
8 |
09 |
Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden |
|
9 |
10 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
|
10 |
11 |
Getränkeherstellung |
|
11 |
12 |
Tabakverarbeitung |
|
12 |
13 |
Herstellung von Textilien |
|
13 |
14 |
Herstellung von Bekleidung |
|
14 |
15 |
Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen |
|
15 |
16 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
|
16 |
17 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
|
17 |
18 |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
|
18 |
19 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung |
|
19 |
20 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
|
20 |
21 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
|
21 |
22 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
|
22 |
23 |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
|
23 |
24 |
Metallerzeugung und -bearbeitung |
|
24 |
25 |
Herstellung von Metallerzeugnissen |
|
25 |
26 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
|
26 |
27 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
|
27 |
28 |
Maschinen |
|
28 |
29 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
|
29 |
30 |
Sonstiger Fahrzeugbau |
|
30 |
31 |
Herstellung von Möbeln |
|
31 |
32 |
Herstellung von sonstigen Waren |
|
32 |
33 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
|
33 |
35 |
Energieversorgung |
|
34 |
36 |
Wasserversorgung |
|
35 |
37 |
Abwasserentsorgung |
|
36 |
38 |
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung |
|
37 |
39 |
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
|
38 |
41 |
Hochbau |
|
39 |
42 |
Tiefbau |
|
40 |
43 |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
|
41 |
45 |
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
|
42 |
46 |
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) |
|
43 |
47 |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
|
44 |
49 |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
|
45 |
50 |
Schifffahrt |
|
46 |
51 |
Luftfahrt |
|
47 |
52 |
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
|
48 |
53 |
Post-, Kurier- und Expressdienste |
|
49 |
55 |
Beherbergung |
|
50 |
56 |
Gastronomie |
|
51 |
58 |
Verlagswesen |
|
52 |
59 |
Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik |
|
53 |
60 |
Rundfunkveranstalter |
|
54 |
61 |
Telekommunikation |
|
55 |
62 |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
|
56 |
63 |
Informationsdienstleistungen |
|
57 |
64 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen |
|
58 |
65 |
Versicherungen, Rückversicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen (ohne Sozialversicherung) |
|
59 |
66 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
|
60 |
68 |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
60a |
|
darunter: unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen |
|
61 |
69 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung |
|
62 |
70 |
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
|
63 |
71 |
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
|
64 |
72 |
Forschung und Entwicklung |
|
65 |
73 |
Werbung und Marktforschung |
|
66 |
74 |
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
|
67 |
75 |
Veterinärwesen |
|
68 |
77 |
Vermietung von beweglichen Sachen |
|
69 |
78 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
|
70 |
79 |
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
|
71 |
80 |
Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien |
|
72 |
81 |
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
|
73 |
82 |
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. |
|
74 |
84 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
|
75 |
85 |
Erziehung und Unterricht |
|
76 |
86 |
Gesundheitswesen |
|
77 |
87 |
Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) |
|
78 |
88 |
Sozialwesen (ohne Heime) |
|
79 |
90 |
Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten |
|
80 |
91 |
Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten |
|
81 |
92 |
Spiel-, Wett- und Lotteriewesen |
|
82 |
93 |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
|
83 |
94 |
Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) |
|
84 |
95 |
Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern |
|
85 |
96 |
Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
|
86 |
97 |
Private Haushalte mit Hauspersonal |
|
87 |
98 |
Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
88 |
99 |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
P*3
|
Lfd. Nr. |
Abschnitte der CPA 2008 |
Bezeichnung |
|
1 |
A |
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei |
|
2 |
B, C, D, E und F |
Bergbauerzeugnisse; Steine und Erden; Hergestellte Waren; Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung; Wasser; Dienstleistungen der Abwasser- und Abfallentsorgung und der Beseitigung von Unweltverschmutzungen; Gebäude und Bauarbeiten |
|
3 |
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T und U |
Dienstleistungen |
P*10
|
Lfd. Nr. |
Abschnitte der CPA 2008 |
Bezeichnung |
|
1 |
A |
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei |
|
2 |
B, C, D und E |
Bergbauerzeugnisse; Steine und Erden; Hergestellte Waren; Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung; Wasser; Dienstleistungen der Abwasser- und Abfallentsorgung und der Beseitigung von Unweltverschmutzungen |
|
2a |
C |
darunter: hergestellte Waren |
|
3 |
F |
Gebäude und Bauarbeiten |
|
4 |
G, H und I |
Handelsleistungen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen; Verkehrs- und Lagereileistungen; Beherbergungs- und Gastronomiedienstleistungen |
|
5 |
J |
Informations- und Kommunikationsdienstleistungen |
|
6 |
K |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
|
7 |
L |
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens |
|
8 |
M und N |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
9 |
O, P und Q |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung; Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen; Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens |
|
10 |
R, S, T und U |
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen; Sonstige Dienstleistungen |
P*21
|
Lfd. Nr. |
Abschnitt der CPA 2008 |
Abteilung der CPA 2008 |
Bezeichnung |
|
1 |
A |
01-03 |
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei |
|
2 |
B |
05-09 |
Bergbauerzeugnisse; Steine und Erden |
|
3 |
C |
10-33 |
Hergestellte Waren |
|
4 |
D |
35 |
Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung |
|
5 |
E |
36-39 |
Wasser; Dienstleistungen der Abwasser- und Abfallentsorgung und der Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
|
6 |
F |
41-43 |
Gebäude und Bauarbeiten |
|
7 |
G |
45-47 |
Handelsleistungen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen |
|
8 |
H |
49-53 |
Verkehrs- und Lagereileistungen |
|
9 |
I |
55-56 |
Beherbergungs- und Gastronomiedienstleistungen |
|
10 |
J |
58-63 |
Informations- und Kommunikationsdienstleistungen |
|
11 |
K |
64-66 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
|
12 |
L |
68 |
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens |
|
13 |
M |
69-75 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
|
14 |
N |
77-82 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
15 |
O |
84 |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung |
|
16 |
P |
85 |
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen |
|
17 |
Q |
86-88 |
Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens |
|
18 |
R |
90-93 |
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen |
|
19 |
S |
94-96 |
Sonstige Dienstleistungen |
|
20 |
T |
97-98 |
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen; von privaten Haushalten produzierte Waren und Dienstleistungen für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
21 |
U |
99 |
Dienstleistungen exterritorialer Organisationen und Körperschaften |
P*38
|
Lfd. Nr. |
Abteilungen der CPA 2008 |
Bezeichnung |
|
1 |
01-03 |
Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei |
|
2 |
05-09 |
Bergbauerzeugnisse; Steine und Erden |
|
3 |
10-12 |
Nahrungs- und Futtermittel, Getränke und Tabakerzeugnisse |
|
4 |
13-15 |
Textilien, Bekleidung sowie Leder und Lederwaren |
|
5 |
16-18 |
Waren aus Holz, Papier oder Pappe; Druckereileistungen |
|
6 |
19 |
Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse |
|
7 |
20 |
Chemische Erzeugnisse |
|
8 |
21 |
Pharmazeutische Erzeugnisse |
|
9 |
22-23 |
Gummi- und Kunststoffwaren sowie Glas und Glaswaren, Keramik, verarbeitete Steine und Erden |
|
10 |
24-25 |
Metalle und Metallerzeugnisse |
|
11 |
26 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse |
|
12 |
27 |
Elektrische Ausrüstungen |
|
13 |
28 |
Maschinen |
|
14 |
29-30 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile sowie sonstige Fahrzeuge |
|
15 |
31-33 |
Möbel; Waren, a. n. g.; Reparatur- und Installationsarbeiten an Maschinen und Ausrüstungen |
|
16 |
35 |
Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung |
|
17 |
36-39 |
Wasser; Abwasserentsorgungsdienstleistungen; Abfallentsorgungs- und Wertstoffrückgewinnungsdienstleistungen; Dienstleistungen der Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstigen Entsorgung |
|
18 |
41-43 |
Gebäude und Bauarbeiten |
|
19 |
45-47 |
Handelsleistungen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen |
|
20 |
49-53 |
Verkehrs- und Lagereileistungen |
|
21 |
55-56 |
Beherbergungs- und Gastronomiedienstleistungen |
|
22 |
58-60 |
Dienstleistungen des Verlagswesens, audiovisuelle und Rundfunkveranstaltungsleistungen |
|
23 |
61 |
Telekommunikationsdienstleistungen |
|
24 |
62-63 |
Dienstleistungen der EDV-Programmierung und -Beratung und damit verbundene Dienstleistungen; Informationsdienstleistungen |
|
25 |
64-66 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
|
26 |
68 |
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens |
|
26a |
|
darunter: unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen |
|
27 |
69-71 |
Rechts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsleistungen; Dienstleistungen der Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatungsleistungen; Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros und der technischen, physikalischen und chemischen Untersuchung |
|
28 |
72 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen |
|
29 |
73-75 |
Werbe- und Marktforschungsleistungen; sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; Dienstleistungen des Veterinärwesens |
|
30 |
77-82 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
31 |
84 |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung |
|
32 |
85 |
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen |
|
33 |
86 |
Dienstleistungen des Gesundheitswesens |
|
34 |
87-88 |
Dienstleistungen des Sozialwesens |
|
35 |
90-93 |
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen |
|
36 |
94-96 |
Sonstige Dienstleistungen |
|
37 |
97-98 |
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen; durch private Haushalte für den Eigenbedarf produzierte Waren und Dienstleistungen ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
38 |
99 |
Dienstleistungen exterritorialer Organisationen und Körperschaften |
P*64
|
Lfd. Nr. |
Abteilungen der CPA 2008 |
Bezeichnung |
|
1 |
01 |
Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd sowie damit verbundene Dienstleistungen |
|
2 |
02 |
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Dienstleistungen |
|
3 |
03 |
Fische und Fischereierzeugnisse; Aquakulturerzeugnisse; Dienstleistungen für die Fischerei |
|
4 |
05-09 |
Bergbauerzeugnisse; Steine und Erden; |
|
5 |
10-12 |
Nahrungs- und Futtermittel; Getränke; Tabakerzeugnisse |
|
6 |
13-15 |
Textilien; Bekleidung; Leder und Lederwaren |
|
7 |
16 |
Holz sowie Holz- und Korkwaren (ohne Möbel); Flecht- und Korbwaren |
|
8 |
17 |
Papier, Pappe und Waren daraus |
|
9 |
18 |
Dienstleistungen der Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern, Druckereileistungen |
|
10 |
19 |
Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse |
|
11 |
20 |
Chemische Erzeugnisse |
|
12 |
21 |
Pharmazeutische Erzeugnisse |
|
13 |
22 |
Gummi- und Kunststoffwaren |
|
14 |
23 |
Glas und Glaswaren, Keramik, verarbeitete Steine und Erden |
|
15 |
24 |
Metalle und Metallerzeugnisse |
|
16 |
25 |
Metallerzeugnisse |
|
17 |
26 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse |
|
18 |
27 |
Elektrische Ausrüstungen |
|
19 |
28 |
Maschinen |
|
20 |
29 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile |
|
21 |
30 |
Sonstige Fahrzeuge |
|
22 |
31-32 |
Möbel; Waren, a. n. g. |
|
23 |
33 |
Reparatur- und Installationsarbeiten an Maschinen und Ausrüstungen |
|
24 |
35 |
Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung |
|
25 |
36 |
Wasser; Dienstleistungen der Wasserversorgung sowie des Wasserhandels durch Rohrleitungen |
|
26 |
37-39 |
Abwasserentsorgungsdienstleistungen; Klärschlamm; Abfallentsorgungs- und Wertstoffrückgewinnungsdienstleistungen; Dienstleistungen der Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstigen Entsorgung |
|
27 |
41-43 |
Gebäude und Bauarbeiten |
|
28 |
45 |
Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen |
|
29 |
46 |
Großhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen) |
|
30 |
47 |
Einzelhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen) |
|
31 |
49 |
Landverkehrsleistungen und Transportleistungen in Rohrfernleitungen |
|
32 |
50 |
Schifffahrtsleistungen |
|
33 |
51 |
Luftfahrtleistungen |
|
34 |
52 |
Lagereileistungen sowie sonstige Unterstützungsdienstleistungen für den Verkehr |
|
35 |
53 |
Postdienstleistungen und private Kurier- und Expressdienstleistungen |
|
36 |
55-56 |
Beherbergungs- und Gastronomiedienstleistungen |
|
37 |
58 |
Dienstleistungen des Verlagswesens |
|
38 |
59-60 |
Dienstleistungen der Herstellung, des Verleihs und Vertriebs von Filmen und Fernsehprogrammen, von Kinos und Tonstudios; Verlagsleistungen bezüglich Musik; Rundfunkveranstaltungsleistungen |
|
39 |
61 |
Telekommunikationsdienstleistungen |
|
40 |
62-63 |
Dienstleistungen der EDV-Programmierung und -Beratung und damit verbundene Dienstleistungen; Informationsdienstleistungen |
|
41 |
64 |
Finanzdienstleistungen, außer Versicherungen und Pensionen |
|
42 |
65 |
Dienstleistungen von Versicherungen, Rückversicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen (ohne Sozialversicherung) |
|
43 |
66 |
Mit den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Dienstleistungen |
|
44 |
68 |
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens |
|
44a |
|
darunter: unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen |
|
45 |
69-70 |
Rechts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsleistungen; Dienstleistungen der Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatungsleistungen |
|
46 |
71 |
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros und der technischen, physikalischen und chemischen Untersuchung |
|
47 |
72 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen |
|
48 |
73 |
Werbe- und Marktforschungsleistungen |
|
49 |
74-75 |
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; Dienstleistungen des Veterinärwesens |
|
50 |
77 |
Dienstleistungen der Vermietung von beweglichen Sachen |
|
51 |
78 |
Dienstleistungen der Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften und des Personalmanagements |
|
52 |
79 |
Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern und sonstige Reservierungsdienstleistungen |
|
53 |
80-82 |
Wach-, Sicherheits- und Detekteileistungen; Dienstleistungen der Gebäudebetreuung und des Garten- und Landschaftsbaus; wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, a. n. g. |
|
54 |
84 |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung |
|
55 |
85 |
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen |
|
56 |
86 |
Dienstleistungen des Gesundheitswesens |
|
57 |
87-88 |
Dienstleistungen von Heimen (ohne Erholungs- und Ferienheime); Dienstleistungen des Sozialwesens (ohne Heime), a. n. g. |
|
58 |
90-92 |
Kreative, künstlerische und unterhaltende Dienstleistungen; Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen, botanischen und zoologischen Gärten; Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens |
|
59 |
93 |
Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
|
60 |
94 |
Dienstleistungen von Interessenvertretungen sowie kirchlichen und sonstigen religiösen Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) |
|
61 |
95 |
Reparaturarbeiten an Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern |
|
62 |
96 |
Sonstige überwiegend persönliche Dienstleistungen |
|
63 |
97-98 |
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen; durch private Haushalte für den Eigenbedarf produzierte Waren und Dienstleistungen ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
64 |
99 |
Dienstleistungen exterritorialer Organisationen und Körperschaften |
P*88
|
Lfd. Nr. |
Abteilungen der CPA 2008 |
Bezeichnung |
|
1 |
01 |
Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd sowie damit verbundene Dienstleistungen |
|
2 |
02 |
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Dienstleistungen |
|
3 |
03 |
Fische und Fischereierzeugnisse; Aquakulturerzeugnisse; Dienstleistungen für die Fischerei |
|
4 |
05 |
Kohle |
|
5 |
06 |
Erdöl und Erdgas |
|
6 |
07 |
Erze |
|
7 |
08 |
Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse |
|
8 |
09 |
Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden |
|
9 |
10 |
Nahrungs- und Futtermittel |
|
10 |
11 |
Getränke |
|
11 |
12 |
Tabakerzeugnisse |
|
12 |
13 |
Textilien |
|
13 |
14 |
Bekleidung |
|
14 |
15 |
Leder und Lederwaren |
|
15 |
16 |
Holz sowie Holz- und Korkwaren (ohne Möbel); Flecht- und Korbwaren |
|
16 |
17 |
Papier, Pappe und Waren daraus |
|
17 |
18 |
Dienstleistungen der Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern, Druckereileistungen |
|
18 |
19 |
Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse |
|
19 |
20 |
Chemische Erzeugnisse |
|
20 |
21 |
Pharmazeutische Erzeugnisse |
|
21 |
22 |
Gummi- und Kunststoffwaren |
|
22 |
23 |
Glas und Glaswaren, Keramik, verarbeitete Steine und Erden |
|
23 |
24 |
Metalle und Metallerzeugnisse |
|
24 |
25 |
Metallerzeugnisse |
|
25 |
26 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse |
|
26 |
27 |
Elektrische Ausrüstungen |
|
27 |
28 |
Maschinen |
|
28 |
29 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile |
|
29 |
30 |
Sonstige Fahrzeuge |
|
30 |
31 |
Möbel |
|
31 |
32 |
Waren, a. n. g. |
|
32 |
33 |
Reparatur- und Installationsarbeiten an Maschinen und Ausrüstungen |
|
33 |
35 |
Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung |
|
34 |
36 |
Wasser; Dienstleistungen der Wasserversorgung sowie des Wasserhandels durch Rohrleitungen |
|
35 |
37 |
Abwasserentsorgungsdienstleistungen |
|
36 |
38 |
Dienstleistungen der Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen sowie zur Rückgewinnung von Wertstoffen |
|
37 |
39 |
Dienstleistungen der Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstigen Entsorgung |
|
38 |
41 |
Gebäude und Hochbauarbeiten |
|
39 |
42 |
Tiefbauten und Tiefbauarbeiten |
|
40 |
43 |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallationsarbeiten und sonstige Ausbauarbeiten |
|
41 |
45 |
Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen |
|
42 |
46 |
Großhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen) |
|
43 |
47 |
Einzelhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen) |
|
44 |
49 |
Landverkehrsleistungen und Transportleistungen in Rohrfernleitungen |
|
45 |
50 |
Schifffahrtsleistungen |
|
46 |
51 |
Luftfahrtleistungen |
|
47 |
52 |
Lagereileistungen sowie sonstige Unterstützungsdienstleistungen für den Verkehr |
|
48 |
53 |
Postdienstleistungen und private Kurier- und Expressdienstleistungen |
|
49 |
55 |
Beherbergungsdienstleistungen |
|
50 |
56 |
Gastronomiedienstleistungen |
|
51 |
58 |
Dienstleistungen des Verlagswesens |
|
52 |
59 |
Dienstleistungen der Herstellung, des Verleihs und Vertriebs von Filmen und Fernsehprogrammen; von Kinos und Tonstudios; Verlagsleistungen bezüglich Musik |
|
53 |
60 |
Rundfunkveranstaltungsleistungen |
|
54 |
61 |
Telekommunikationsdienstleistungen |
|
55 |
62 |
Dienstleistungen der EDV-Programmierung und -Beratung und damit verbundene Dienstleistungen |
|
56 |
63 |
Informationsdienstleistungen |
|
57 |
64 |
Finanzdienstleistungen, außer Versicherungen und Pensionen |
|
58 |
65 |
Dienstleistungen von Versicherungen, Rückversicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen (ohne Sozialversicherung) |
|
59 |
66 |
Mit den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Dienstleistungen |
|
60 |
68 |
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens |
|
60a |
|
darunter: unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen |
|
61 |
69 |
Rechts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsleistungen |
|
62 |
70 |
Dienstleistungen der Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatungsleistungen |
|
63 |
71 |
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros und der technischen, physikalischen und chemischen Untersuchung |
|
64 |
72 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen |
|
65 |
73 |
Werbe- und Marktforschungsleistungen |
|
66 |
74 |
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
|
67 |
75 |
Dienstleistungen des Veterinärwesens |
|
68 |
77 |
Dienstleistungen der Vermietung von beweglichen Sachen |
|
69 |
78 |
Dienstleistungen der Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften und des Personalmanagements |
|
70 |
79 |
Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern und sonstige Reservierungsdienstleistungen |
|
71 |
80 |
Wach-, Sicherheits- und Detekteileistungen |
|
72 |
81 |
Dienstleistungen der Gebäudebetreuung und des Garten- und Landschaftsbaus |
|
73 |
82 |
Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, a.n.g. |
|
74 |
84 |
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der Sozialversicherung |
|
75 |
85 |
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen |
|
76 |
86 |
Dienstleistungen des Gesundheitswesens |
|
77 |
87 |
Dienstleistungen von Heimen (ohne Erholungs- und Ferienheime) |
|
78 |
88 |
Dienstleistungen des Sozialwesens (ohne Heime), a. n. g. |
|
79 |
90 |
Kreative, künstlerische und unterhaltende Dienstleistungen |
|
80 |
91 |
Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen, botanischen und zoologischen Gärten |
|
81 |
92 |
Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens |
|
82 |
93 |
Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
|
83 |
94 |
Dienstleistungen von Interessenvertretungen sowie kirchlichen und sonstigen religiösen Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) |
|
84 |
95 |
Reparaturarbeiten an Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern |
|
85 |
96 |
Sonstige überwiegend persönliche Dienstleistungen |
|
86 |
97 |
Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen |
|
87 |
98 |
Durch private Haushalte für den Eigenbedarf produzierte Waren und Dienstleistungen ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
|
88 |
99 |
Dienstleistungen exterritorialer Organisationen und Körperschaften |
KLASSIFIKATION DER AUFGABENBEREICHE DES STAATES (COFOG)
|
01 |
Allgemeine öffentliche Verwaltung |
|
01.1 |
Exekutiv- und Legislativorgane, Finanz- und Steuerwesen, auswärtige Angelegenheiten |
|
01.2 |
Wirtschaftshilfe für das Ausland |
|
01.3 |
Allgemeine Dienste |
|
01.4 |
Grundlagenforschung |
|
01.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich allgemeine öffentliche Verwaltung |
|
01.6 |
Allgemeine öffentliche Verwaltung, a.n.g. |
|
01.7 |
Staatsschuldentransaktionen |
|
01.8 |
Transfers allgemeiner Art zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen |
|
02 |
Verteidigung |
|
02.1 |
Militärische Verteidigung |
|
02.2 |
Zivile Verteidigung |
|
02.3 |
Militärhilfe für das Ausland |
|
02.4 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Verteidigung |
|
02.5 |
Verteidigung, a. n. g. |
|
03 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit |
|
03.1 |
Polizei |
|
03.2 |
Feuerwehr |
|
03.3 |
Gerichte |
|
03.4 |
Justizvollzug |
|
03.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit |
|
03.6 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, a. n. g. |
|
04 |
Wirtschaftliche Angelegenheiten |
|
04.1 |
Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts |
|
04.2 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd |
|
04.3 |
Brennstoffe und Energie |
|
04.4 |
Bergbau, Herstellung von Waren und Bauwesen |
|
04.5 |
Verkehr |
|
04.6 |
Nachrichtenübermittlung |
|
04.7 |
Andere Wirtschaftsbereiche |
|
04.8 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich wirtschaftliche Angelegenheiten |
|
04.9 |
Wirtschaftliche Angelegenheiten, a. n. g. |
|
05 |
Umweltschutz |
|
05.1 |
Abfallwirtschaft |
|
05.2 |
Abwasserwirtschaft |
|
05.3 |
Vermeidung und Beseitigung von Umweltverunreinigungen |
|
05.4 |
Arten- und Landschaftsschutz |
|
05.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Umweltschutz |
|
05.6 |
Umweltschutz, a. n. g. |
|
06 |
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen |
|
06.1 |
Wohnungswesen |
|
06.2 |
Raumplanung |
|
06.3 |
Wasserversorgung |
|
06.4 |
Straßenbeleuchtung |
|
06.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen |
|
06.6 |
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen, a. n. g. |
|
07 |
Gesundheitswesen |
|
07.1 |
Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen |
|
07.2 |
Ambulante Behandlung |
|
07.3 |
Stationäre Behandlung |
|
07.4 |
Öffentlicher Gesundheitsdienst |
|
07.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Gesundheitswesen |
|
07.6 |
Gesundheitswesen, a. n. g. |
|
08 |
Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion |
|
08.1 |
Freizeitgestaltung und Sport |
|
08.2 |
Kultur |
|
08.3 |
Rundfunk- und Verlagswesen |
|
08.4 |
Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten |
|
08.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion |
|
08.6 |
Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion, a. n. g. |
|
09 |
Bildungswesen |
|
09.1 |
Elementar- und Primarbereich |
|
09.2 |
Sekundarbereich |
|
09.3 |
Postsekundarer, nichttertiärer Bereich |
|
09.4 |
Tertiärbereich |
|
09.5 |
Nicht zuordenbares Bildungswesen |
|
09.6 |
Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesen |
|
09.7 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Bildungswesen |
|
09.8 |
Bildungswesen, a. n. g. |
|
10 |
Soziale Sicherung |
|
10.1 |
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit |
|
10.2 |
Alter |
|
10.3 |
Hinterbliebene |
|
10.4 |
Familien und Kinder |
|
10.5 |
Arbeitslosigkeit |
|
10.6 |
Wohnraum |
|
10.7 |
Soziale Hilfe, a. n. g. |
|
10.8 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich soziale Sicherung |
|
10.9 |
Soziale Sicherung, a. n. g. |
KLASSIFIKATION DER VERWENDUNGSZWECKE DES INDIVIDUALKONSUMS (Coicop)
01-12 Konsumausgaben der privaten Haushalte
|
01 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke |
|
01.1 |
Nahrungsmittel |
|
01.2 |
Alkoholfreie Getränke |
|
02 |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren und Drogen |
|
02.1 |
Alkoholische Getränke |
|
02.2 |
Tabakwaren |
|
02.3 |
Drogen |
|
03 |
Bekleidung und Schuhe |
|
03.1 |
Bekleidung |
|
03.2 |
Schuhe |
|
04 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe |
|
04.1 |
Tatsächliche Mietzahlungen |
|
04.2 |
Unterstellte Mietzahlungen |
|
04.3 |
Regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnungen |
|
04.4 |
Wasserversorgung und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung |
|
04.5 |
Strom, Gas u. a. Brennstoffe |
|
05 |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
|
05.1 |
Möbel, Innenausstattung, Teppiche u. a. Bodenbeläge |
|
05.2 |
Heimtextilien |
|
05.3 |
Haushaltsgeräte |
|
05.4 |
Glaswaren, Tafelgeschirr u. a. Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung |
|
05.5 |
Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten |
|
05.6 |
Waren und Dienstleistungen für die Haushaltsführung |
|
06 |
Gesundheitspflege |
|
06.1 |
Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen |
|
06.2 |
Ambulante Gesundheitsdienstleistungen |
|
06.3 |
Stationäre Gesundheitsdienstleistungen |
|
07 |
Verkehr |
|
07.1 |
Kauf von Fahrzeugen |
|
07.2 |
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Privatfahrzeugen |
|
07.3 |
Verkehrsdienstleistungen |
|
08 |
Nachrichtenübermittlung |
|
08.1 |
Post- und Kurierdienstleistungen |
|
08.2 |
Telefon- und Telefaxgeräte, einschl. Reparatur |
|
08.3 |
Telefon- und Telefaxdienstleistungen |
|
09 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur |
|
09.1 |
Audiovisuelle, fotografische und Informationsverarbeitungsgeräte und Zubehör (einschl. Reparaturen) |
|
09.2 |
Andere größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur |
|
09.3 |
Andere Geräte und Artikel für Freizeitzwecke (einschl. Reparaturen); Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für Gartenpflege, Haustiere |
|
09.4 |
Freizeit- und Kulturdienstleistungen |
|
09.5 |
Zeitungen, Bücher und Schreibwaren |
|
09.6 |
Pauschalreisen |
|
10 |
Bildungswesen |
|
10.1 |
Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Elementar- und Primarbereichs |
|
10.2 |
Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Sekundarbereichs |
|
10.3 |
Dienstleistungen des postsekundaren, nichttertiären Bildungsbereichs |
|
10.4 |
Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs |
|
10.5 |
Dienstleistungen nicht einstufbarer Bildungseinrichtungen |
|
11 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen |
|
11.1 |
Verpflegungsdienstleistungen |
|
11.2 |
Beherbergungsdienstleistungen |
|
12 |
Andere Waren und Dienstleistungen |
|
12.1 |
Körperpflege |
|
12.2 |
Dienstleistungen der Prostitution |
|
12.3 |
Persönliche Gebrauchsgegenstände, a. n. g. |
|
12.4 |
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen |
|
12.5 |
Versicherungsdienstleistungen |
|
12.6 |
Finanzdienstleistungen, a. n. g. |
|
12.7 |
Andere Dienstleistungen, a. n. g. |
|
13 |
Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |
|
13.1 |
Wohnungswesen |
|
13.2 |
Gesundheitspflege |
|
13.3 |
Freizeit- und Kulturdienstleistungen |
|
13.4 |
Bildungswesen |
|
13.5 |
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen |
|
13.6 |
Andere Dienstleistungen |
|
14 |
Konsumausgaben des Staates für den Individualverbrauch |
|
14.1 |
Wohnungswesen |
|
14.2 |
Gesundheitspflege |
|
14.3 |
Freizeit- und Kulturdienstleistungen |
|
14.4 |
Bildungswesen |
|
14.5 |
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen |
KLASSIFIKATION DER AUFGABENBEREICHE DER PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK (COPNI)
|
01 |
Wohnungswesen |
|
02. |
Gesundheitswesen |
|
02.1 |
Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen |
|
02.2 |
Ambulante Behandlung |
|
02.3 |
Stationäre Behandlung |
|
02.4 |
Öffentlicher Gesundheitsdienst |
|
02.5 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Gesundheitswesen |
|
02.6 |
Sonstiger Gesundheitsdienst |
|
03 |
Freizeitgestaltung und Kultur |
|
03.1 |
Freizeitgestaltung und Sport |
|
03.2 |
Kultur |
|
04 |
Bildungswesen |
|
04.1 |
Elementar- und Primarbereich |
|
04.2 |
Sekundarbereich |
|
04.3 |
Postsekundarer, nichttertiärer Bereich |
|
04.4 |
Tertiärbereich |
|
04.5 |
Nicht zuordenbares Bildungswesen |
|
04.6 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Bildungswesen |
|
04.7 |
Andere Dienste im Bildungswesen |
|
05 |
Soziale Sicherung |
|
05.1 |
Soziale Sicherung |
|
05.2 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich soziale Sicherung |
|
06 |
Religion |
|
07 |
Politische Parteien, Arbeitsvereinigungen und Berufsverbände |
|
07.1 |
Dienste politischer Parteien |
|
07.2 |
Dienste von Arbeitnehmervereinigungen |
|
07.3 |
Dienste von Berufsverbänden |
|
08 |
Umweltschutz |
|
08.1 |
Umweltschutzdienste |
|
08.2 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Umweltschutz |
|
09 |
Dienste, a. n. g. |
|
09.1 |
Dienste, a. n. g. (ohne Forschung und Entwicklung) |
|
09.2 |
Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich Dienste, a. n. g. |
KLASSIFIKATION DER AUSGABENARTEN NACH ZWECKEN (COPP)
|
01 |
Infrastrukturausgaben |
|
01.1 |
Ausgaben für Bauarbeiten einschließlich baulicher Verbesserungen |
|
01.2 |
Ausgaben für Ingenieurarbeiten und damit verbundene technische Arbeiten |
|
01.3 |
Ausgaben für Informationsmanagement |
|
02 |
Ausgaben für Forschung und Entwicklung |
|
02.1 |
Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung in Natur- und Ingenieurwissenschaften |
|
02.2 |
Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung in Sozial- und Humanwissenschaften |
|
03 |
Umweltschutzausgaben |
|
03.1 |
Ausgaben für Luftreinhaltung und Klimaschutz |
|
03.2 |
Ausgaben für Gewässerschutz |
|
03.3 |
Ausgaben für Abfallwirtschaft |
|
03.4 |
Ausgaben für Boden- und Grundwasserschutz |
|
03.5 |
Ausgaben für Lärm- und Erschütterungsschutz |
|
03.6 |
Ausgaben für Arten- und Landschaftsschutz |
|
03.7 |
Umweltschutzausgaben, a. n. g. |
|
04 |
Vertriebsausgaben |
|
04.1 |
Ausgaben für Direktverkauf |
|
04.2 |
Werbeausgaben |
|
04.3 |
Vertriebsausgaben, a. n. g. |
|
05 |
Ausgaben für Personalentwicklung |
|
05.1 |
Bildungsausgaben |
|
05.2 |
Gesundheitsausgaben |
|
05.3 |
Sozialausgaben |
|
06 |
Ausgaben für laufende Produktionsprogramme, Verwaltung und Management |
|
06.1 |
Ausgaben für laufende Produktionsprogramme |
|
06.2 |
Ausgaben für außerbetrieblichen Transport |
|
06.3 |
Ausgaben für Schutz und Sicherheit |
|
06.4 |
Ausgaben für Verwaltung und Management |
(1) Bei allen Codes der Sektoren S.11 und S.12 gibt die 5. Ziffer – 1, 2 oder 3 – an, ob der betreffende Sektor öffentlich, privat oder ausländisch kontrolliert ist.
(2) Die Zentralbank (S.121) und die Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122) entsprechen dem Sektor S.12B.
(3) Versicherungsgesellschaften (S.128) und Alterssicherungssysteme (S.129) entsprechen dem Sektor S.12I.
(4) Die Arbeitgeberbeiträge erscheinen sowohl im Einkommensentstehungskonto als auch im primären Einkommensverteilungskonto als von den Arbeitgebern geleistete und von den Arbeitnehmern empfangene Beträge. Im Konto der sekundären Einkommensverteilung werden diese Beträge als von den privaten Haushalten geleistete und von den Sozialversicherungsträgern empfangene Beträge ausgewiesen. Damit in jedem Fall genau derselbe Wert ausgewiesen wird, wird der Abzug des Dienstleistungsentgelts, das einen Teil der Leistung der Sozialversicherungsträger und des Endverbrauchs der begünstigten privaten Haushalte darstellt, auch im Konto der sekundären Einkommensverteilung als gesonderte Position ausgewiesen. Bei der Position Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger (D.61SC) handelt es sich somit nur um eine Berichtigungsposition und nicht um eine Verteilungstransaktion im eigentlichen Sinne.
(5) Nachrichtlicher Ausweis: Ausländische Direktinvestitionen (Zusatzcode FDI).
(6) Sämtliche Kontensalden können brutto, d. h. einschließlich der Abschreibungen, oder netto, d. h. nach Abzug der Abschreibungen, ermittelt werden. Bruttosalden sind durch den Code der entsprechenden Position und den Buchstaben „g“ („gross“), Nettosalden durch den entsprechenden Code und den Buchstaben „n“ („net“) gekennzeichnet.
(7) Hierbei handelt es sich nicht um einen Kontensaldo, sondern um die Summe der Positionen auf der rechten Seite des Vermögensänderungskontos. Da sie jedoch ein wichtiger Bestandteil der Veränderung des Reinvermögens ist, wird sie wie die übrigen Bestandteile der Reinvermögensänderung codiert.
(8) Im Fall der übrigen Welt handelt es sich hierbei um die Veränderung des Reinvermögens aufgrund des Saldos der laufenden Transaktionen mit der übrigen Welt und aufgrund von Vermögenstransfers.
(9) Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter (AN.116) werden als Teil der Anlageinvestitionen behandelt, d. h. als Erwerb von Anlagegütern. Wenn die Bestände jedoch nach Kategorien aufgegliedert werden, wird der Wert dieser Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter den nichtproduzierten Vermögensgütern zugerechnet, auf die sie sich beziehen, und somit nicht gesondert als Teil von AN.11 ausgewiesen. Im Falle der Übertragung von Grund und Boden sind die Kosten der Eigentumsübertragung des gesamten Grund und Bodens unter der Position Bodenverbesserungen (AN.1123) gebucht. Die Position AN.116 wird in der obenstehenden detaillierten Liste nur für Darstellungszwecke angegeben.
(10) Nachrichtlicher Ausweis: Ausländische Direktinvestitionen (Zusatzcode FDI).
KAPITEL 24
DIE KONTEN
Tabelle 24.1 — Konto 0: Waren- und Dienstleistungskonto
|
Aufkommen |
Verwendung |
||||
|
P.1 |
Produktionswert |
3 604 |
P.2 |
Vorleistungen |
1 883 |
|
P.11 |
Marktproduktion |
3 077 |
P.3 |
Konsumausgaben |
1 399 |
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
147 |
P.31 |
Konsumausgaben für den Individualverbrauch |
1 230 |
|
P.13 |
Nichtmarktproduktion |
380 |
P.32 |
Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch |
169 |
|
D.21 |
Gütersteuern |
141 |
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
414 |
|
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
359 |
||
|
D.31 |
Gütersubventionen |
–8 |
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
358 |
|
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
9 |
||
|
P.7 |
Importe |
499 |
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
–8 |
|
P.71 |
Warenimporte |
392 |
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
17 |
|
P.72 |
Dienstleistungsimporte |
107 |
|
||
|
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
28 |
||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
10 |
|||
|
P.6 |
Exporte |
540 |
|||
|
P.61 |
Warenexporte |
462 |
|||
|
P.62 |
Dienstleistungsexporte |
78 |
|||
Tabelle 24.2 — Vollständige Kontenabfolge für die Volkswirtschaft
|
I: |
Produktionskonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
P.2 |
Vorleistungen |
1 883 |
P.1 |
Produktionswert |
3 604 |
|
|
P.11 |
Marktproduktion |
3 077 |
||
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
147 |
|||
|
P.13 |
Nichtmarktproduktion |
380 |
|||
|
D.21 – D.31 |
Gütersteuern abzüglich -subventionen |
133 |
|||
|
B.1*g |
Bruttoinlandsprodukt |
1 854 |
|
||
|
P.51c |
Abschreibungen |
222 |
|||
|
B.1*n |
Nettoinlandsprodukt |
1 632 |
|||
|
II: |
Verteilungs- und Verwendungskonten |
|
II.1: |
Konto der primären Einkommensverteilung |
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
1 150 |
B.1*g |
Bruttoinlandsprodukt |
1 854 |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
950 |
B.1*n |
Nettoinlandsprodukt |
1 632 |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
200 |
|
||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
168 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
13 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
18 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|||
|
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
235 |
|||
|
D.21 |
Gütersteuern |
141 |
|||
|
D.211 |
Mehrwertsteuer (MwSt.) |
121 |
|||
|
D.212 |
Importabgaben |
17 |
|||
|
D.2121 |
Zölle |
17 |
|||
|
D.2122 |
Importsteuern |
0 |
|||
|
D.214 |
Sonstige Gütersteuern |
3 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
94 |
|||
|
D.3 |
Subventionen |
–44 |
|||
|
D.31 |
Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.311 |
Importsubventionen |
0 |
|||
|
D.319 |
Sonstige Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
–36 |
|||
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
452 |
|||
|
B.3g |
Selbständigeneinkommen, brutto |
61 |
|||
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
214 |
|||
|
P.51c2 |
Abschreibungen bezüglich Bruttoselbständigeneinkommen |
8 |
|||
|
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
238 |
|||
|
B.3n |
Selbständigeneinkommen, netto |
53 |
|||
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
391 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
452 |
|
D.41 |
Zinsen |
217 |
B.3g |
Selbständigeneinkommen, brutto |
61 |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
62 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
238 |
|
D.421 |
Ausschüttungen |
54 |
B.3n |
Selbständigeneinkommen, netto |
53 |
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
8 |
|
||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
1 154 |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
47 |
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
954 |
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
200 |
|
|
|
25 |
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
168 |
|
|
|
8 |
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
13 |
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
|
|
|
14 |
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
18 |
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|
|
|
6 |
|
||
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
|
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
235 |
|
|
|
8 |
D.21 |
Gütersteuern |
141 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
65 |
D.211 |
Mehrwertsteuer (MwSt.) |
121 |
|
|
D.212 |
Importabgaben |
17 |
||
|
D.2121 |
Zölle |
17 |
|||
|
D.2122 |
Importsteuern |
0 |
|||
|
D.214 |
Sonstige Gütersteuern |
3 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
94 |
|||
|
D.3 |
Subventionen |
–44 |
|||
|
D.31 |
Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.311 |
Importsubventionen |
0 |
|||
|
D.319 |
Sonstige Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
–36 |
|||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
397 |
|||
|
D.41 |
Zinsen |
209 |
|||
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
62 |
|||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
53 |
|||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
9 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
14 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
47 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
25 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
8 |
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
14 |
|||
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
6 |
|||
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
8 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
65 |
|||
|
B.5*g |
Bruttonationaleinkommen |
1 864 |
|
||
|
B.5*n |
Nettonationaleinkommen |
1 642 |
|||
|
II.1.2.1: |
Unternehmensgewinnkonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
240 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
452 |
|
D.41 |
Zinsen |
162 |
B.3g |
Selbständigeneinkommen, brutto |
61 |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
47 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
238 |
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
25 |
B.3n |
Selbständigeneinkommen, netto |
53 |
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
|
||
|
|
|
8 |
D.4 |
Vermögenseinkommen |
245 |
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
D.41 |
Zinsen |
139 |
|
|
|
14 |
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
35 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
31 |
D.421 |
Ausschüttungen |
35 |
|
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
0 |
||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
11 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
16 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
5 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
0 |
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
11 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
44 |
|||
|
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
343 |
|
||
|
B.4n |
Unternehmensgewinn, netto |
174 |
|||
|
II.1.2.2: |
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
151 |
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
343 |
|
D.41 |
Zinsen |
55 |
B.4n |
Unternehmensgewinn, netto |
174 |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
62 |
|
||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
54 |
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
1 154 |
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
8 |
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
954 |
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
200 |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
|
|
|
|
|
||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
235 |
|
|
|
|
D.21 |
Gütersteuern |
141 |
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
D.211 |
Mehrwertsteuer (MwSt.) |
121 |
|
|
|
|
D.212 |
Importabgaben |
17 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
34 |
D.2121 |
Zölle |
17 |
|
|
D.2122 |
Importsteuern |
0 |
||
|
D.214 |
Sonstige Gütersteuern |
3 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
94 |
|||
|
D.3 |
Subventionen |
–44 |
|||
|
D.31 |
Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.311 |
Importsubventionen |
0 |
|||
|
D.319 |
Sonstige Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
–36 |
|||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
152 |
|||
|
D.41 |
Zinsen |
70 |
|||
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
27 |
|||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
18 |
|||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
9 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
3 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
31 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
20 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
8 |
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
3 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
21 |
|||
|
B.5*g |
Bruttonationaleinkommen |
1 864 |
|
||
|
B.5*n |
Nettonationaleinkommen |
1 642 |
|||
|
II.2: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
Laufende Transfers |
1 212 |
B.5*g |
Bruttonationaleinkommen |
1 864 |
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
212 |
B.5*n |
Nettonationaleinkommen |
1 642 |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
203 |
|
||
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
9 |
Laufende Transfers |
1 174 |
|
|
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
333 |
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
213 |
|
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
D.51 |
Einkommensteuern |
204 |
|
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
168 |
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
9 |
|
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
13 |
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
333 |
|
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
|
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
18 |
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
168 |
|
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
13 |
|
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
129 |
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
|
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
115 |
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
18 |
|
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
14 |
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|
D.614 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
10 |
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
129 |
|
D.6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Pensionseinrichtungen |
8 |
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
115 |
|
D.6142 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Alterssicherungssysteme) |
2 |
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
14 |
|
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger |
–6 |
D.614 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
10 |
|
|
D.6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Pensionseinrichtungen |
8 |
||
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
384 |
D.6142 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Alterssicherungssysteme) |
2 |
|
D.621 |
Geldleistungen der Sozialversicherung |
53 |
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger |
6 |
|
D.6211 |
Geldleistungen der Sozialversicherung zur Alterssicherung |
45 |
|
||
|
D.6212 |
Geldleistungen der Sozialversicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
8 |
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
384 |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen der sozialen Sicherung |
279 |
D.621 |
Geldleistungen der Sozialversicherung |
53 |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
250 |
D.6211 |
Geldleistungen der Sozialversicherung zur Alterssicherung |
45 |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen der Alterssicherung |
29 |
D.6212 |
Geldleistungen der Sozialversicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
8 |
|
D.623 |
Sonstige soziale Geldleistungen |
52 |
D.622 |
Sonstige Leistungen der sozialen Sicherung |
279 |
|
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
250 |
||
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
283 |
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
29 |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
56 |
D.623 |
Sonstige soziale Geldleistungen |
52 |
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
43 |
|
||
|
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
13 |
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
244 |
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
48 |
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
47 |
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
45 |
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
44 |
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
3 |
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
3 |
|
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
96 |
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
57 |
|
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
22 |
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
42 |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
52 |
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
15 |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
36 |
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
96 |
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
7 |
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
1 |
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
9 |
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
43 |
|
D.76 |
MwSt.- und BNE-basierte Eigenmittel |
9 |
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
36 |
|
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
1 |
||
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
6 |
|||
|
B.6*g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
1 826 |
|
||
|
B.6*n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
1 604 |
|||
|
II.3: |
Konto der Umverteilung von Sachleistungen |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.63 |
Soziale Sachleistungen |
215 |
B.6*g |
Verfügbares Nationaleinkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
1 826 |
|
D.631 |
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion |
211 |
B.6*n |
Verfügbares Nationaleinkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
1 604 |
|
D.632 |
Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion |
4 |
|
||
|
|
D.63 |
Soziale Sachleistungen |
215 |
||
|
D.631 |
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion |
211 |
|||
|
D.632 |
Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion |
4 |
|||
|
B.7*g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
1 826 |
|
||
|
B.7*n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
1 604 |
|||
|
II.4: |
Einkommensverwendungskonto |
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6*g |
Verfügbares Nationaleinkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
1 826 |
||
|
P.3 |
Konsumausgaben |
1 399 |
B.6*n |
Verfügbares Nationaleinkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
1 604 |
|
P.31 |
Konsumausgaben für den Individualverbrauch |
1 230 |
|
||
|
P.32 |
Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch |
169 |
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
|
||
|
B.8*g |
nationales Sparen, brutto |
427 |
|||
|
B.8*n |
nationales Sparen, netto |
205 |
|||
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
1 826 |
||
|
P.4 |
Konsum (Verbrauchskonzept) |
1 399 |
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
1 604 |
|
P.41 |
Individualkonsum (Verbrauchskonzept) |
1 230 |
|
||
|
P.42 |
Kollektivkonsum (Verbrauchskonzept) |
169 |
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
|
||
|
B.8*g |
nationales Sparen, brutto |
427 |
|||
|
B.8*n |
nationales Sparen, netto |
205 |
|||
|
III: |
Vermögensänderungskonten |
|
III.1: |
Vermögensbildungskonto |
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
202 |
B.8*n |
nationales Sparen, netto |
205 |
|
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
62 |
||
|
D.91r |
Empfangene vermögenswirksame Steuern |
2 |
|||
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
23 |
|||
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
37 |
|||
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
–65 |
|||
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
–2 |
|||
|
D.92p |
Geleistete Investitionszuschüsse |
–27 |
|||
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
–36 |
|||
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
414 |
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
202 |
|
P.5n |
Nettoinvestitionen |
192 |
|
||
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
376 |
|||
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
359 |
|||
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
358 |
|||
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
9 |
|||
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
–8 |
|||
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
17 |
|||
|
P.51c |
Abschreibungen |
– 222 |
|||
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
28 |
|||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
10 |
|||
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
0 |
|||
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
0 |
|||
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
0 |
|||
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
0 |
|||
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
10 |
|||
|
III.2: |
Finanzierungskonto |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
10 |
||
|
F |
Nettozugang an finanziellen Aktiva |
436 |
F |
Nettozugang an Passiva |
426 |
|
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
–1 |
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
F.11 |
Währungsgold |
–1 |
F.11 |
Währungsgold |
|
|
F.12 |
SZR |
0 |
F.12 |
SZR |
0 |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
89 |
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
102 |
|
F.21 |
Bargeld |
33 |
F.21 |
Bargeld |
35 |
|
F.22 |
Sichteinlagen |
26 |
F.22 |
Sichteinlagen |
28 |
|
F.221 |
Interbankpositionen |
–5 |
F.221 |
Interbankpositionen |
–5 |
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
31 |
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
33 |
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
30 |
F.29 |
Sonstige Einlagen |
39 |
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
86 |
F.3 |
Schuldverschreibungen |
74 |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
27 |
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
24 |
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
59 |
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
50 |
|
F.4 |
Kredite |
78 |
F.4 |
Kredite |
47 |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
22 |
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
11 |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
56 |
F.42 |
Langfristige Kredite |
36 |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
107 |
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
105 |
|
F.51 |
Anteilsrechte |
91 |
F.51 |
Anteilsrechte |
94 |
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
77 |
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
84 |
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
7 |
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
7 |
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
7 |
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
3 |
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
16 |
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
11 |
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
7 |
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
5 |
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
9 |
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
6 |
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
48 |
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
48 |
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
7 |
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
7 |
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
22 |
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
22 |
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
11 |
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
11 |
|
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Pensionseinrichtungen |
3 |
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Pensionseinrichtungen |
3 |
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
2 |
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
2 |
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
3 |
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
3 |
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
14 |
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
11 |
|
F.71 |
Finanzderivate |
12 |
F.71 |
Finanzderivate |
9 |
|
F.711 |
Optionen |
5 |
F.711 |
Optionen |
4 |
|
F.712 |
Terminkontrakte |
7 |
F.712 |
Terminkontrakte |
5 |
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
2 |
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
2 |
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
15 |
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
39 |
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
7 |
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
16 |
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
8 |
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
23 |
|
III.3: |
Konto sonstiger Vermögensänderungen |
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
33 |
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
1 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
3 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
30 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
26 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
1 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
4 |
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
2 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
2 |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
–11 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
–8 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
–8 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
2 |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
–3 |
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
–1 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
–2 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
–11 |
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
3 |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–9 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
–2 |
AN.11 |
Anlagegüter |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
AN.12 |
Vorräte |
|
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
0 |
AN.13 |
Wertsachen |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
|
|
AF |
Forderungen |
0 |
AN.22 |
Nutzungsrechte |
|
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
2 |
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 |
AF |
Forderungen |
3 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
1 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
2 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
2 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
–2 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–2 |
|
||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
13 |
||||
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–7 |
|||
|
AN.11 |
Anlagegüter |
–2 |
|||
|
AN.12 |
Vorräte |
–3 |
|||
|
AN.13 |
Wertsachen |
–2 |
|||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
17 |
|||
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
9 |
|||
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
6 |
|||
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen |
3 |
|||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
|
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
10 |
||
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
280 |
AF |
Verbindlichkeiten |
76 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
126 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
111 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
7 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
42 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
8 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
154 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
34 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
152 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
2 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
84 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
12 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
40 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
32 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
288 |
||
|
III.3.2.1: |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
198 |
AF |
Verbindlichkeiten |
126 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
121 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
111 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
30 |
|
AN.12 |
Vorräte |
4 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
26 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
6 |
AF.4 |
Kredite |
29 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
77 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
28 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
76 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
7 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
6 |
|
AF |
Forderungen |
136 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
16 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
30 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
25 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
28 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
26 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
7 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|||
|
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
208 |
||
|
III.3.2.2: |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
82 |
AF |
Verbindlichkeiten |
–50 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
5 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–30 |
|
AN.12 |
Vorräte |
3 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
16 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
2 |
AF.4 |
Kredite |
–29 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
77 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
6 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
76 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
–7 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–6 |
|
AF |
Forderungen |
–52 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
–4 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–30 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
15 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
–28 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
6 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
–7 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–4 |
|||
|
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
80 |
||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.1: |
Bilanz am Jahresanfang |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
4 621 |
AF |
Verbindlichkeiten |
7 762 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
2 818 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
2 579 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 471 |
|
AN.12 |
Vorräte |
114 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 311 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
125 |
AF.4 |
Kredite |
1 437 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
1 803 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 756 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
1 781 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
471 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
22 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
14 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
302 |
|
AF |
Forderungen |
8 231 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
770 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 482 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 263 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
1 384 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 614 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
470 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
21 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
227 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
5 090 |
||
|
IV.2: |
Änderung der Bilanz |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
Gesamte Veränderung der Aktiva |
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
482 |
AF |
Verbindlichkeiten |
505 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
294 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
246 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
102 |
|
AN.12 |
Vorräte |
32 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
116 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
16 |
AF.4 |
Kredite |
47 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
186 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
141 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
178 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
49 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
8 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
11 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
39 |
|
AF |
Forderungen |
523 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
11 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
89 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
126 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
78 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
141 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
49 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
14 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
15 |
|||
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
500 |
||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
202 |
|||
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
10 |
|||
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
288 |
|||
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
208 |
|||
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
80 |
|||
|
IV.3: |
Bilanz am Jahresende |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
5 101 |
AF |
Verbindlichkeiten |
8 267 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
3 112 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
2 825 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 573 |
|
AN.12 |
Vorräte |
146 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 427 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
141 |
AF.4 |
Kredite |
1 484 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
1 989 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 897 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
1 959 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
520 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
30 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
25 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
341 |
|
AF |
Forderungen |
8 754 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
781 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 571 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 389 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
1 462 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 755 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
519 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
35 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
242 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
5 590 |
||
Tabelle 24.3 — Vollständige Kontenabfolge für den Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
|
I: |
Produktionskonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
P.2 |
Vorleistungen |
1 477 |
P.1 |
Produktionswert |
2 808 |
|
|
P.11 |
Marktproduktion |
2 808 |
||
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
0 |
|||
|
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
1 331 |
|
||
|
P.51c |
Abschreibungen |
157 |
|||
|
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
1 174 |
|||
|
II: |
Verteilungs- und Verwendungskonten |
|
II.1: |
Konto der primären Einkommensverteilung |
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
986 |
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
1 331 |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
841 |
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
1 174 |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
145 |
|
||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
132 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
122 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
10 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
13 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
12 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
88 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
–35 |
|||
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
292 |
|||
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
157 |
|||
|
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
135 |
|||
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
134 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
292 |
|
D.41 |
Zinsen |
56 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
135 |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
47 |
|
||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
39 |
D.4 |
Vermögenseinkommen |
96 |
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
8 |
D.41 |
Zinsen |
33 |
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
10 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
31 |
D.421 |
Ausschüttungen |
10 |
|
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
|
||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
4 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
8 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
5 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
3 |
|||
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
1 |
|||
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
2 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
41 |
|||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
254 |
|
||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
97 |
|||
|
II.1.2.1: |
Unternehmensgewinnkonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
87 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
292 |
|
D.41 |
Zinsen |
56 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
135 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
31 |
|
||
|
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
96 |
||
|
D.41 |
Zinsen |
33 |
|||
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
10 |
|||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
10 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
4 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
8 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
5 |
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
3 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
41 |
|||
|
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
301 |
|
||
|
B.4n |
Unternehmensgewinn, netto |
144 |
|||
|
II.1.2.2: |
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
47 |
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
301 |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
47 |
B.4n |
Unternehmensgewinn, netto |
144 |
|
D.421 |
Ausschüttungen |
39 |
|
||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
8 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
|||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
254 |
|||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
97 |
|||
|
II.2: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
Laufende Transfers |
98 |
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
254 |
|
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
24 |
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
97 |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
20 |
|
||
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
4 |
Laufende Transfers |
72 |
|
|
|
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
66 |
||
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
62 |
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
31 |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen der sozialen Sicherung |
62 |
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
27 |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
49 |
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
4 |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
13 |
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
12 |
|
|
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
12 |
||
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
12 |
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
8 |
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
25 |
|
D.711 |
Nettoprämien der Nichtlebens-Direktversicherung |
8 |
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
19 |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
4 |
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
6 |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
1 |
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger |
2 |
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
3 |
|
||
|
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
6 |
||
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
6 |
|||
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
6 |
|||
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
0 |
|||
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
228 |
|
||
|
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
71 |
|||
|
II.4: |
Einkommensverwendungskonto |
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
228 |
||
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
71 |
|
B.8g |
Sparen, brutto |
228 |
|
||
|
B.8n |
Sparen, netto |
71 |
|||
|
III: |
Vermögensänderungskonten |
|
III.1: |
Vermögensbildungskonto |
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
88 |
B.8n |
Sparen, netto |
71 |
|
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
33 |
||
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
23 |
|||
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
10 |
|||
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
–16 |
|||
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
0 |
|||
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
–16 |
|||
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
308 |
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
88 |
|
P.5n |
Nettoinvestitionen |
151 |
|
||
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
280 |
|||
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
263 |
|||
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
262 |
|||
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
5 |
|||
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
–4 |
|||
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
17 |
|||
|
P.51c |
Abschreibungen |
– 157 |
|||
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
26 |
|||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
2 |
|||
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
–7 |
|||
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
–6 |
|||
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
–1 |
|||
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
0 |
|||
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
–56 |
|||
|
III.2: |
Finanzierungskonto |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
–56 |
||
|
F |
Nettozugang an finanziellen Aktiva |
83 |
F |
Nettozugang an Passiva |
139 |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
39 |
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
F.21 |
Bargeld |
5 |
F.21 |
Bargeld |
|
|
F.22 |
Sichteinlagen |
30 |
F.22 |
Sichteinlagen |
|
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
30 |
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
|
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
4 |
F.29 |
Sonstige Einlagen |
|
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
7 |
F.3 |
Schuldverschreibungen |
6 |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
10 |
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
2 |
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
–3 |
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
4 |
|
F.4 |
Kredite |
19 |
F.4 |
Kredite |
21 |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
14 |
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
4 |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
5 |
F.42 |
Langfristige Kredite |
17 |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
10 |
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
83 |
|
F.51 |
Anteilsrechte |
10 |
F.51 |
Anteilsrechte |
83 |
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
5 |
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
77 |
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
3 |
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
3 |
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
2 |
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
3 |
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
0 |
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
|
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
0 |
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
|
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
0 |
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
|
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
1 |
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
|
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
0 |
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
|
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
0 |
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
|
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
|
F.71 |
Finanzderivate |
3 |
F.71 |
Finanzderivate |
2 |
|
F.711 |
Optionen |
1 |
F.711 |
Optionen |
2 |
|
F.712 |
Terminkontrakte |
2 |
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
1 |
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
26 |
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
3 |
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
6 |
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
1 |
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
20 |
|
III.3: |
Konto sonstiger Vermögensänderungen |
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
26 |
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
26 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
22 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
4 |
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
–9 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
–6 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
–6 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
–3 |
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
–1 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
–2 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
–5 |
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
0 |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–5 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.11 |
Anlagegüter |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
AN.12 |
Vorräte |
|
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
–5 |
AN.13 |
Wertsachen |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–1 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
–4 |
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
|
|
AF |
Forderungen |
0 |
AN.22 |
Nutzungsrechte |
|
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
1 |
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 |
AF |
Forderungen |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
6 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
6 |
AF.4 |
Kredite |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
3 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
1 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
2 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
14 |
||||
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–2 |
|||
|
AN.11 |
Anlagegüter |
1 |
|||
|
AN.12 |
Vorräte |
–3 |
|||
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
|||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
14 |
|||
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
10 |
|||
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
4 |
|||
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen |
2 |
|||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
14 |
||
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
144 |
AF |
Verbindlichkeiten |
18 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
63 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
58 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
AN.12 |
Vorräte |
4 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
1 |
AF.4 |
Kredite |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
81 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
17 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
80 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
8 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
3 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
|
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
5 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
134 |
||
|
III.3.2.1: |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
101 |
AF |
Verbindlichkeiten |
37 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
60 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
58 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 |
|
AN.12 |
Vorräte |
1 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
1 |
AF.4 |
Kredite |
18 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
41 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
14 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
40 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
3 |
|
AF |
Forderungen |
18 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
8 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
2 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
1 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
3 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
3 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
82 |
||
|
III.3.2.2: |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
43 |
AF |
Verbindlichkeiten |
–19 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
3 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–1 |
|
AN.12 |
Vorräte |
3 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
–18 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
40 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
3 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
40 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–3 |
|
AF |
Forderungen |
–10 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–8 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
–1 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
–1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–3 |
|||
|
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
52 |
||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.1: |
Bilanz am Jahresanfang |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
2 151 |
AF |
Verbindlichkeiten |
3 221 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 274 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
1 226 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
40 |
|
AN.12 |
Vorräte |
43 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
44 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
5 |
AF.4 |
Kredite |
897 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
877 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 987 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
864 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
12 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
13 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
4 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
237 |
|
AF |
Forderungen |
982 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
382 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
90 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
50 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
280 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
25 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
5 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
150 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
–88 |
||
|
IV.2: |
Änderung der Bilanz |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
Gesamte Veränderung der Aktiva |
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
301 |
AF |
Verbindlichkeiten |
157 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
195 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
165 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
27 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
7 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
3 |
AF.4 |
Kredite |
21 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
106 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
100 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
101 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
5 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
26 |
|
AF |
Forderungen |
93 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
39 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
10 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
19 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
17 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|||
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
237 |
||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
88 |
|||
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
14 |
|||
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
134 |
|||
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
82 |
|||
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
52 |
|||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.3: |
Bilanz am Jahresende |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
2 452 |
AF |
Verbindlichkeiten |
3 378 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 469 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
1 391 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
40 |
|
AN.12 |
Vorräte |
70 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
51 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
8 |
AF.4 |
Kredite |
918 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
983 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 087 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
965 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
12 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
18 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
7 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
263 |
|
AF |
Forderungen |
1 075 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
421 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
100 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
69 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
297 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
26 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
8 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
154 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
149 |
||
Tabelle 24.4 — Vollständige Kontenabfolge für den Sektor finanzielle Kapitalgesellschaften
|
I: |
Produktionskonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
P.2 |
Vorleistungen |
52 |
P.1 |
Produktionswert |
146 |
|
|
P.11 |
Marktproduktion |
146 |
||
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
0 |
|||
|
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
94 |
|
||
|
P.51c |
Abschreibungen |
12 |
|||
|
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
82 |
|||
|
II: |
Verteilungs- und Verwendungskonten |
|
II.1: |
Konto der primären Einkommensverteilung |
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
44 |
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
94 |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
29 |
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
82 |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
5 |
|
||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
4 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
4 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
1 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
1 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
4 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
0 |
|||
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
46 |
|||
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
12 |
|||
|
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
34 |
|||
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
168 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
46 |
|
D.41 |
Zinsen |
106 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
34 |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
15 |
|
||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
15 |
D.4 |
Vermögenseinkommen |
149 |
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
0 |
D.41 |
Zinsen |
106 |
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
25 |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
47 |
D.421 |
Ausschüttungen |
25 |
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
0 |
|
|
|
25 |
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
7 |
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
8 |
|
|
|
8 |
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
|
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
|
|
0 |
|
|
|
14 |
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
|
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
|
|
|
3 |
|
|
|
8 |
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
|
|
D.45 |
Pachteinkommen |
0 |
|
|
5 |
|
|
D.45 |
Pachteinkommen |
3 |
||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
27 |
|
||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
15 |
|||
|
II.1.2.1: |
Unternehmensgewinnkonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
153 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
46 |
|
D.41 |
Zinsen |
106 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
34 |
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
47 |
|
||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
25 |
D.4 |
Vermögenseinkommen |
149 |
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
D.41 |
Zinsen |
106 |
|
|
|
8 |
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
25 |
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
|
D.421 |
Ausschüttungen |
25 |
|
|
|
14 |
D.422 |
Gewinnentnahmen |
0 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
0 |
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
7 |
|
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
8 |
||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
0 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
8 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
3 |
|||
|
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
42 |
|
||
|
B.4n |
Unternehmensgewinn, netto |
30 |
|||
|
II.1.2.2: |
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
15 |
B.4g |
Unternehmensgewinn, brutto |
42 |
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
15 |
B.4n |
Unternehmensgewinn, netto |
30 |
|
D.421 |
Ausschüttungen |
15 |
|
||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
0 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
|||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
27 |
|||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
15 |
|||
|
II.2: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
Laufende Transfers |
277 |
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
27 |
|
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
10 |
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
15 |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
7 |
|
||
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
3 |
Laufende Transfers |
275 |
|
|
|
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
212 |
||
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
205 |
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
109 |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen der sozialen Sicherung |
205 |
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
104 |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
193 |
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
5 |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
12 |
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
2 |
|
|
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
1 |
||
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
62 |
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
13 |
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
94 |
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
0 |
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
90 |
|
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
13 |
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
4 |
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
48 |
D.614 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
10 |
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
45 |
D.6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Pensionseinrichtungen |
8 |
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
3 |
D.6142 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Alterssicherungssysteme) |
2 |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
1 |
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger |
3 |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
1 |
|
||
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
0 |
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
62 |
|
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
47 |
||
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
44 |
|||
|
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
3 |
|||
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
15 |
|||
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
15 |
|||
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
0 |
|||
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
25 |
|
||
|
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
13 |
|||
|
II.4: |
Einkommensverwendungskonto |
|
|
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
25 |
||
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
13 |
|
B.8g |
Sparen, brutto |
14 |
|
||
|
B.8n |
Sparen, netto |
2 |
|||
|
III: |
Vermögensänderungskonten |
|
III.1: |
Vermögensbildungskonto |
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–5 |
B.8n |
Sparen, netto |
2 |
|
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
0 |
||
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
0 |
|||
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
|
|||
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
–7 |
|||
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
0 |
|||
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
–7 |
|||
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
8 |
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–5 |
|
P.5n |
Nettoinvestitionen |
–4 |
|
||
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
8 |
|||
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
8 |
|||
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
8 |
|||
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
0 |
|||
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
0 |
|||
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
|||
|
P.51c |
Abschreibungen |
–12 |
|||
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
0 |
|||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
0 |
|||
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
0 |
|||
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
0 |
|||
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
0 |
|||
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzelnveräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
0 |
|||
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
–1 |
|||
|
III.2: |
Finanzierungskonto |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
–1 |
||
|
F |
Nettozugang an finanziellen Aktiva |
172 |
F |
Nettozugang an Passiva |
173 |
|
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
–1 |
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
F.11 |
Währungsgold |
–1 |
F.11 |
Währungsgold |
0 |
|
F.12 |
SZR |
0 |
F.12 |
SZR |
0 |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
10 |
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
65 |
|
F.21 |
Bargeld |
15 |
F.21 |
Bargeld |
|
|
F.22 |
Sichteinlagen |
–5 |
F.22 |
Sichteinlagen |
26 |
|
F.221 |
Interbankpositionen |
–5 |
F.221 |
Interbankpositionen |
–5 |
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
0 |
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
31 |
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
0 |
F.29 |
Sonstige Einlagen |
39 |
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
66 |
F.3 |
Schuldverschreibungen |
30 |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
13 |
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
18 |
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
53 |
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
12 |
|
F.4 |
Kredite |
53 |
F.4 |
Kredite |
0 |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
4 |
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
0 |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
49 |
F.42 |
Langfristige Kredite |
0 |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
28 |
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
22 |
|
F.51 |
Anteilsrechte |
25 |
F.51 |
Anteilsrechte |
11 |
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
23 |
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
7 |
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
1 |
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
4 |
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
1 |
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
0 |
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
3 |
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
11 |
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
2 |
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
5 |
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
1 |
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
6 |
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
7 |
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
48 |
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
2 |
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
7 |
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
0 |
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
22 |
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
11 |
|
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen |
3 |
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen |
3 |
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
2 |
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
2 |
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
3 |
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
8 |
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
8 |
|
F.71 |
Finanzderivate |
8 |
F.71 |
Finanzderivate |
7 |
|
F.711 |
Optionen |
3 |
F.711 |
Optionen |
2 |
|
F.712 |
Terminkontrakte |
5 |
F.712 |
Terminkontrakte |
5 |
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
1 |
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
0 |
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
1 |
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
0 |
|
III.3: |
Konto sonstiger Vermögensänderungen |
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
0 |
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
0 |
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
0 |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.11 |
Anlagegüter |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
AN.12 |
Vorräte |
|
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
0 |
AN.13 |
Wertsachen |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
|
|
AF |
Forderungen |
0 |
AN.22 |
Nutzungsrechte |
|
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
1 |
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF |
Forderungen |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
1 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
–2 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
AF.4 |
Kredite |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
–2 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–2 |
|
||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen und Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
–1 |
||||
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–2 |
|||
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
|||
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
|||
|
AN.13 |
Wertsachen |
–2 |
|||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
–2 |
|||
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
|||
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen |
1 |
|||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–1 |
||
|
|
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
4 |
AF |
Verbindlichkeiten |
51 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
2 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
2 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
34 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
2 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
17 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
1 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
57 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
11 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
30 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
16 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
10 |
||
|
III.3.2.1: |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
3 |
AF |
Verbindlichkeiten |
68 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
2 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
2 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
26 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
21 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
1 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
14 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
1 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
7 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
71 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
14 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
18 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
24 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
14 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
6 |
||
|
III.3.2.2: |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
1 |
AF |
Verbindlichkeiten |
–17 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–26 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
13 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
1 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
3 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
–7 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
–14 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
–3 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
12 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
–24 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
–1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
4 |
||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.1: |
Bilanz am Jahresanfang |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
93 |
AF |
Verbindlichkeiten |
3 544 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
67 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
52 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 281 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 053 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
15 |
AF.4 |
Kredite |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
26 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
765 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
23 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
435 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
3 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
10 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
3 421 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
690 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
950 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
1 187 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
551 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
30 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
13 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
–30 |
||
|
IV.2: |
Änderung der Bilanz |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
|
Gesamte Veränderung der Aktiva |
|
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten |
||
|
AN |
Vermögensgüter |
–4 |
AF |
Verbindlichkeiten |
224 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–4 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
–2 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
65 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
64 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
–2 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
39 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
–1 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
48 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
1 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
8 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
230 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
10 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
10 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
96 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
53 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
44 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
8 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
8 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|||
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
2 |
||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–5 |
|||
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–1 |
|||
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
10 |
|||
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
6 |
|||
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
4 |
|||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.3: |
Bilanz am Jahresende |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
89 |
AF |
Verbindlichkeiten |
3 768 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
63 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
50 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 346 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 117 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
13 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
26 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
804 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
22 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
483 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
4 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
18 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
3 651 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
700 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
10 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 046 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
1 240 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
595 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
38 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
21 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
–28 |
||
Tabelle 24.5 — Vollständige Kontenabfolge für den Sektor Staat
|
I: |
Produktionskonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
P.2 |
Vorleistungen |
222 |
P.1 |
Produktionswert |
348 |
|
|
P.11 |
Marktproduktion |
0 |
||
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
0 |
|||
|
P.13 |
Nichtmarktproduktion |
348 |
|||
|
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
126 |
|
||
|
P.51c |
Abschreibungen |
27 |
|||
|
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
99 |
|||
|
II: |
Verteilungs- und Verwendungskonten |
|
II.1: |
Konto der primären Einkommensverteilung |
|
II.1.1: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
98 |
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
126 |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
63 |
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
99 |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
55 |
|
||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
51 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
48 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
3 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
4 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
4 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
1 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
0 |
|||
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
27 |
|||
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
27 |
|||
|
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
0 |
|||
|
II.1.2: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
42 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
27 |
|
D.41 |
Zinsen |
35 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
0 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
7 |
|
||
|
|
D.2 |
Produktions- und Importabgaben |
235 |
||
|
D.21 |
Gütersteuern |
141 |
|||
|
D.211 |
Mehrwertsteuer (MwSt.) |
121 |
|||
|
D.212 |
Importabgaben |
17 |
|||
|
D.2121 |
Zölle |
17 |
|||
|
D.2122 |
Importsteuern |
0 |
|||
|
D.214 |
Sonstige Gütersteuern |
3 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
94 |
|||
|
D.3 |
Subventionen |
–44 |
|||
|
D.31 |
Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.311 |
Importsubventionen |
0 |
|||
|
D.319 |
Sonstige Gütersubventionen |
–8 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
–36 |
|||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
22 |
|||
|
D.41 |
Zinsen |
14 |
|||
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
7 |
|||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
5 |
|||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
2 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
1 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
0 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
|
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
1 |
|||
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
0 |
|||
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
1 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
0 |
|||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
198 |
|
||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
171 |
|||
|
II.2: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
Laufende Transfers |
248 |
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
198 |
|
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
0 |
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
171 |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
0 |
|
||
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
0 |
Laufende Transfers |
367 |
|
|
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
213 |
||
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
112 |
D.51 |
Einkommensteuern |
204 |
|
D.621 |
Geldleistungen der Sozialversicherung |
53 |
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
9 |
|
D.6211 |
Geldleistungen der Sozialversicherung zur Alterssicherung |
45 |
|
||
|
D.6212 |
Geldleistungen der Sozialversicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
8 |
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
50 |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung |
7 |
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
38 |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
5 |
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
35 |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
2 |
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
3 |
|
D.623 |
Sonstige soziale Geldleistungen |
52 |
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
4 |
|
|
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
4 |
||
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
136 |
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
4 |
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
9 |
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
4 |
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
6 |
|
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
|
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
3 |
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
|
|
||
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
104 |
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
|
|
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
96 |
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
|
|
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
22 |
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
|
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
5 |
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
1 |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
5 |
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
1 |
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
|
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
0 |
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
96 |
|
D.76 |
MwSt.- und BNE-basierte EU-Eigenmittel |
9 |
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
1 |
|
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
6 |
||
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
|
|||
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
|
|||
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
6 |
|||
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
317 |
|
||
|
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
290 |
|||
|
II.3: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.63 |
Soziale Sachleistungen |
184 |
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
317 |
|
D.631 |
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion |
180 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
290 |
|
D.632 |
Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion |
4 |
|
||
|
|
|||||
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
133 |
|||
|
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
106 |
|||
|
II.4: |
Einkommensverwendungskonto |
|
II.4.1: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
317 |
||
|
P.3 |
Konsumausgaben |
352 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
290 |
|
P.31 |
Konsumausgaben für den Individualverbrauch |
184 |
|
||
|
P.32 |
Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch |
168 |
|||
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
|||
|
B.8g |
Sparen, brutto |
–35 |
|||
|
B.8n |
Sparen, netto |
–62 |
|||
|
II.4.2: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
133 |
||
|
P.4 |
Konsum (Verbrauchskonzept) |
168 |
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
106 |
|
P.41 |
Individualkonsum (Verbrauchskonzept) |
|
|
||
|
P.42 |
Kollektivkonsum (Verbrauchskonzept) |
168 |
|||
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
|||
|
B.8g |
Sparen, brutto |
–35 |
|||
|
B.8n |
Sparen, netto |
–62 |
|||
|
III: |
Vermögensänderungskonten |
|
III.1: |
Vermögensbildungskonto |
|
III.1.1: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–90 |
B.8n |
Sparen, netto |
–62 |
|
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
6 |
||
|
D.91r |
Empfangene vermögenswirksame Steuern |
2 |
|||
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
0 |
|||
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
4 |
|||
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
–34 |
|||
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
0 |
|||
|
D.92p |
Geleistete Investitionszuschüsse |
–27 |
|||
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
–7 |
|||
|
III.1.2: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
38 |
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–90 |
|
P.5n |
Nettoinvestitionen |
11 |
|
||
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
35 |
|||
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
35 |
|||
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
38 |
|||
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
0 |
|||
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
–3 |
|||
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
|
|||
|
P.51c |
Abschreibungen |
–27 |
|||
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
0 |
|||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
3 |
|||
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
2 |
|||
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
2 |
|||
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
0 |
|||
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
|
|||
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
– 103 |
|||
|
III.2: |
Finanzierungskonto |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
– 103 |
||
|
F |
Nettozugang an finanziellen Aktiva |
–10 |
F |
Nettozugang an Passiva |
93 |
|
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
F.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
F.11 |
Währungsgold |
|
F.11 |
Währungsgold |
|
|
F.12 |
SZR |
|
F.12 |
SZR |
|
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
–26 |
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
37 |
|
F.21 |
Bargeld |
2 |
F.21 |
Bargeld |
35 |
|
F.22 |
Sichteinlagen |
–27 |
F.22 |
Sichteinlagen |
2 |
|
F.221 |
Interbankpositionen |
|
F.221 |
Interbankpositionen |
|
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
–27 |
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
2 |
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
–1 |
F.29 |
Sonstige Einlagen |
0 |
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
4 |
F.3 |
Schuldverschreibungen |
38 |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
1 |
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
4 |
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
3 |
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
34 |
|
F.4 |
Kredite |
3 |
F.4 |
Kredite |
9 |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
1 |
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
3 |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
2 |
F.42 |
Langfristige Kredite |
6 |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
3 |
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
F.51 |
Anteilsrechte |
3 |
F.51 |
Anteilsrechte |
|
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
1 |
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
|
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
1 |
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
|
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
1 |
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
|
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
0 |
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
|
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
0 |
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
|
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
0 |
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
|
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
0 |
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
|
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
0 |
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
|
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
|
|
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Pensionseinrichtungen |
|
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Pensionseinrichtungen |
|
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
|
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
1 |
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
0 |
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
F.71 |
Finanzderivate |
0 |
F.71 |
Finanzderivate |
0 |
|
F.711 |
Optionen |
0 |
F.711 |
Optionen |
0 |
|
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
5 |
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
9 |
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
1 |
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
6 |
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
4 |
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
3 |
|
III.3: |
Konto sonstiger Vermögensänderungen |
|
III.3.1: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
7 |
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
3 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
4 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
4 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
2 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
2 |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
–2 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
–2 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
–2 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
2 |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
–6 |
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
2 |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–4 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
–2 |
AN.11 |
Anlagegüter |
|
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AN.12 |
Vorräte |
|
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
5 |
AN.13 |
Wertsachen |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
4 |
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
|
|
AF |
Forderungen |
0 |
AN.22 |
Nutzungsrechte |
|
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF |
Forderungen |
2 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
–4 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
–4 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–3 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
–1 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
|
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
0 |
||||
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
–3 |
|||
|
AN.11 |
Anlagegüter |
–3 |
|||
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
|||
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
|||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
3 |
|||
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
1 |
|||
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
2 |
|||
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
|||
|
AF |
Forderungen |
0 |
|||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|||
|
AF.4 |
Kredite |
|
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–2 |
||
|
III.3.2: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
44 |
AF |
Verbindlichkeiten |
7 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
21 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
18 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
1 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
7 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
2 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
23 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
23 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
1 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
1 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
38 |
||
|
III.3.2.1: |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
32 |
AF |
Verbindlichkeiten |
13 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
20 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
18 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
2 |
|
AN.12 |
Vorräte |
1 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
4 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
1 |
AF.4 |
Kredite |
7 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
12 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
12 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
8 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
2 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
3 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
3 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
27 |
||
|
III.3.2.2: |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
12 |
AF |
Verbindlichkeiten |
–6 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–2 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
3 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
1 |
AF.4 |
Kredite |
–7 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
11 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
11 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
–7 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
–1 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–3 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
–3 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
11 |
||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.1: |
Bilanz am Jahresanfang |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
789 |
AF |
Verbindlichkeiten |
687 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
497 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
467 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
102 |
|
AN.12 |
Vorräte |
22 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
212 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
8 |
AF.4 |
Kredite |
328 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
292 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
4 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
286 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
19 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
6 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
22 |
|
AF |
Forderungen |
396 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
80 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
150 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
115 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
12 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
20 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
19 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
498 |
||
|
IV.2: |
Änderung der Bilanz |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
|
Gesamte Veränderung der Aktiva |
|
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten |
||
|
AN |
Vermögensgüter |
57 |
AF |
Verbindlichkeiten |
102 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
29 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
23 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
37 |
|
AN.12 |
Vorräte |
1 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
45 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
5 |
AF.4 |
Kredite |
9 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
28 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
2 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
26 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
2 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
9 |
|
AF |
Forderungen |
–9 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
1 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–26 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
4 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
3 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
3 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
5 |
|||
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
–54 |
||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
90 |
|||
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–2 |
|||
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
38 |
|||
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
27 |
|||
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
11 |
|||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.3: |
Bilanz am Jahresende |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
846 |
AF |
Verbindlichkeiten |
789 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
526 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
0 |
|
AN.11 |
Anlagegüter |
490 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
139 |
|
AN.12 |
Vorräte |
23 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
257 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
13 |
AF.4 |
Kredite |
337 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
320 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
6 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
312 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
19 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
8 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
31 |
|
AF |
Forderungen |
387 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
81 |
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
124 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
4 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
118 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
15 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
21 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
24 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
444 |
||
Tabelle 24.6 — Vollständige Kontenabfolge für den Sektor private Haushalte
|
I: |
Produktionskonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
P.2 |
Vorleistungen |
115 |
P.1 |
Produktionswert |
270 |
|
|
P.11 |
Marktproduktion |
123 |
||
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
147 |
|||
|
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
155 |
|
||
|
P.51c |
Abschreibungen |
23 |
|||
|
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
132 |
|||
|
II: |
Verteilungs- und Verwendungskonten |
|
II.1: |
Konto der primären Einkommensverteilung |
|
II.1.1: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
11 |
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
155 |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
11 |
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
132 |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
0 |
|
||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
0 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
0 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
0 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
–1 |
|||
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
84 |
|||
|
B.3g |
Selbständigeneinkommen, brutto |
61 |
|||
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
15 |
|||
|
P.51c2 |
Abschreibungen bezüglich Bruttoselbständigeneinkommen |
8 |
|||
|
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
69 |
|||
|
B.3n |
Selbständigeneinkommen, netto |
53 |
|||
|
II.1.2: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
41 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
84 |
|
D.41 |
Zinsen |
14 |
B.3g |
Selbständigeneinkommen, brutto |
61 |
|
D.45 |
Pachteinkommen |
27 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
69 |
|
|
B.3n |
Selbständigeneinkommen, netto |
53 |
||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
1 154 |
|||
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
954 |
|||
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
200 |
|||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
168 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
13 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
18 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
123 |
|||
|
D.41 |
Zinsen |
49 |
|||
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
20 |
|||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
13 |
|||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
7 |
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
3 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
30 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
20 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Pensionseinrichtungen |
8 |
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
2 |
|||
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
2 |
|||
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
0 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
21 |
|||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
1 381 |
|
||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
1 358 |
|||
|
II.2: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
Laufende Transfers |
582 |
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
1 381 |
|
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
178 |
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
1 358 |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
176 |
|
||
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
2 |
Laufende Transfers |
420 |
|
|
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
333 |
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
0 |
|
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
181 |
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
0 |
|
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
168 |
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
0 |
|
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
13 |
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
19 |
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
0 |
|
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
18 |
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
0 |
|
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
129 |
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
0 |
|
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
115 |
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
0 |
|
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
14 |
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|
D.614 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
10 |
D.614 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung |
0 |
|
D.6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Pensionseinrichtungen |
8 |
D.6141 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Pensionseinrichtungen |
0 |
|
D.6142 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Alterssicherungssysteme) |
2 |
D.6142 |
Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Alterssicherungssysteme) |
0 |
|
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger |
–6 |
D.61SC |
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger |
1 |
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
0 |
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
384 |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung |
0 |
D.621 |
Geldleistungen der Sozialversicherung |
53 |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
0 |
D.6211 |
Geldleistungen der Sozialversicherung zur Alterssicherung |
45 |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
0 |
D.6212 |
Geldleistungen der Sozialversicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
8 |
|
|
D.622 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung |
279 |
||
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
71 |
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
250 |
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
31 |
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
29 |
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
31 |
D.623 |
Sonstige soziale Geldleistungen |
52 |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
40 |
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
36 |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
29 |
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
35 |
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
7 |
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
35 |
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
4 |
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
1 |
|
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
0 |
||
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
1 |
|||
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
0 |
|||
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
1 219 |
|
||
|
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
1 196 |
|||
|
II.3: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
1 219 |
||
|
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
1 196 |
|||
|
D.63 |
Soziale Sachleistungen |
215 |
|||
|
D.631 |
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion |
211 |
|||
|
D.632 |
Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion |
4 |
|||
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
1 434 |
|
||
|
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
1 411 |
|||
|
II.4: |
Einkommensverwendungskonto |
|
II.4.1: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
1 219 |
||
|
P.3 |
Konsumausgaben |
1 015 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
1 196 |
|
P.31 |
Konsumausgaben für den Individualverbrauch |
1 015 |
|
||
|
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
||
|
B.8g |
Sparen, brutto |
215 |
|
||
|
B.8n |
Sparen, netto |
192 |
|||
|
II.4.2: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
1 434 |
||
|
P.4 |
Konsum (Verbrauchskonzept) |
1 230 |
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
1 411 |
|
P.41 |
Individualkonsum (Verbrauchskonzept) |
1 230 |
|
||
|
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
11 |
||
|
B.8g |
Sparen, brutto |
215 |
|
||
|
B.8n |
Sparen, netto |
192 |
|||
|
III: |
Vermögensänderungskonten |
|
III.1: |
Vermögensbildungskonto |
|
III.1.1: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
210 |
B.8n |
Sparen, netto |
192 |
|
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
23 |
||
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
0 |
|||
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
23 |
|||
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
–5 |
|||
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
–2 |
|||
|
D.92p |
Geleistete Investitionszuschüsse |
|
|||
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
–3 |
|||
|
III.1.2: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
55 |
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
210 |
|
P.5n |
Nettoinvestitionen |
32 |
|
||
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
48 |
|||
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
48 |
|||
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
45 |
|||
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
3 |
|||
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
0 |
|||
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
|||
|
P.51c |
Abschreibungen |
–23 |
|||
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
2 |
|||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
5 |
|||
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
4 |
|||
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
3 |
|||
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
1 |
|||
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
|
|||
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
174 |
|||
|
III.2: |
Finanzierungskonto |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
174 |
||
|
F |
Nettozugang an finanziellen Aktiva |
189 |
F |
Nettozugang an Passiva |
15 |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
64 |
F.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
F.21 |
Bargeld |
10 |
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
0 |
|
F.22 |
Sichteinlagen |
27 |
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
0 |
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
27 |
|
||
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
27 |
F.4 |
Kredite |
11 |
|
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
2 |
||
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
10 |
F.42 |
Langfristige Kredite |
9 |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
3 |
|
||
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
7 |
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
|
F.71 |
Finanzderivate |
0 |
||
|
F.4 |
Kredite |
3 |
F.711 |
Optionen |
0 |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
3 |
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
0 |
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
66 |
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|
F.51 |
Anteilsrechte |
53 |
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
4 |
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
48 |
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
0 |
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
2 |
|
||
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
3 |
|||
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
13 |
|||
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
5 |
|||
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
8 |
|||
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
39 |
|||
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
4 |
|||
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
22 |
|||
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen |
11 |
|||
|
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Pensionseinrichtungen |
|
|||
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
2 |
|||
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
0 |
|||
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
|||
|
F.71 |
Finanzderivate |
1 |
|||
|
F.711 |
Optionen |
1 |
|||
|
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
|||
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
2 |
|||
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|||
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
3 |
|||
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
1 |
|||
|
III.3: |
Konto sonstiger Vermögensänderungen |
|
III.3.1: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
0 |
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
1 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
0 |
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
1 |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AN.12 |
Vorräte |
0 |
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
0 |
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
|
AF |
Forderungen |
0 |
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF |
Forderungen |
1 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
0 |
||||
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
|||
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
|||
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
|||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
|||
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
|||
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen |
0 |
|||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–1 |
||
|
III.3.2: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
80 |
AF |
Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
35 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
28 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
2 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
5 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
45 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
45 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
16 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
6 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
10 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
96 |
||
|
III.3.2.1: |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
56 |
AF |
Verbindlichkeiten |
5 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
34 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
28 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
2 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
4 |
AF.4 |
Kredite |
3 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
22 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
22 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
2 |
|
AF |
Forderungen |
36 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
17 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
4 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
9 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
5 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|||
|
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
87 |
||
|
III.3.2.2: |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
24 |
AF |
Verbindlichkeiten |
–5 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
1 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
1 |
AF.4 |
Kredite |
–3 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
23 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
23 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–2 |
|
AF |
Forderungen |
–20 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–17 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
2 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
–5 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–1 |
|||
|
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
9 |
||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.1: |
Bilanz am Jahresanfang |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
1 429 |
AF |
Verbindlichkeiten |
189 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
856 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
713 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
10 |
|
AN.12 |
Vorräte |
48 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
2 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
95 |
AF.4 |
Kredite |
169 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
573 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
573 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
8 |
|
AF |
Forderungen |
3 260 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
840 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
198 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
24 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 749 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
391 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
55 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
4 500 |
||
|
IV.2: |
Änderung der Bilanz |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
|
Gesamte Veränderung der Aktiva |
|
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten |
||
|
AN |
Vermögensgüter |
115 |
AF |
Verbindlichkeiten |
16 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
67 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
53 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
4 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
10 |
AF.4 |
Kredite |
11 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
48 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
48 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|
AF |
Forderungen |
205 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
64 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
16 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
3 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
76 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
39 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
3 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|||
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
304 |
||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
210 |
|||
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–1 |
|||
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
96 |
|||
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
87 |
|||
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
9 |
|||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.3: |
Bilanz am Jahresende |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
1 544 |
AF |
Verbindlichkeiten |
205 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
923 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
766 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
10 |
|
AN.12 |
Vorräte |
52 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
2 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
105 |
AF.4 |
Kredite |
180 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
621 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
621 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
1 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
12 |
|
AF |
Forderungen |
3 465 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
904 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
214 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
27 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 825 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
430 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
6 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
59 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
4 804 |
||
Tabelle 24.7 — Vollständige Kontenabfolge für den Sektor private Organisationen ohne Erwerbszweck
|
I: |
Produktionskonto |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
P.2 |
Vorleistungen |
17 |
P.1 |
Produktionswert |
32 |
|
|
P.11 |
Marktproduktion |
0 |
||
|
P.12 |
Produktion für die Eigenverwendung |
0 |
|||
|
P.13 |
Nichtmarktproduktion |
32 |
|||
|
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
15 |
|
||
|
P.51c |
Abschreibungen |
3 |
|||
|
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
12 |
|||
|
II: |
Verteilungs- und Verwendungskonten |
|
II.1: |
Konto der primären Einkommensverteilung |
|
II.1.1: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.1 |
Arbeitnehmerentgelt |
11 |
B.1g |
Wertschöpfung, brutto |
15 |
|
D.11 |
Bruttolöhne und -gehälter |
6 |
B.1n |
Wertschöpfung, netto |
12 |
|
D.12 |
Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
5 |
|
||
|
D.121 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
4 |
|||
|
D.1211 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
4 |
|||
|
D.1212 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
1 |
|||
|
D.1221 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
1 |
|||
|
D.1222 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|||
|
D.29 |
Sonstige Produktionsabgaben |
1 |
|||
|
D.39 |
Sonstige Subventionen |
0 |
|||
|
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
3 |
|||
|
P.51c1 |
Abschreibungen bezüglich Bruttobetriebsüberschuss |
3 |
|||
|
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
0 |
|||
|
II.1.2: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
6 |
B.2g |
Betriebsüberschuss, brutto |
3 |
|
D.41 |
Zinsen |
6 |
|
Selbständigeneinkommen, brutto |
|
|
D.45 |
Pachteinkommen |
0 |
B.2n |
Betriebsüberschuss, netto |
0 |
|
|
|
Selbständigeneinkommen, netto |
|
||
|
D.4 |
Vermögenseinkommen |
7 |
|||
|
D.41 |
Zinsen |
7 |
|||
|
D.42 |
Ausschüttungen und Entnahmen |
0 |
|||
|
D.421 |
Ausschüttungen |
0 |
|||
|
D.422 |
Gewinnentnahmen |
|
|||
|
D.43 |
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen |
0 |
|||
|
D.44 |
Sonstige Kapitalerträge |
0 |
|||
|
D.441 |
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen |
0 |
|||
|
D.442 |
Kapitalerträge aus Ansprüchen gegenüber Alterssicherungssystemen |
|
|||
|
D.443 |
Kapitalerträge aus Investmentfondsanteilen |
0 |
|||
|
D.4431 |
Ausschüttungen aus Investmentfondsanteilen |
0 |
|||
|
D.4432 |
Einbehaltene Gewinne aus Investmentfondsanteilen |
0 |
|||
|
D.45 |
Pachteinkommen |
0 |
|||
|
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
4 |
|
||
|
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
1 |
|||
|
II.2: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
Laufende Transfers |
7 |
B.5g |
Primäreinkommen, brutto |
4 |
|
|
D.5 |
Einkommen- und Vermögensteuern |
0 |
B.5n |
Primäreinkommen, netto |
1 |
|
D.51 |
Einkommensteuern |
0 |
|
||
|
D.59 |
Sonstige direkte Steuern und Abgaben |
0 |
Laufende Transfers |
40 |
|
|
|
D.61 |
Nettosozialbeiträge |
5 |
||
|
D.62 |
Monetäre Sozialleistungen |
5 |
D.611 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
3 |
|
D.621 |
Geldleistungen der Sozialversicherung |
|
D.6111 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
2 |
|
D.6211 |
Geldleistungen der Sozialversicherung zur Alterssicherung |
|
D.6112 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
|
D.6212 |
Geldleistungen der Sozialversicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
|
D.612 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber |
1 |
|
D.622 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung |
5 |
D.6121 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung |
1 |
|
D.6221 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Alterssicherung |
3 |
D.6122 |
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung |
0 |
|
D.6222 |
Sonstige Leistungen zur sozialen Sicherung ohne Leistungen zur Alterssicherung |
2 |
D.613 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte |
1 |
|
D.623 |
Sonstige soziale Geldleistungen |
|
D.6131 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte zur Alterssicherung |
0 |
|
|
D.6132 |
Tatsächliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte ohne Beiträge zur Alterssicherung |
1 |
||
|
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
2 |
|
||
|
D.71 |
Nettoprämien für Nichtlebensversicherungen |
0 |
D.7 |
Sonstige laufende Transfers |
36 |
|
D.711 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Direktversicherungen |
0 |
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
0 |
|
D.712 |
Nettoprämien für Nichtlebens-Rückversicherungen |
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
0 |
|
D.72 |
Nichtlebensversicherungsleistungen |
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
|
|
D.721 |
Leistungen der Nichtlebens-Direktversicherung |
|
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
|
|
D.722 |
Leistungen der Nichtlebens-Rückversicherung |
|
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
|
|
D.73 |
Laufende Transfers innerhalb des Staates |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
36 |
|
D.74 |
Laufende Transfers im Rahmen internationaler Zusammenarbeit |
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
36 |
|
D.75 |
Übrige laufende Transfers |
2 |
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
|
|
D.751 |
Laufende Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
0 |
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
0 |
|
D.752 |
Laufende Transfers zwischen privaten Haushalten |
|
|
||
|
D.759 |
Übrige laufende Transfers, a. n. g. |
2 |
|||
|
|
|||||
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
37 |
|
||
|
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
34 |
|||
|
II.3: |
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
D.63 |
Soziale Sachleistungen |
31 |
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
37 |
|
D.631 |
Soziale Sachleistungen — Nichtmarktproduktion |
31 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
34 |
|
D.632 |
Soziale Sachleistungen — gekaufte Marktproduktion |
0 |
|
||
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
6 |
|||
|
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
3 |
|||
|
II.4: |
Einkommensverwendungskonto |
|
II.4.1: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.6g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Ausgabenkonzept) |
37 |
||
|
P.3 |
Konsumausgaben |
32 |
B.6n |
Verfügbares Einkommen, netto (Ausgabenkonzept) |
34 |
|
P.31 |
Konsumausgaben für den Individualverbrauch |
31 |
|
||
|
P.32 |
Konsumausgaben für den Kollektivverbrauch |
1 |
|||
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
|||
|
B.8g |
Sparen, brutto |
5 |
|||
|
B.8n |
Sparen, netto |
2 |
|||
|
II.4.2: |
|
Verwendung |
Aufkommen |
||||
|
|
B.7g |
Verfügbares Einkommen, brutto (Verbrauchskonzept) |
6 |
||
|
P.4 |
Konsum (Verbrauchskonzept) |
1 |
B.7n |
Verfügbares Einkommen, netto (Verbrauchskonzept) |
3 |
|
P.41 |
Individualkonsum (Verbrauchskonzept) |
|
|
||
|
P.42 |
Kollektivkonsum (Verbrauchskonzept) |
1 |
|||
|
D.8 |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche |
0 |
|||
|
B.8g |
Sparen, brutto |
5 |
|||
|
B.8n |
Sparen, netto |
2 |
|||
|
III: |
Vermögensänderungskonten |
|
III.1: |
Vermögensbildungskonto |
|
III.1.1: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–1 |
B.8n |
Sparen, netto |
2 |
|
|
D.9r |
Empfangene Vermögenstransfers |
0 |
||
|
D.92r |
Empfangene Investitionszuschüsse |
0 |
|||
|
D.99r |
Empfangene sonstige Vermögenstransfers |
0 |
|||
|
D.9p |
Geleistete Vermögenstransfers |
–3 |
|||
|
D.91p |
Geleistete vermögenswirksame Steuern |
0 |
|||
|
D.92p |
Geleistete Investitionszuschüsse |
|
|||
|
D.99p |
Geleistete sonstige Vermögenstransfers |
–3 |
|||
|
III.1.2: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
P.5g |
Bruttoinvestitionen |
5 |
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–1 |
|
P.5n |
Nettoinvestitionen |
2 |
|
||
|
P.51g |
Bruttoanlageinvestitionen |
5 |
|||
|
P.511 |
Nettozugang an Anlagegütern |
5 |
|||
|
P.5111 |
Erwerb neuer Anlagegüter |
5 |
|||
|
P.5112 |
Erwerb gebrauchter Anlagegüter |
1 |
|||
|
P.5113 |
Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter |
–1 |
|||
|
P.512 |
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
|||
|
P.51c |
Abschreibungen |
–3 |
|||
|
P.52 |
Vorratsveränderungen |
0 |
|||
|
P.53 |
Nettozugang an Wertsachen |
0 |
|||
|
NP |
Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern |
1 |
|||
|
NP.1 |
Nettozugang an natürlichen Ressourcen |
1 |
|||
|
NP.2 |
Nettozugang an Nutzungsrechten |
0 |
|||
|
NP.3 |
Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
|
|||
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
–4 |
|||
|
III.2: |
Finanzierungskonto |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
|
B.9 |
Finanzierungssaldo |
–4 |
||
|
F |
Nettozugang an finanziellen Aktiva |
2 |
F |
Nettozugang an Passiva |
6 |
|
F.2 |
Bargeld und Einlagen |
2 |
F.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
F.21 |
Bargeld |
1 |
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
0 |
|
F.22 |
Sichteinlagen |
1 |
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
0 |
|
F.229 |
Sonstige Sichteinlagen |
1 |
|
||
|
F.29 |
Sonstige Einlagen |
0 |
F.4 |
Kredite |
6 |
|
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
2 |
||
|
F.3 |
Schuldverschreibungen |
–1 |
F.42 |
Langfristige Kredite |
4 |
|
F.31 |
Kurzfristige Schuldverschreibungen |
0 |
|
||
|
F.32 |
Langfristige Schuldverschreibungen |
–1 |
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
|
F.71 |
Finanzderivate |
0 |
||
|
F.4 |
Kredite |
0 |
F.711 |
Optionen |
0 |
|
F.41 |
Kurzfristige Kredite |
0 |
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
|
F.42 |
Langfristige Kredite |
0 |
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
F.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
F.51 |
Anteilsrechte |
0 |
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
0 |
|
F.511 |
Börsennotierte Aktien |
0 |
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
0 |
|
F.512 |
Nicht börsennotierte Aktien |
0 |
|
||
|
F.519 |
Sonstige Anteilsrechte |
0 |
|||
|
F.52 |
Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
F.521 |
Anteile an Geldmarktfonds |
0 |
|||
|
F.522 |
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds |
0 |
|||
|
F.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
F.61 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen |
0 |
|||
|
F.62 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen |
0 |
|||
|
F.63 |
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Alterssicherungssystemen |
|
|||
|
F.64 |
Ansprüche von Pensionseinrichtungen an die Träger von Pensionseinrichtungen |
|
|||
|
F.65 |
Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen |
|
|||
|
F.66 |
Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien |
0 |
|||
|
F.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
F.71 |
Finanzderivate |
0 |
|||
|
F.711 |
Optionen |
0 |
|||
|
F.712 |
Terminkontrakte |
0 |
|||
|
F.72 |
Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
F.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|||
|
F.81 |
Handelskredite und Anzahlungen |
|
|||
|
F.89 |
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und Anzahlungen) |
1 |
|||
|
III.3: |
Konto sonstiger Vermögensänderungen |
|
III.3.1: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.1 |
Zubuchungen von Vermögensgütern |
0 |
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
|
K.2 |
Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
K.21 |
Abbau natürlicher Ressourcen |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.22 |
Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter |
0 |
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
K.3 |
Katastrophenschäden |
0 |
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
0 |
|
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AN.12 |
Vorräte |
0 |
|
K.4 |
Enteignungsgewinne/-verluste |
0 |
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
|
AF |
Forderungen |
0 |
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
|
K.5 |
Sonstige Volumenänderungen |
0 |
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF |
Forderungen |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|
K.6 |
Änderungen der Zuordnung |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|
K.61 |
Änderung der Sektorzuordnung |
0 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
K.62 |
Änderung der Vermögensart |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|
||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
Sonstige Volumenänderungen insgesamt |
0 |
||||
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
|||
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
|||
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
|||
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
0 |
|||
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
0 |
|||
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
|||
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
|||
|
AF |
Forderungen |
0 |
|||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
|
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
–1 |
||
|
III.3.2: |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.7 |
Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
8 |
AF |
Verbindlichkeiten |
0 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
5 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
5 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
0 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
3 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
3 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
2 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
|
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
|
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
10 |
||
|
III.3.2.1: |
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.71 |
Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
6 |
AF |
Verbindlichkeiten |
3 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
5 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
5 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
1 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
1 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
1 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
1 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|
AF |
Forderungen |
3 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
2 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
1 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
6 |
||
|
III.3.2.2: |
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
Veränderung der Aktiva |
Veränderung der Passiva |
||||
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
K.72 |
Reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
|
|
AN |
Vermögensgüter |
2 |
AF |
Verbindlichkeiten |
–3 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
0 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
0 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–1 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
–1 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
2 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
2 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
|
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
–1 |
|
AF |
Forderungen |
–1 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
–2 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|||
|
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
4 |
||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.1: |
Bilanz am Jahresanfang |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
159 |
AF |
Verbindlichkeiten |
121 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
124 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
121 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
38 |
|
AN.12 |
Vorräte |
1 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
2 |
AF.4 |
Kredite |
43 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
35 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
|
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
35 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
5 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
35 |
|
AF |
Forderungen |
172 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
110 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
25 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
8 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
22 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
4 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
3 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
210 |
||
|
IV.2: |
Änderung der Bilanz |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
|
Gesamte Veränderung der Aktiva |
|
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten |
||
|
AN |
Vermögensgüter |
11 |
AF |
Verbindlichkeiten |
6 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
7 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
7 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
0 |
|
AN.12 |
Vorräte |
0 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
0 |
AF.4 |
Kredite |
6 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
4 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
4 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
0 |
|
AF |
Forderungen |
4 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
2 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
0 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
1 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
0 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
1 |
|||
|
|
B.10 |
Reinvermögensänderung |
9 |
||
|
B.101 |
Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers |
–1 |
|||
|
B.102 |
Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen |
0 |
|||
|
B.103 |
Reinvermögensänderung durch Umbewertung |
10 |
|||
|
B.1031 |
Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste |
6 |
|||
|
B.1032 |
Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste |
4 |
|||
|
IV: |
Vermögensbilanzen |
|
IV.3: |
Bilanz am Jahresende |
|
Aktiva |
Passiva |
||||
|
AN |
Vermögensgüter |
170 |
AF |
Verbindlichkeiten |
127 |
|
AN.1 |
Produzierte Vermögensgüter |
131 |
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|
AN.11 |
Anlagegüter |
128 |
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
38 |
|
AN.12 |
Vorräte |
1 |
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
0 |
|
AN.13 |
Wertsachen |
2 |
AF.4 |
Kredite |
49 |
|
AN.2 |
Nichtproduzierte Vermögensgüter |
39 |
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
0 |
|
AN.21 |
Natürliche Ressourcen |
39 |
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
5 |
|
AN.22 |
Nutzungsrechte |
0 |
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|
AN.23 |
Nettozugang an Firmen werten und einzeln veräußerbaren Marketing-Vermögenswerten |
0 |
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
35 |
|
AF |
Forderungen |
176 |
|
||
|
AF.1 |
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) |
|
|||
|
AF.2 |
Bargeld und Einlagen |
112 |
|||
|
AF.3 |
Schuldverschreibungen |
25 |
|||
|
AF.4 |
Kredite |
8 |
|||
|
AF.5 |
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds |
23 |
|||
|
AF.6 |
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme |
4 |
|||
|
AF.7 |
Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen |
0 |
|||
|
AF.8 |
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten |
4 |
|||
|
|
B.90 |
Reinvermögen |
219 |
||
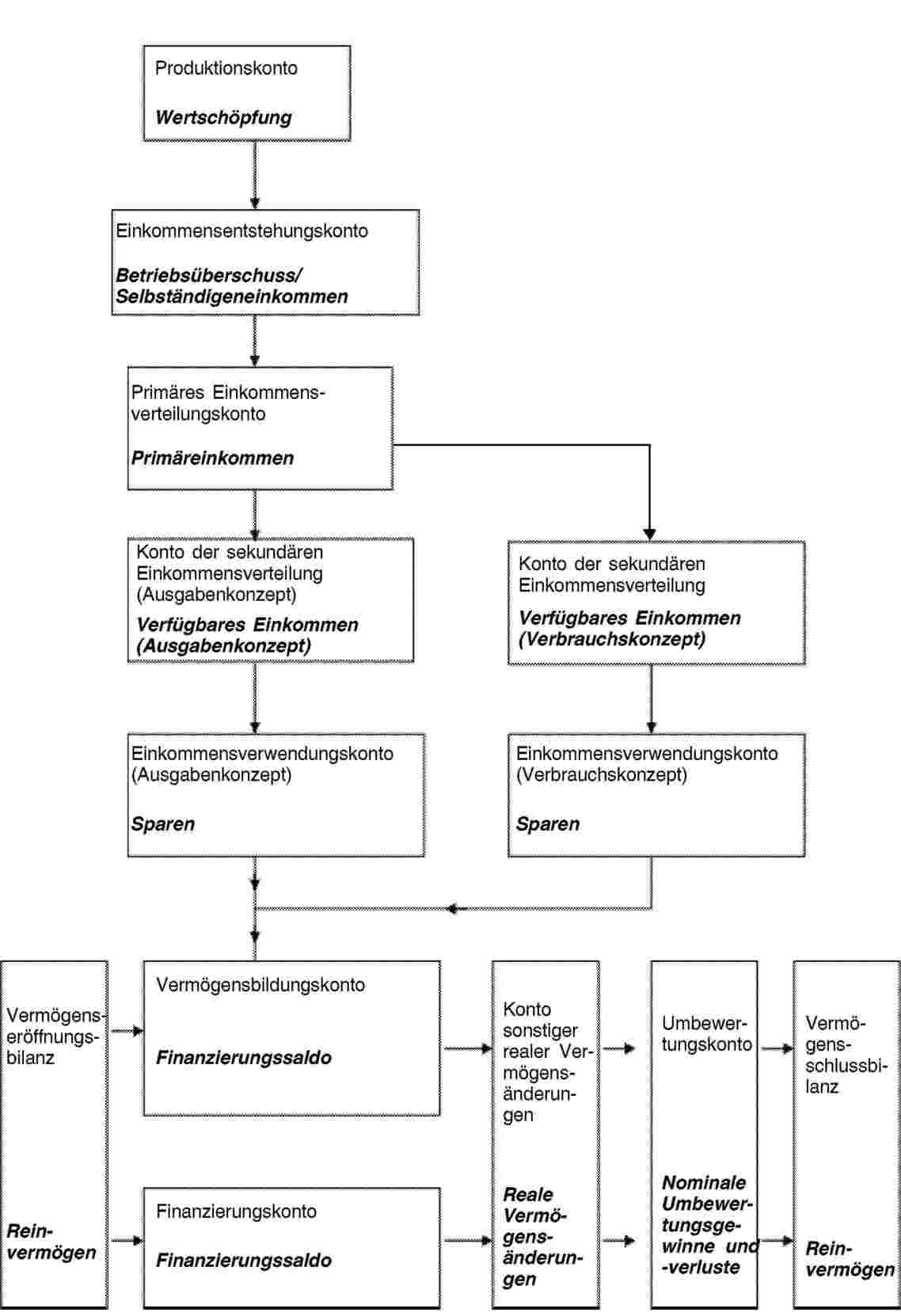
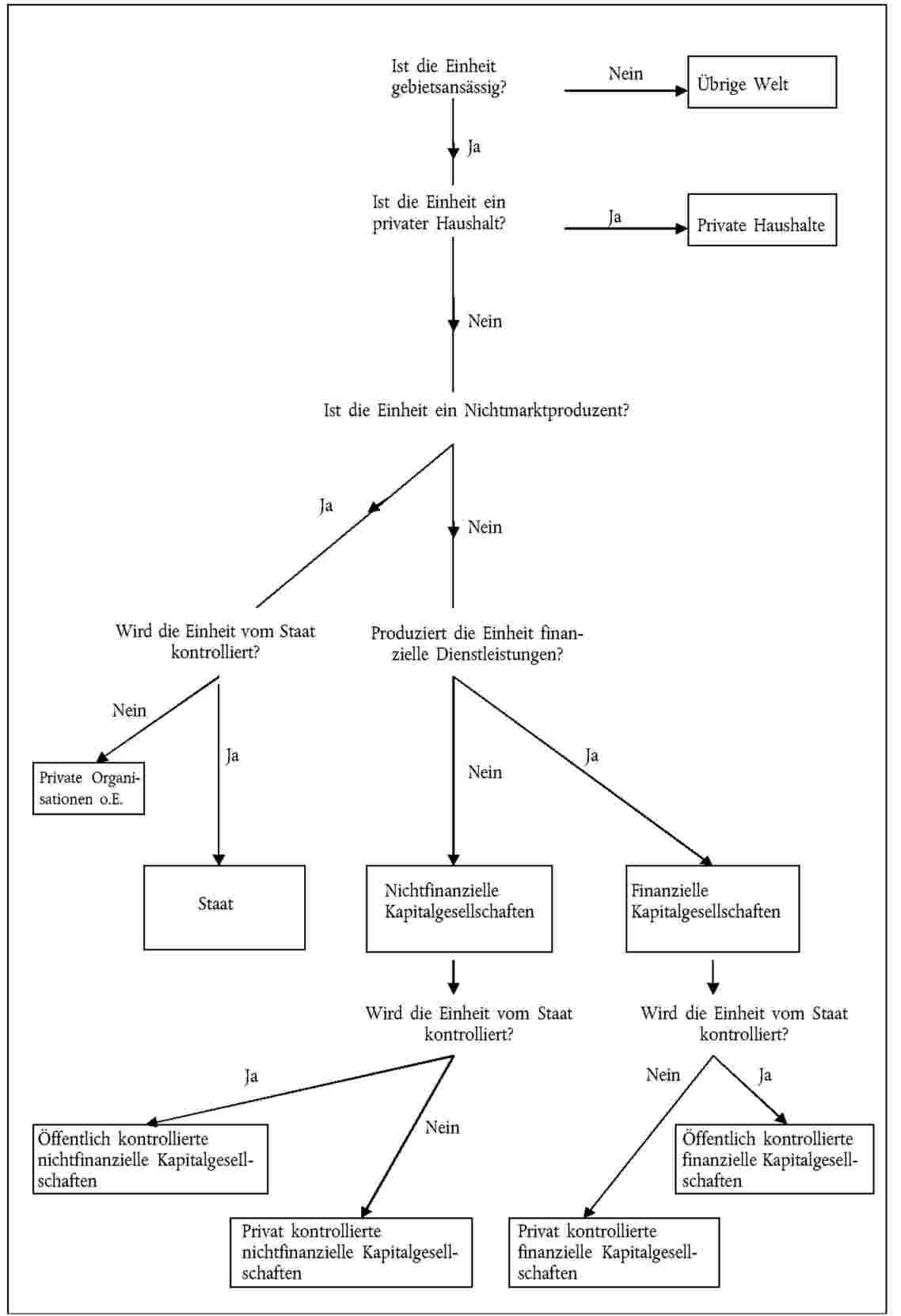
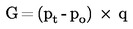

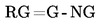




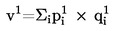
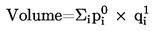

 zwar kein Preis, wohl aber ein Preisindex definiert werden. Der Preisindex ist demnach das Verhältnis zwischen dem Wert in der Berichtsperiode und dem Volumen, dargestellt durch die Formel:
zwar kein Preis, wohl aber ein Preisindex definiert werden. Der Preisindex ist demnach das Verhältnis zwischen dem Wert in der Berichtsperiode und dem Volumen, dargestellt durch die Formel:
 und ermöglicht die Aufgliederung von Änderungen des Wertes einer Gruppe von Gütern in eine Volumenänderung und eine Preisänderung.
und ermöglicht die Aufgliederung von Änderungen des Wertes einer Gruppe von Gütern in eine Volumenänderung und eine Preisänderung.